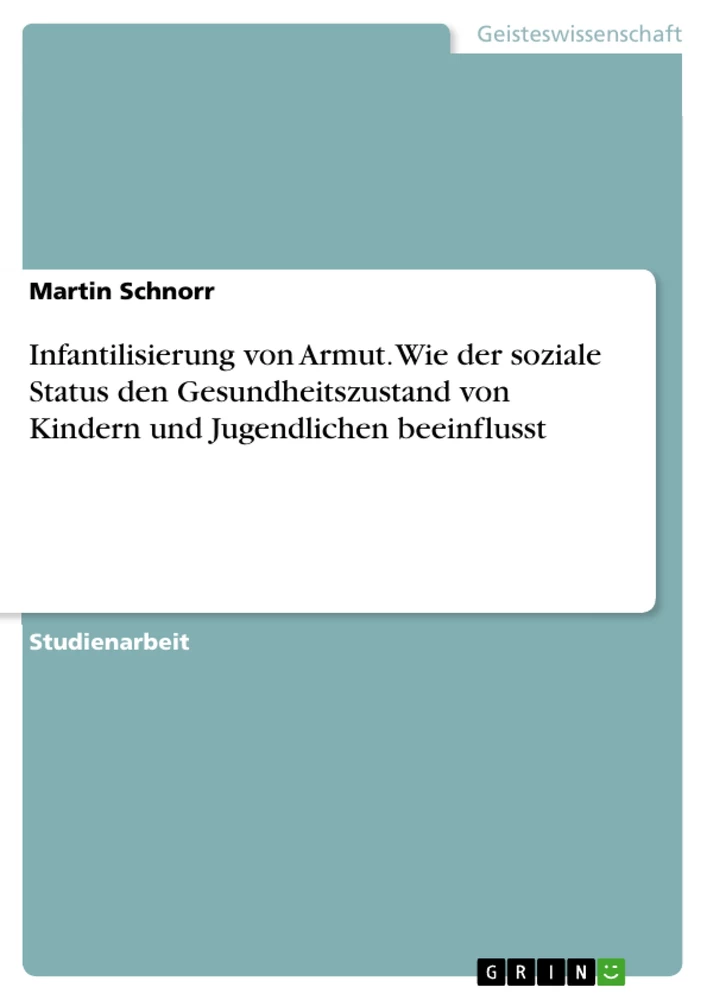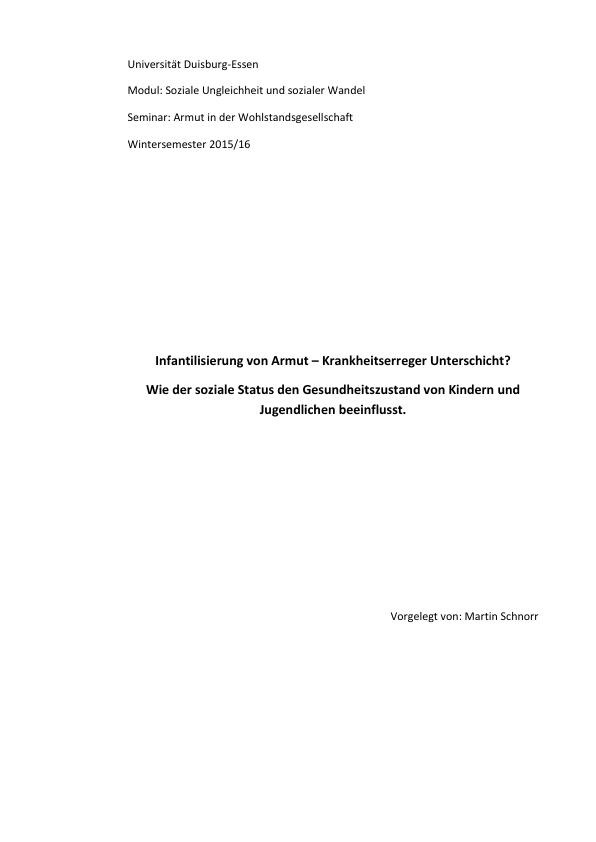Diese Hausarbeit untersucht und erläutert das Phänomen der Kinderarmut in der Bundesrepublik Deutschland. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf dem Einfluss, den Armut auf die Entwicklung eines Kindes nimmt. Kinder werden nicht von selbst arm, Kinder werden in Armutsverhältnisse hineingeboren. Das Aufwachsen in beengtem Wohnraum, Arbeitslosigkeit der Eltern und fehlendes Geld für kulturelle, bildende oder sportliche außerfamiliäre Aktivitäten fehlt. Die daraus resultierenden Konsequenzen für die gesundheitliche Entwicklungsdimension von Kindern werden in dieser Arbeit erläutert und dargestellt.
Verschiedene Wohlstandsorganisationen untersuchen seit einiger Zeit den Einfluss der sozialen Lage auf die kindliche Entwicklung. Durch empirische Fakten und Zahlen wird dargestellt, welches Ausmaß die Kinderarmut in Deutschland hat und inwiefern dieses Ausmaß zur Beeinträchtigung der Gesundheitsqualität von Kindern beiträgt. Betrachtet werden hier die Haushaltsstrukturen in denen Familien mit Kindern leben. Im letzten Schritt der Arbeit wird der gesundheitliche Zustand von Kindern im Zusammenhang mit ihrem sozialen Status untersucht. Dabei soll beleuchtet werden welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen Kinder aus sozial schwächeren Familien erleben und wie die Verteilung der Faktoren allgemeiner Gesundheitszustand, Psyche und Verhaltensauffälligkeiten, sowie Übergewicht dargestellt ist.
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. BEGRIFFSERKLÄRUNG ARMUT
2.1 ABSOLUTES ARMUTSKONZEPT
2.2 RELATIVES ARMUTSKONZEPT
2.2.1 RESSOURCENANSATZ
2.2.2 LEBENSLAGENANSATZ
2.2.3 KINDGERECHTER ARMUTSBEGRIFF
3. KINDERARMUT IN DEUTSCHLAND
3.1 STRUKTUR UND URSACHEN VON KINDERARMUT
3.1.1 VERTEILUNG VON ARMUTSRISIKEN NACH KINDESALTER
3.1.2 VERTEILUNG VON ARMUTSRISIKEN NACH FAMILIENTYP
3.1.3 VERTEILUNG VON ARMUTSRISIKEN NACH MIGRATIONSHINTERGRUND
3.1.4 VERTEILUNG VON ARMUTSRISIKEN NACH ERWERBSSTATUS DER ELTERN
4. GESUNDHEITLICHE FOLGEN VON ARMUT FÜR KINDER
4.1 ALLGEMEINER GESUNDHEITSZUSTAND
4.2 PSYCHE UND VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN
4.3 ÜBERGEWICHT
4.4 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
5. FAZIT
LITERATURVERZEICHNIS