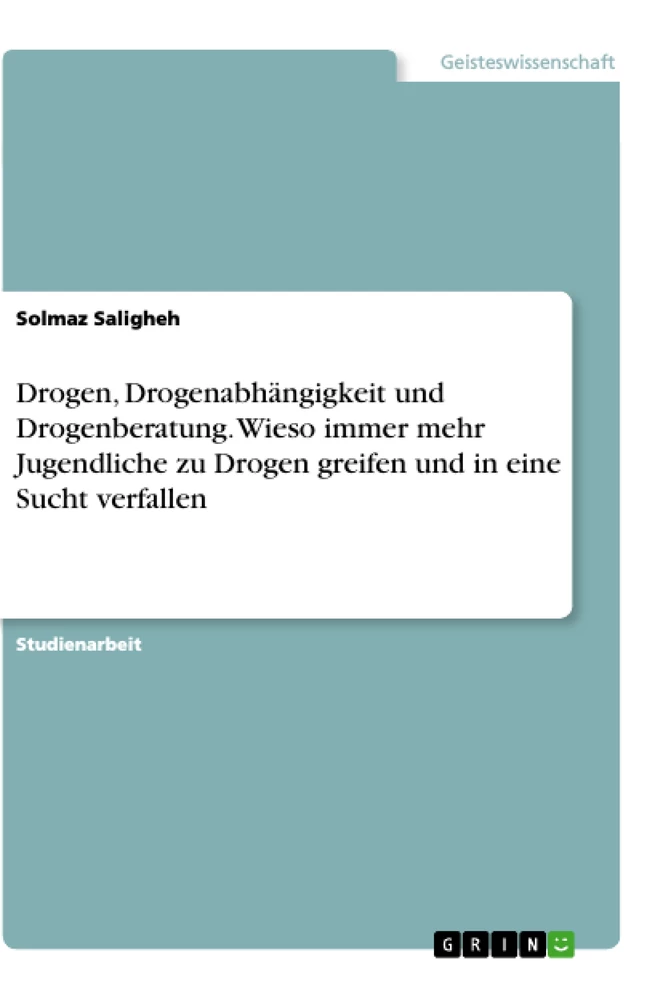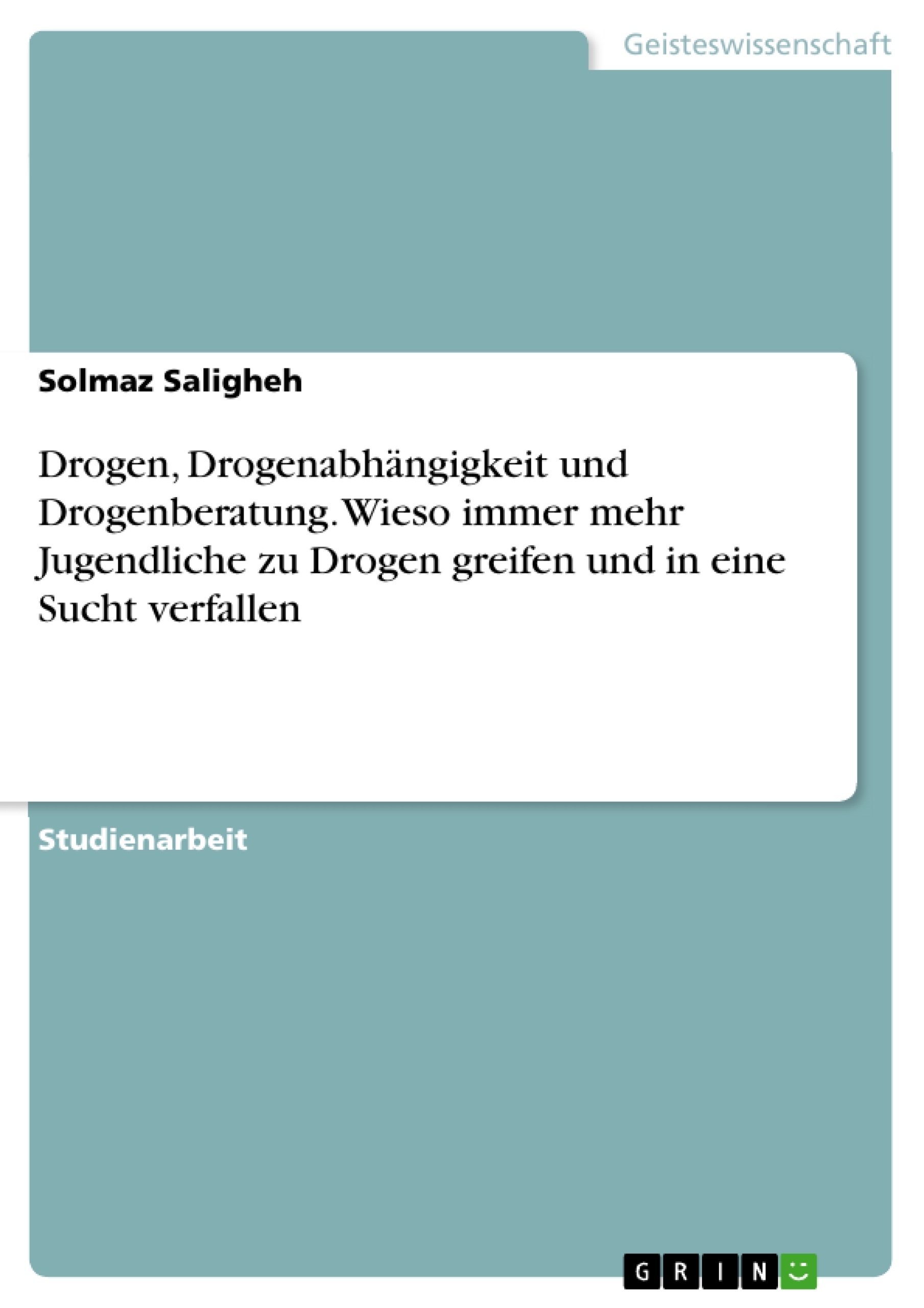Ziel dieser Ausarbeitung ist die Darstellung von unterschiedlichen Ursachen für den Drogenkonsum sowie die Möglichkeiten zur Bewältigung dieses Konsumproblems dass viele Menschen vor allem Jugendliche verhindert ein gesundes Leben zu führen. Ein Weg der dazu stark beitragen kann ist die Drogenberatung, welches ich ausführlich vorstellen werde.
Vor diesem Hintergrund werden in der nachfolgenden Ausarbeitung zuerst der Begriff Drogen definiert. Daran anschließend werden die Ursachen für die Konsumierung erläutert, um dann auf deren Bewältigung mit Hilfe der Drogenberatung näher einzugehen. Außerdem beschäftige ich mich in meiner Arbeit mit der Frage, wieso immer mehr Jugendliche zu Drogen greifen und in eine Sucht verfallen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Drogen
2.1. Definition Droge
2.2. Arten von Drogen/ Beispiele
2.3. Illegale Drogen
2.4. Betäubungsmittelrecht
2.5. Drogengebrauch in Jugendcliquen
2.6. Drogengebrauch in Jugendphasen
3. Drogenabhängigkeit
3.1. Definition
3.2. Kognitive Modelle zur Sucht
3.3. Ursachen und Bedingungen des Drogenkonsums
3.4. Problemaufriss zur Situation jugendlicher Drogenabhängiger
3.5. Komorbidität
3.6. Behandlung
3.7. Von der Gefährdung bis zur Abhängigkeit
4. Drogenberatung
4.1. Geschichte
4.2. Angebot der Beratungsstellen
4.3. Grundsätze der Arbeit in Beratungsstellen
4.4. Arbeitsphasen und Methoden
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Wir leben in einer Gesellschaft in der Selbstverantwortung und die Vernunft eine sehr wichtige Rolle spielen. Heutzutage kann der Mensch alles haben, legal oder auch illegal. Gerade die jüngere Generation ist mit diesem stark konfrontiert. Durch das Zusammentreffen von Individuations- und Integrationsprozessen trägt die Lebensphase Jugend ein Risiko in sich. Sie enthält ein positives Stimulierungspotential, aber zugleich auch ein hohes Belastungspotential. Die „moderne“ Lebensweise mit ihren Reizen und Verlockungen erregt die Neugier der Jugendlichen. Diese Neugierde verstärkt das Interesse an die Weiterentwicklung einer Person im positiven Sinne aber sie kann auch gefährlich für sie werden. Die „gefährliche“ Neugier ist. z.B. eine Antwort auf die Frage, warum Jugendliche Drogen konsumieren und daraus sie (nicht immer) ein Suchtverhalten aufweisen.
Drogen gibt es überall auf der Welt und leider sind sie auch ein Teil der „modernen“ Lebensweise. Für Manche Menschen sind Drogen ihr Geld, ein Business womit sie ihr Leben finanzieren, für andere sind sie tödlich. Der Drogenkonsum nimmt bei Jugendlichen zu. Im Jahr 2012 hat in Deutschland jeder dreizehnte im Alter von 12 bis 17 Jahren Cannabis konsumiert (vgl. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung 2016,S.1). Drogenkonsum und Abhängigkeit sind kein privates Problem der betroffenen, sondern eine gesellschaftliche Angelegenheit.
Unter Drogen ist in dieser Ausarbeitung die so genannte „nichtverkehrsfähige Betäubungsmittel“ zu verstehen. Zu dieser Gruppierung zählen alle illegalen Drogen, u.a. Marihuana, Heroin, LSD und synthetische Drogen (vgl. DocCheck Flexikon 2016,S.1). Ziel dieser Ausarbeitung ist die Darstellung von unterschiedlichen Ursachen für den Drogenkonsum sowie die Möglichkeiten zur Bewältigung dieses Konsumproblems dass viele Menschen vor allem Jugendliche verhindert ein gesundes Leben zu führen. Ein Weg der dazu stark beitragen kann ist die Drogenberatung, welches ich ausführlich vorstellen werde.
Vor diesem Hintergrund werden in der nachfolgenden Ausarbeitung zuerst der Begriff Drogen definiert. Daran anschließend werden die Ursachen für die Konsumierung erläutert, um dann auf deren Bewältigung mit Hilfe der Drogenberatung näher einzugehen. Außerdem beschäftige ich mich in meiner Arbeit mit der Frage, wieso immer mehr Jugendliche zu Drogen greifen und in eine Sucht verfallen.
2. Drogen
2.1. Definition Drogen
Drogen sind Substanzen, die eine psychoaktive Wirkung hervorrufen (vgl.Arnold/Schille 2002,S.79). Der Begriff „Droge“ ist ursprünglich eine Sammelbezeichnung für Arzneimittel, die durch Trocknung von Pflanzen gewonnen und haltbar gemacht werden. Heute werden mit Drogen Stoffe definiert, die eine Wirkung auf das zentrale Nervensystem haben und deswegen Abhängigkeit erzeugen können. Nach der Definition von der Weltgesundheitsorganisation wird als Droge „jede Substanz, die, dem lebenden Organismus zugeführt, eine oder mehrere Funktionen zu verändern vermag“ bezeichnet. Gemäß der WHO-Terminologie beschränkt sich also der Drogenbegriff nicht nur auf illegale Drogen sondern auch auf legale (vgl.Thommen 1984,S.9).
2.2. Arten von Drogen/ Beispiele
Legale (weiche) Drogen
- Schlaf- und Beruhigungsmittel
- Alkohol
- Aufputschmittel
- Coffein
- Nikotin
Illegale (harte) Drogen:
- Marihuana und Haschisch
- Kokain
- Heroin
- LSD (Lysergsäurediäthylamid)
Die Aufteilung der oben genannten Drogen nach legalen (weichen) und illegalen (harten) Drogen ist fraglich, da die Stärke und die Wirkung des Mittels von dem jeweiligen Organismus abhängen. Als harte Drogen gelten illegale, also nichtverkehrsfähige Substanzen, die eine physische Abhängigkeit erzeugen können. Die eigene Persönlichkeit spielt dabei eine große Rolle. Der Konsum aller Drogenarten muss immer im Zusammenhang mit den sozialen Umständen gesehen werden. Legale Drogen sind nicht weniger gefährlich als illegale Drogen. Unabhängig davon, ob die Drogen legal oder illegal sind, der Missbrauch dieser Substanzen kann immer persönliche, soziale und medizinische Probleme mit sich bringen (vgl. Bäuerle/König/Pedina 1979,S.10-14).
2.3. Illegale Drogen
Illegale Drogen werden in drei Wirkungsklassen eingeteilt (Sedativa, Halluzinogene Stimulanzien) welches die kurzfristige Wahrnehmung, Stimmung und Kognition des konsumierenden beeinflusst. Diese Veränderungen können z.B. das Risiko von Verkehrsunfällen erhöhen. Langfristig kann der illegale Drogenkonsum zu negativen Folgen auf die psychische Gesundheit haben. Das durchschnittliche Alter des Erstkonsum liegt für Cannabis bei 16 Jahren, die ersten Erfahrungen mit Ecstasy, Amphetaminen oder psychoaktiven Pilzen werden mit 17 Jahren und erste Erfahrung mit Kokain werden mit 18 Jahren gemacht (vgl. Thomasius/Schulte-Markwort/Küstner/Riedesser 2009,S.27).
Jugendliche mit geringem sozioökonomischen Status und schlechter finanzieller Lage greifen immer häufiger zu illegalen Drogen.
Risikoreichem Substanzkonsum geht oft Problemverhalten in der Kindheit voraus. Auch der frühe Beginn des Substanzkonsums, eine schnelle Steigerung in Konsummenge und Häufigkeit können zu einem langfristigen problematischen Entwicklungspfad führen (vgl. Thomasius/Schulte-Markwort/Küstner/Riedesser 2009,S.28).
2.4. Betäubungsmittelrecht
Der Umgang mit Betäubungsmitteln ist grundsätzlich strafbar. Dies beinhaltet: das Anbauen von Betäubungsmittel, kaufen, sich schenken lassen, auffinden und dann behalten, Verkaufen, Weitergeben, Verschenken, Besitzen und das Selbstherstellen sind jeweils strafbare Formen des Umgangs mit Betäubungsmitteln. Nicht strafbar dagegen ist der Konsum, denn für jede Droge gibt es einen nicht strafbaren Konsumweg z.B. das Mitrauchen am Haschisch-Joint, Schnupfen der angebotenen Drogen, einnehmen von angebotenem Ecstasy. Dafür ist die Weitergabe des brennenden Joints in der Runde strafbar, nicht aber die Rückgabe an den Eigentümer. Der Drogenkonsument der vor Gericht aussagt, dass er nur seit einer bestimmten Zeit Drogen konsumiert kann nicht dafür bestraft werden, wenn er nicht angibt in welchen einzelmengen er die Drogen gekauft oder geschenkt bekommen hat. Der Nachweis von Drogenkonsum ist über Urin, Blut oder Haare nachweisbar. Der Nachweis von Betäubungsmitteln im Blut kann für Autofahrer gem. §24a FEV zu Geldbuße und Fahrverbot führen (vgl. Arnold/Schille 2002,S. 75).
2.5. Drogengebrauch in Jugendcliquen
Jugendliche bilden oft neben der Schule und der Familie sogenannte „Cliquen“. Damit ist eine Form von Gleichaltrigen Gruppen gemeint, die sich selbst von anderen Jugendlichen abgrenzen, Formen oder Elemente einer Subkultur beinhalten. Die Clique ist eine wichtige Sozialisationsinstanz in der Reifephase der Jugend.
[...]