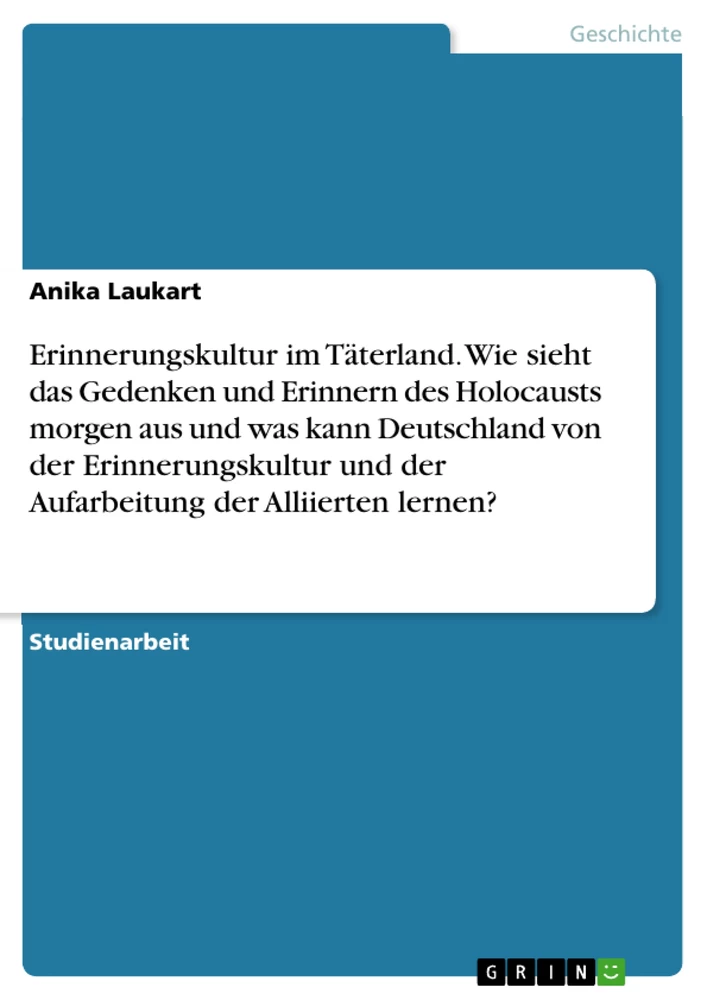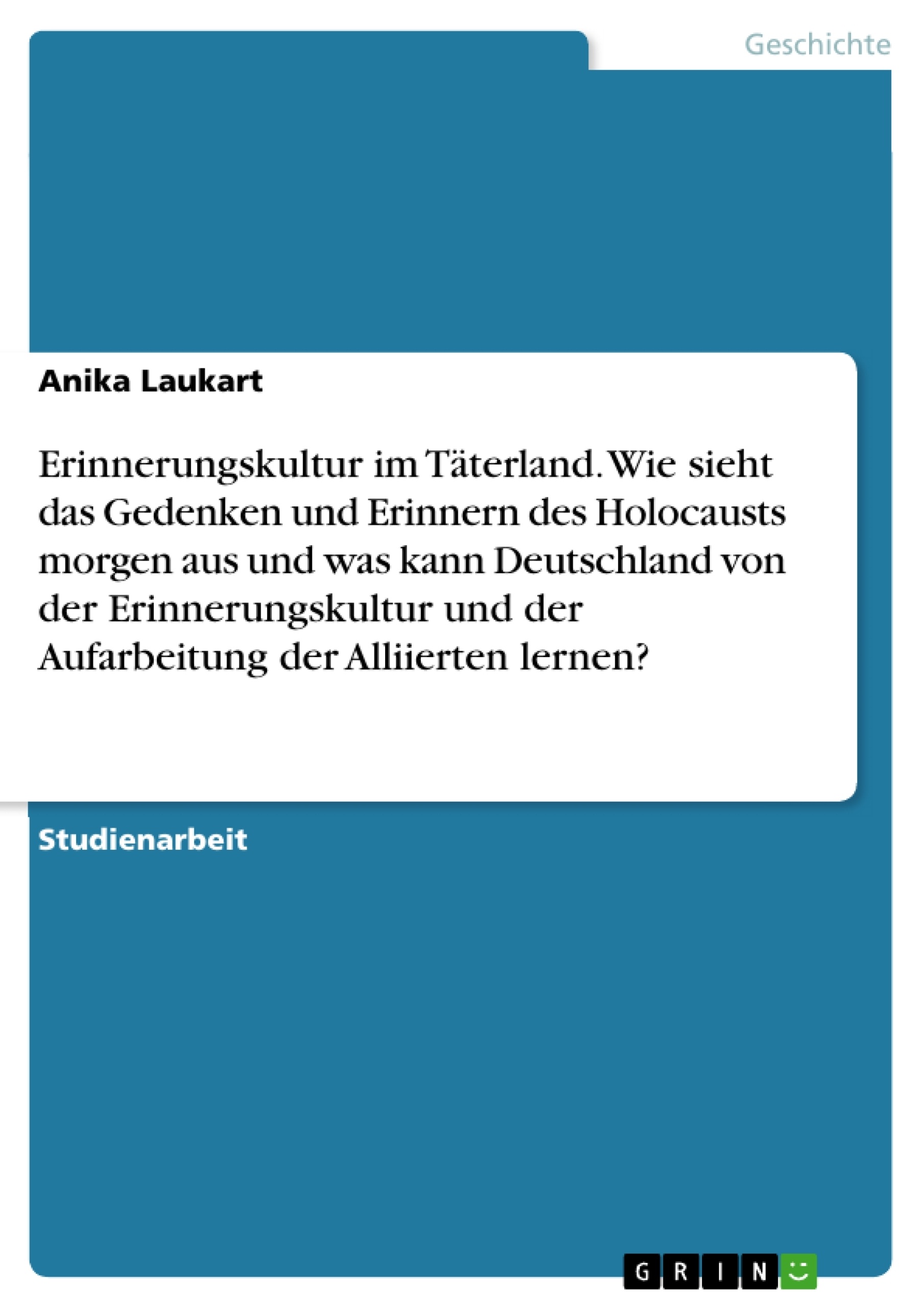Diese Hausarbeit soll einen Überblick über die deutsche Erinnerungskultur und das gesellschaftliche Gedenken verschaffen. Hierbei soll insbesondere der Punkt des Gedenkens auf dem Boden des Täterlandes untersucht werden und mit den Erinnerungskulturen der Alliierten vergleichen werden.
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Erinnerungskultur, schwerpunktmäßig in Deutschland. Sie soll aufzeigen wie Heutzutage im Jahr 2015 an die Opfer des Holocausts gedacht und erinnert wird und wie sich diese Erinnerungskultur gewandelt hat und einen Ausblick darauf geben, wie sich diese Erinnerungskultur weiter wandeln muss, kann und wird.
Die Gräueltaten des NS-Regimes werden teilweise in dieser Arbeit genannt, da sie monumental für die Aufarbeitung und das Verständnis der Geschichte sind, und nur so dazu dienlich sind, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und eine würdige Erinnerungskultur zu schaffen.
Alle Menschen, egal welcher Rassen, glaubensformen, Geschlechter, Berufe und Geistliche- sowie Politische Meinungs- und Glaubensformen sie entsprangen mögen, werden in dieser Arbeit gleichwertig betrachtet und mit gebührendem Respekt ihrer Toten gegenüber geschrieben, sofern die wissenschaftliche Distanz dies zulässt. In dieser Arbeit wird nicht eine Gruppe der vielen Millionen von Toten mehr hervorgehoben als andere, keine Bevölkerungsgruppe soll unbedacht bleiben, auch wenn diese nicht ausdrücklich erwähnt wird.
Die geschehenen Taten sind nicht wieder gut zu machen oder zu vergessen. Diese Arbeit soll einen Beitrag, exemplarisch an der Gedenkstätte Bergen-Belsen, leisten, um das Gedenken und das große Erbe der Überlebenden, das Gedenken und jenes Wissen um die Wahrheit der Vergangenheit, aufrecht zu erhalten und weiter in die Zukunft fortzutragen.
Anlass dieser Arbeit ist die 70. Jährung der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Welcher mit einem Festakt, an dem der amtierenden Bundespräsident Herr Joachim Gauck, teilnahm, sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung des Bundeslandes Niedersachsens, des britischen Königshauses sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden und Gemeinden ehemaliger verfolgter Volksgruppen sowie einige Überlebende des Konzentrationslagers Bergen-Belsen.
Inhaltsverzeichnis
II. Vorwort
III. Einführung
1. Historischer Hintergrund
2. Umfrage zum Thema Erinnern - 2015
IV. Theorie des Erinnerns
1. Was ist eine Erinnerungskultur? – Eine Annäherung
2. Erinnerungskultur in Deutschland
2.1 Der Rhythmus des Erinnerns
2.2 Militärisches Gedenken
2.3 Verblassende Erinnerungen
3. Die Erinnerungskulturen der Alliierten – Ein Vergleich
3.1 Frankreich
3.2 Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
3.3 Sowjetunion/ Stellvertretend Russland
3.4 Groß Britannien
3.5 Vergleiche der Erinnerungskulturen
V. Praxisteil
1. Vorstellung der Gedenkstätte Bergen-Belsen
2. Ausstellungskonzepte der Gedenkstätte Bergen-Belsen
2.1 Das Dokumentationszentrum
2.2 Der Sprung ins digitale Zeitalter
3. 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Bergen-Belsens – 26.04.2015
3.1 Der Festakt in der Gedenkstätte
4. Die Zukunft des Gedenkens und Erinnerns
4.1 Die Hürden und Möglichkeiten des digitalen Zeitalters
4.2 Vom Umgang mit dem geistigen Erbe der Überlebenden
5. Prognose
5.1 Umfrage: Möchten sie vergessen?
5.2 Auswirkungen der Abschaffung/ Beibehaltung des Erinnerns
6. Fazit
VI. Schlusswort
Literaturverzeichnis
Grafikverzeichnis