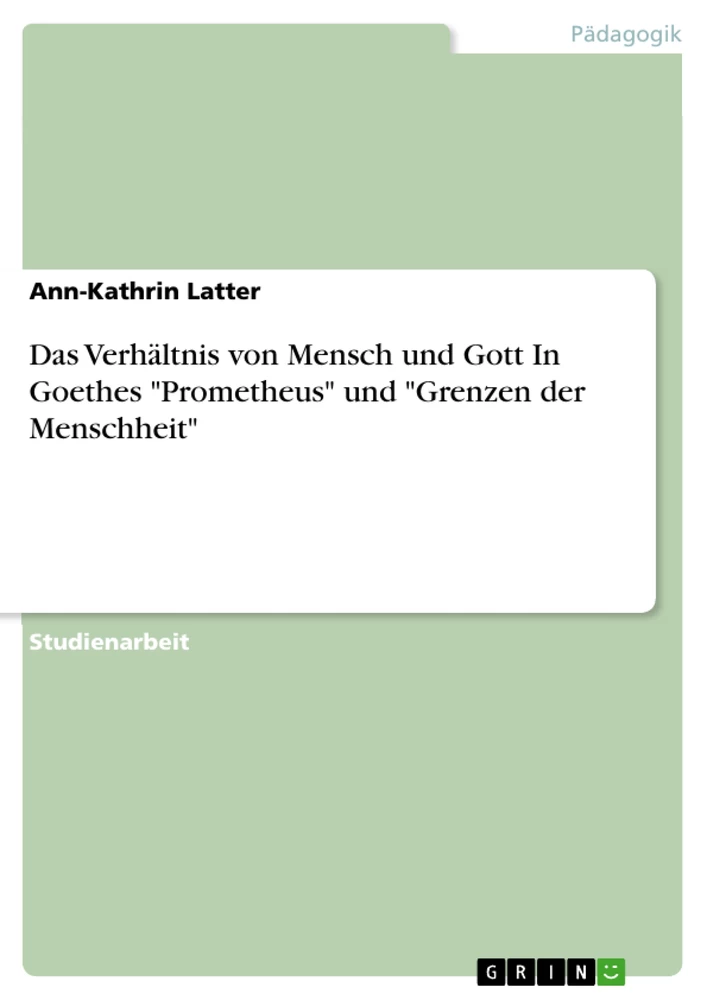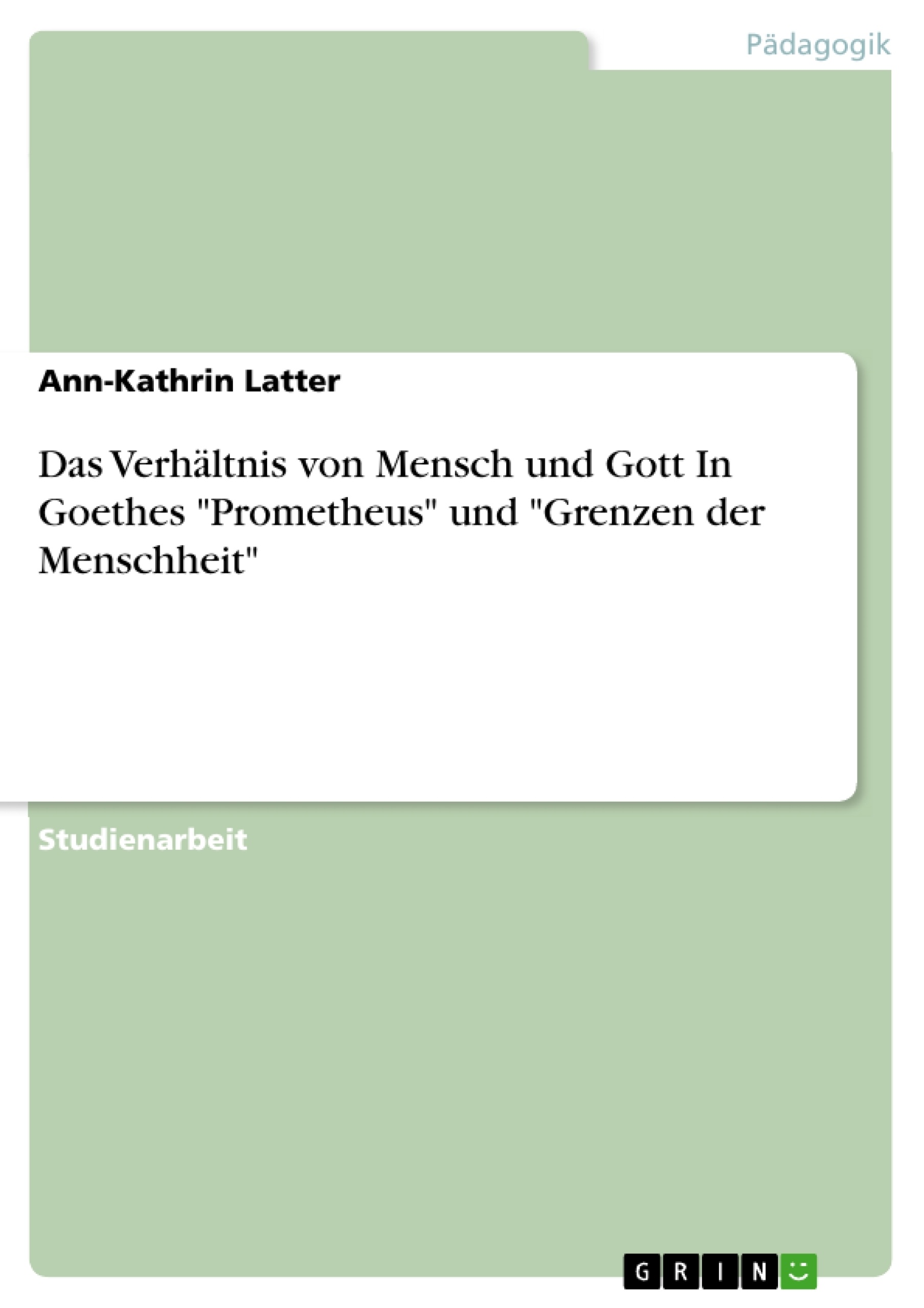Johann Wolfgang von Goethe ist in ein Jahrhundert hineingeboren worden, das zwar maßgeblich unter dem Einfluss von wissenschaftlichen und geistlichen Fortschritten in Medizin, Astronomie und Philosophie stand, aber gleichzeitig noch immer an den traditionellen gesellschaftlichen Strukturen als von Gott angeordnet verhaftet blieb. Zusammen mit einer Vielzahl von jungen Dichtern (wie Matthias Claudius, Johann Gottfried Herder und natürlich Friedrich Schiller), rebellierte Goethe im Zuge des parallel zur Aufklärung entstehenden Sturm und Drangs gegen die Beschränkungen der Vätergeneration und postulierte dabei die individuelle Freiheit als höchstes Ideal. Als Urbild des freien, aus seinen persönlichen Empfindungen heraus schaffenden Menschen gebraucht er die Figur des Prometheus, die fortan als Prototyp des sogenannten „Originalgenies“ gilt.
Mit dem Übergang zur Klassik wendet sich Goethe allerdings zunehmend von diesem bedingungslosen Emanzipationsgedanken ab und setzt in Abgrenzung zu seinen früheren Werken vermehrt auf Werte wie Humanität, Toleranzbereitschaft, maßvolles Empfinden, Harmoniestreben und Bodenständigkeit. Eines der Werke, die an der Schnittstelle zwischen Sturm und Drang einerseits und Weimarer Klassik andererseits steht, ist das Weltanschauungsgedicht Grenzen der Menschheit aus dem Jahr 1780 (Entstehungszeitpunkt), wo der Fokus vom individuellen Fühlen und Denken des Einzelnen zurück auf das Weltganze verlegt wird.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesen beiden unterschiedlichen Sichtweisen auf das Verhältnis von Mensch und Gott und versucht dabei einen Vergleich zwischen den in den Gedichten formulierten Weltbildern. In einem ersten Schritt wird sich die Arbeit also der Hymne Prometheus widmen und dort ins Besondere auf die Rolle des Prometheus sowie auf Stürmisch und Drängische Elemente achten. Im zweiten Teil folgt dann eine Analyse von Grenzen der Menschheit, bei der die veränderte klassische Geisteshaltung im Vordergrund stehen soll. Darauf aufbauend werden im dritten Teil dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gedichte diskutiert, ehe die Arbeit in einer letzten Zusammenfassung zu einem Fazit über das innere Verhältnis, das diese Gedichte zueinander haben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Prometheus
2.1 Eine verkehrte Hymne
2.2 Die Rolle des Prometheus
2.3 Stürmisch und Drängische Elemente
3. Grenzen der Menschheit
3.1 Das Verhältnis von Gott und Mensch
3.2 Das Weltbild
4. Vergleich
5. Zusammmenfassung
Literaturverzeichnis