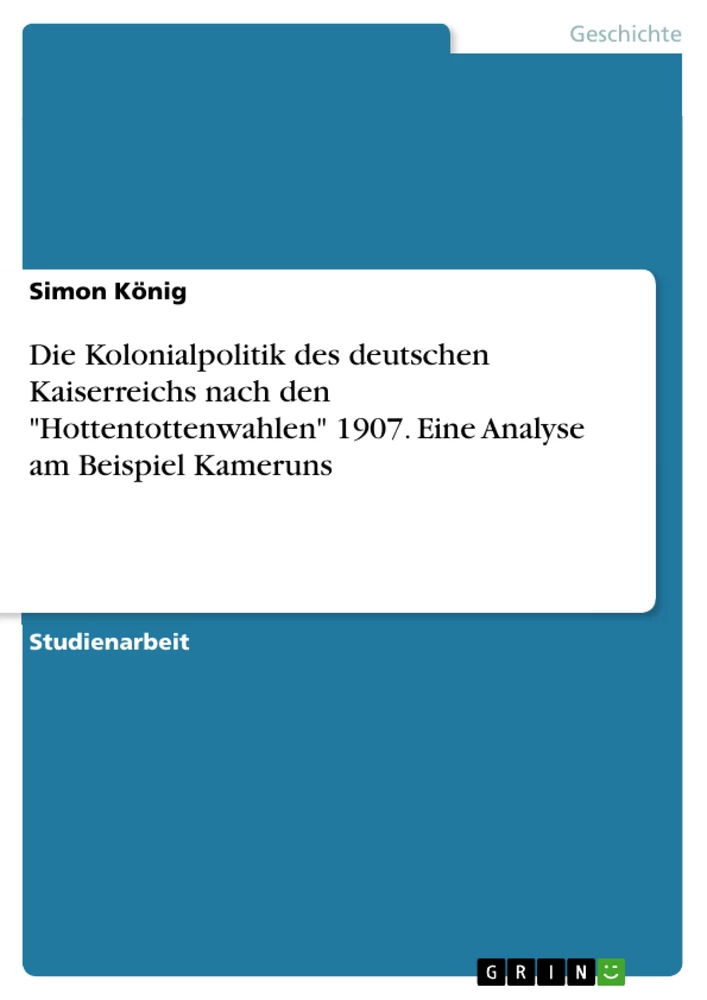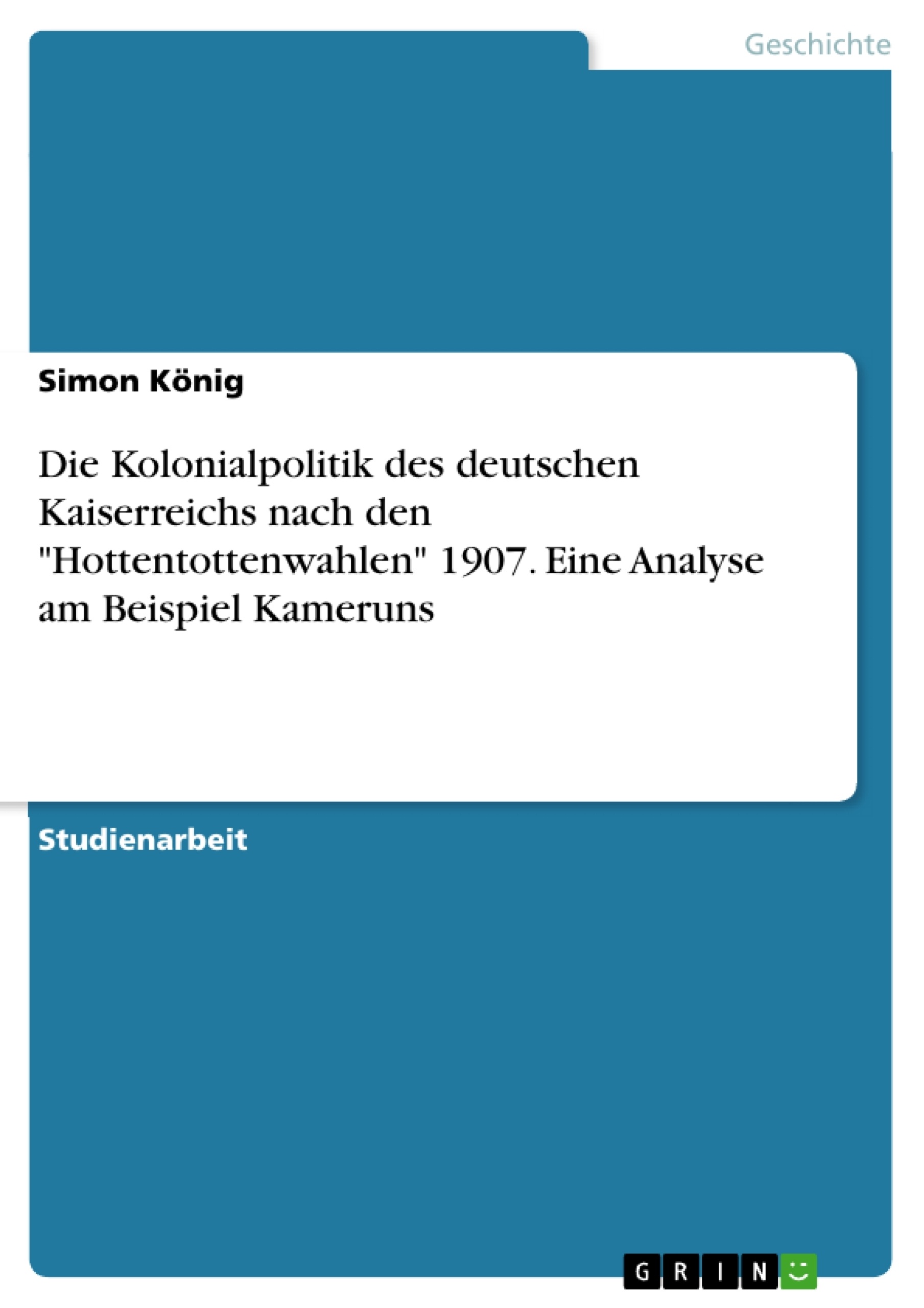Im Jahr 1907 nach dem niedergeschlagenen "Herero- und Hottentottenaufstand" löste Reichskanzler Bülow am 1. April 1907 den Reichstag als Folge der vorherigen Ereignissen auf. Genau an diesem historischen Ereignis soll die hier vorliegende Studienarbeit einsetzen und der Frage nach einem möglichen Politikwechsel nachgehen.
In der Internetenzyklopädie Wikipedia, welche von „Rund 72 Prozent der Internetnutzer ab 10 Jahren in Deutschland […]“ genutzt wird, wird von einer „neuen Kolonialpolitik“ ab 1907 gesprochen, welche sich durch einen humaneren Umgang mit den Einheimischen und höherer Wirtschaftlichkeit ausgezeichnet haben soll. Die Frage, ob es einen Politikwechsel nach der sogenannten „Hottentottenwahl“ wirklich gab und inwiefern sich dieses mögliche Ereignis darauf auswirkte, soll am Beispiel der Kolonie Kamerun beantwortet werden. Zusätzlich soll durch diese Untersuchung geprüft bzw. herausgearbeitet werden, ob der angesprochene Beitrag der Internetenzyklopädie gezielt ein „besseres“ Geschichtsbild des deutschen Kolonialismus erzeugt, welches höchstwahrscheinlich durch eine Vielzahl der Leser unreflektiert aufgenommen wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Vorgangsbeschreibung
2. Deutsche Kolonialpolitik
2.1 Beginn der "gesamtdeutschen" Kolonialpolitik
3. Kamerun
3. 1 Gründung des deutschen "Schutzgebiets" Kamerun
3.2 Etablierung und Durchsetzung der deutschen Herrschaft
3.3 Kamerun unter deutscher Verwaltung
3.3.1 Kamerun unter rechtlich Aspekten
3.3.2 Kamerun unter wirtschaftlichen Aspekten
3.3.3 Kamerun unter innenpolitischen Aspekten
4. Das Ende der deutschen Kolonialherrschaft เท Kamerun
5. Das Bild der "Schutzangehörigen" im "Mutterland"
6. Die Hottentottenwahl
6.1 Im Vorfeld der Wahl
6.2 Die Wahl
6.3 Auswirkungen auf Kamerun
7. Zusammenfassung und Schlusswort
8. Quellenverzeichnis
8.1 Literaturverzeichnis
8.2 Internetquellen
9. Anhang:
9.1 Karte von Kamerun