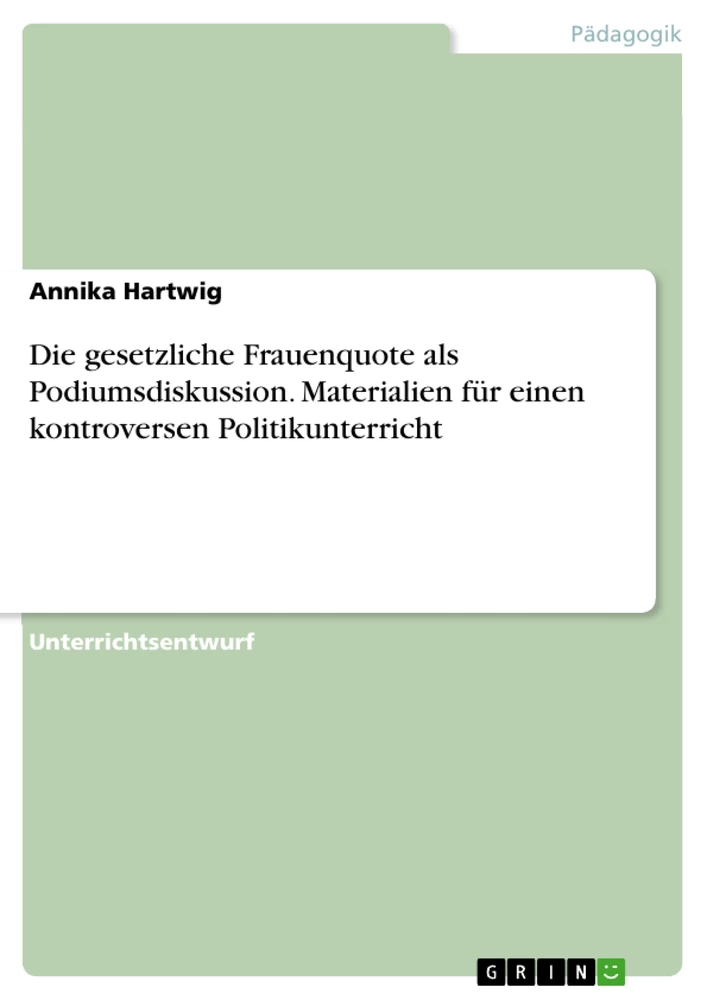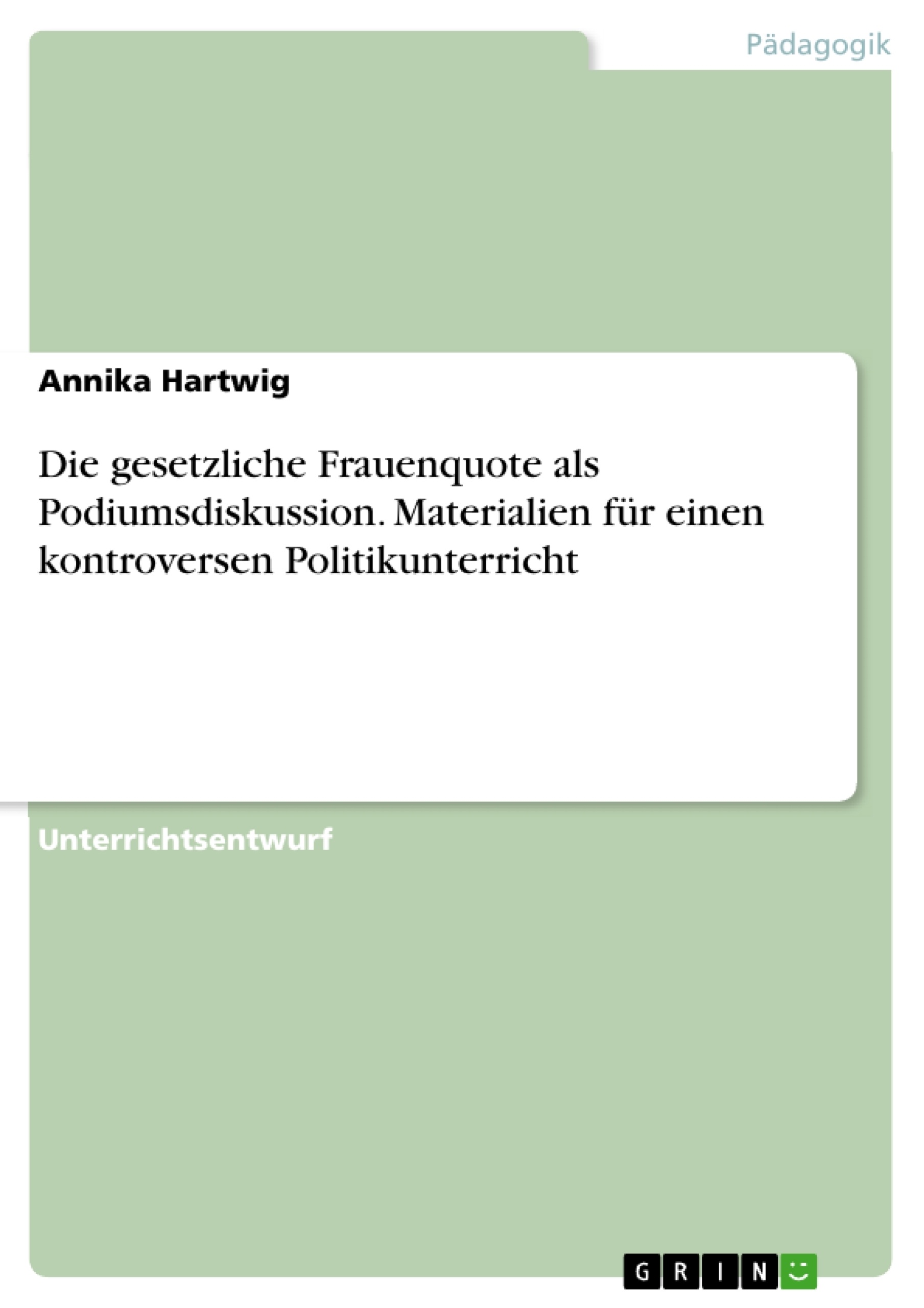Ein Beispiel für die bildungswirksame Gestaltung von Kontroversität im Politik-Wirtschaftsunterricht ist die Thematik um eine Frauenquote in deutschen Aufsichtsräten. Bereits seit der Jahrtausendwende zeigt sich anhand dieser Thematik, wie andauernd und aufwühlend eine Kontroverse in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit debattiert werden kann. Doch trotz jahrelangen Widerstandes großer Kreise aus Wirtschaft und Politik wurde das Gleichstellungsgesetz Ende 2014 beschlossen. Ab 2016 ist es voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Großunternehmen in Deutschland nun auferlegt, ihre Aufsichtsratspositionen bei Neuwahlen mit mindestens 30 Prozent weiblicher Kandidatinnen zu besetzen. Sollte ein Unternehmen keine geeignete Kandidatin aufweisen können, müssten solche Positionen unbesetzt bleiben, so die politische Sanktion. Doch auch wenn das Gleichstellungsgesetz längst beschlossen ist, die Thematik der Frauenquote bleibt aufgrund ihrer gesellschaftlichen Brisanz sowie anhaltender Fragestellungen für den Politik-Wirtschaftsunterricht relevant. Besagte Fragestellungen umfassen dabei sowohl ethische als auch wirtschaftliche sowie politische Argumentationen. Unterstützt wird diese Relevanz zudem durch analoge Vorgaben des entsprechenden Kerncurriculums: Laut diesem sollten Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II politische wie ökonomische Thematiken anhand von spezifische Kriterien (hinsichtlich Effizienz, Legitimität und Grundrechten) beurteilen. Eben diese Kriterien werden durch die unterschiedlichen Positionen des Materials bedient, welche eine Verzahnung von ethischen, politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Argumenten sowie dementsprechend eine kontroverse, wie auch mehrdimensionale Diskussion bedingt.
Inhaltsverzeichnis
1. Entscheidung für Thema und Methode
1.1 Begründung der inhaltlichen Thematik
1.2 Begründung der Methodenwahl
2. Entscheidung für Akteure und Positionen
3. Aufbereitung von Materialien für die Podiumsdiskussion in der Sek II
3.1 Basismaterial zur gesetzlichen Frauenquote in Deutschland
3.2 Darstellung der Diskussionssituation sowie Arbeitsaufträge für die Lernenden
4. Anmerkungen zur methodischen Umsetzung des Materials
Literaturverzeichnis