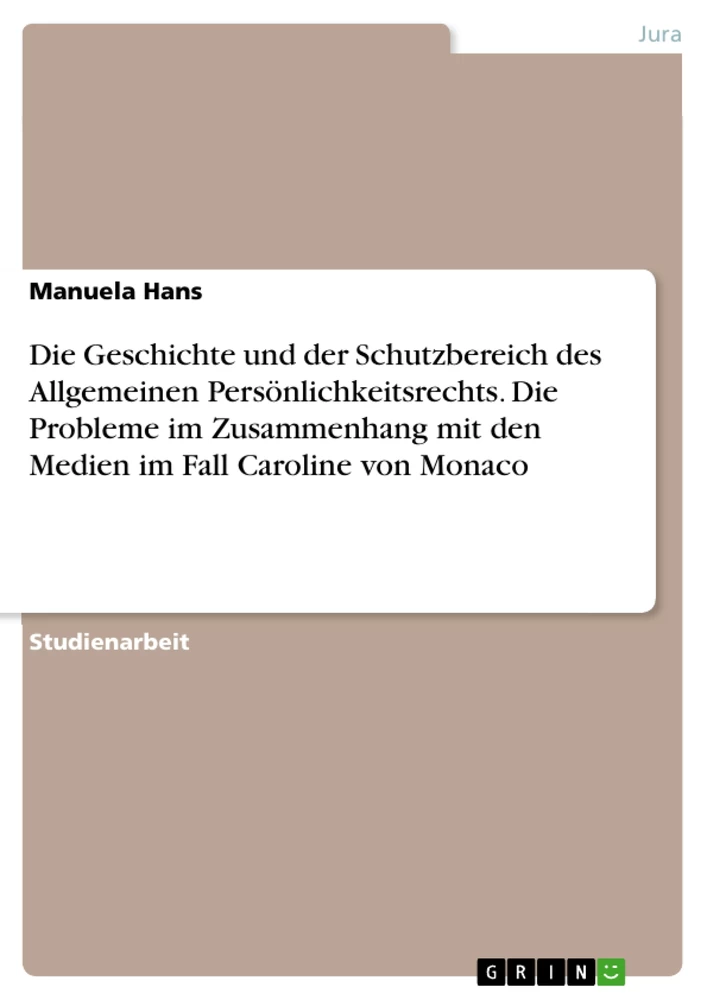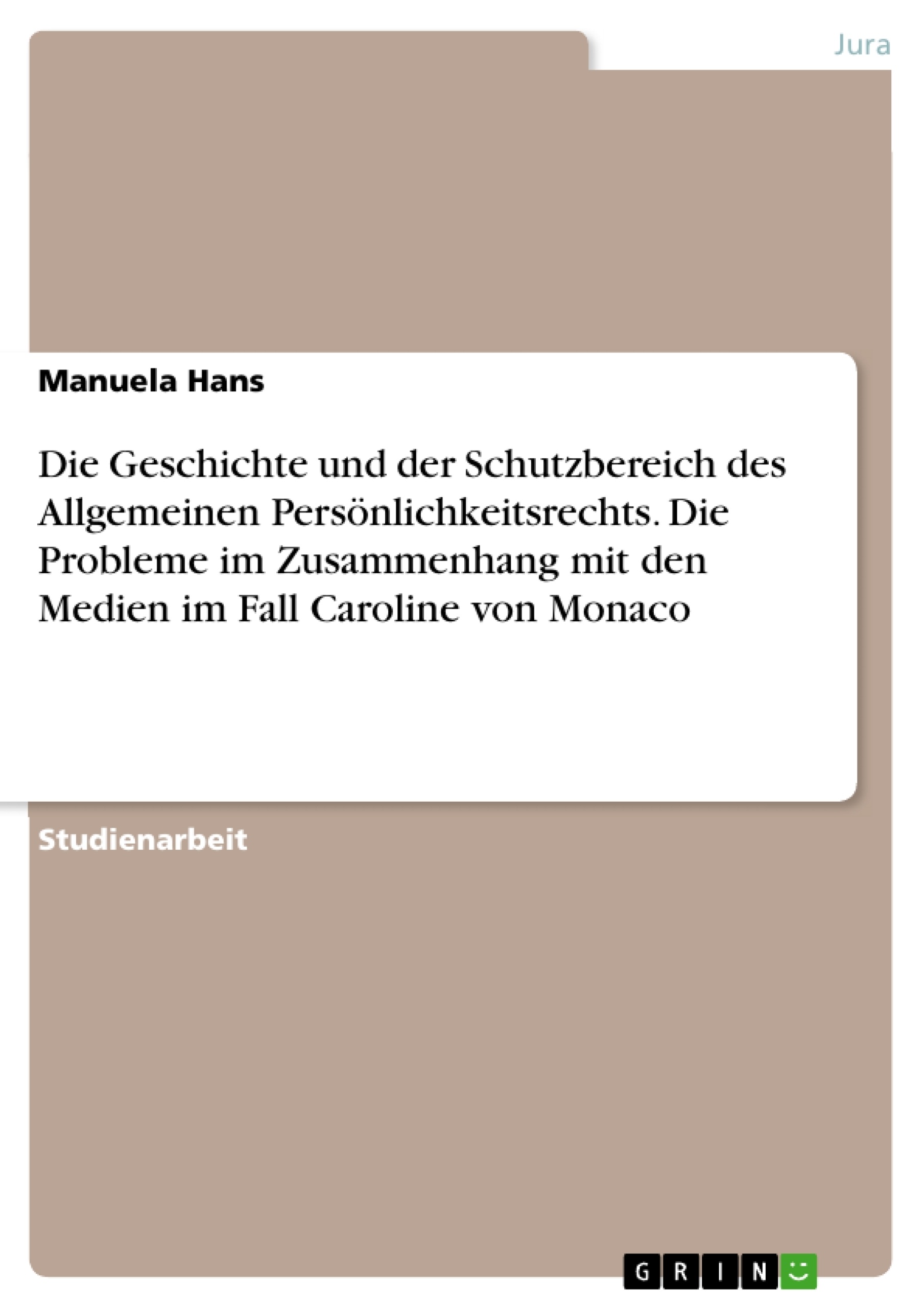In dieser Seminararbeit wird zum einen auf die Geschichte als auch die Entwicklung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts eingegangen. Dabei wird der Autor sich auf die wichtigsten Entwicklungsschritte beschränken, da die ausführliche Geschichte dieses Rechts den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. In einem zweiten Punkt wird kurz auf die Probleme eingegangen, welche die heutige Zeit mit sich bringt.
So stehen dem Schutzbereich des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts gewisse Schranken entgegen. Die Presse- und Meinungsfreiheit sowie die Kunstfreiheit und das Allgemeine Interesse vor allem an dem Leben wichtiger Persönlichkeiten führen zu Abwägungen zwischen den Grundrechten. Als Beispiel hierfür wird das Caroline-Urteil verwendet, welches für die Entwicklung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Zusammenhang mit der Presse- und Meinungsfreiheit wichtig ist.
Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ein Grundrecht, das die Persönlichkeit eines jeden Menschen vor den Eingriffen anderer in seinen Lebensbereich schützt. Dabei ist das Allgemeine Persönlichkeitsrecht als solches nicht im Gesetz geregelt. Es leitet sich aus dem Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Art. 2 Abs. 1 GG ab. Diesen umfassenden Schutz gibt es jedoch erst seit ungefähr sechzig Jahren.Die Entwicklung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts geht jedoch zurück bis in das Römische Reich. Schon damals versuchte man ein Recht zu finden, das Eingriffe in den menschlichen Lebensbereich verbietet. Jedoch wurden zunächst nur einzelne besondere Persönlichkeitsrechte in den Gesetzen geregelt und bis heute ist das Allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht vollständig ausgefertigt. Grund hierfür ist die stetige Entwicklung der Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Entwicklung neuer Medien macht einen Eingriff in den Lebensbereich eines Menschen immer leichter und genau dem muss weiterhin entgegengewirkt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht
3. Schutzbereich des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts
3.1. Sozialsphäre
3.2. Privatsphäre
3.3. Intimsphäre
3.4. Die besonderen Persönlichkeitsrechte
3.4.1. Recht am eigenen Bild
3.4.2. Recht am eigenen Wort
3.4.3. Recht der persönlichen Ehre
3.4.4. Recht auf informationelle und mediale Selbstbestimmung
3.4.5. Recht auf Resozialisierung
4. Ursprung und Geschichte
4.1. Römisches Recht
4.1.1. Das Persönlichkeitsrecht bei Donellus
4.2. Das Allgemeine Preußische Landrecht
4.3. Immanuel Kant und der Persönlichkeitsbegriff
4.4. Otto von Gierke und das Allgemeine Recht der Persönlichkeit
4.5. „Leserbrief“-Entscheidung
4.5. „Herrenreiter“-Entscheidung
4.6. „Mephisto“-Entscheidung
4.7. Schutz vor Kommerzialisierung
4.8. „Marlene Dietrich“-Entscheidung
5. Probleme im Zusammenhang mit den Medien
5.1. Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit
5.2. Kunstfreiheit
5.3. Neue Medien
6. Der Fall Caroline von Monaco
7. Resümee
8. Literaturverzeichnis