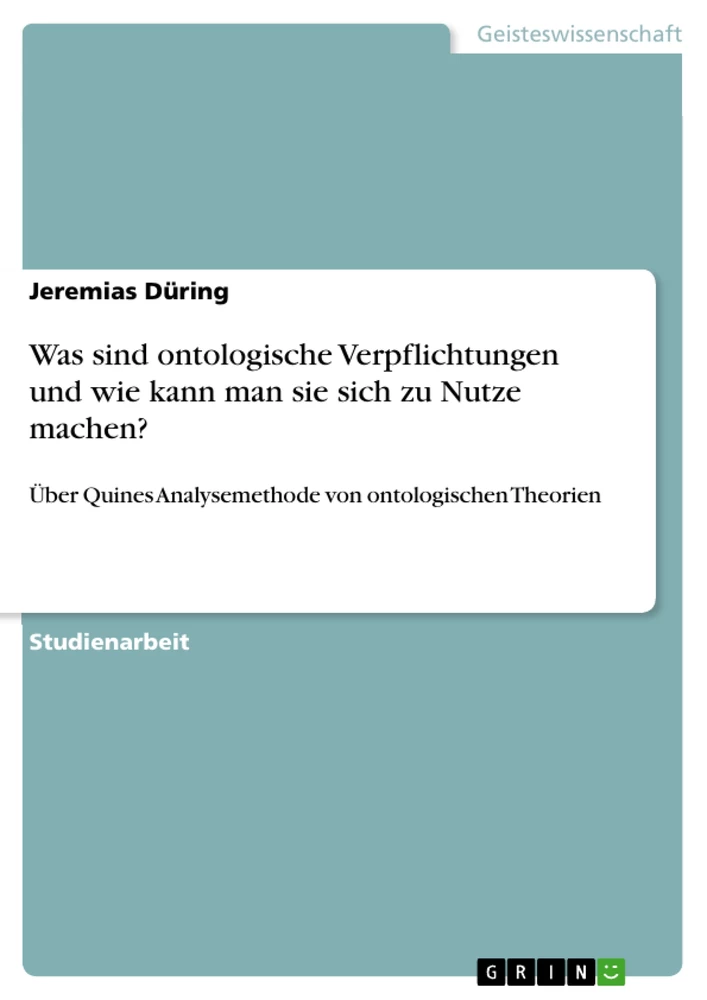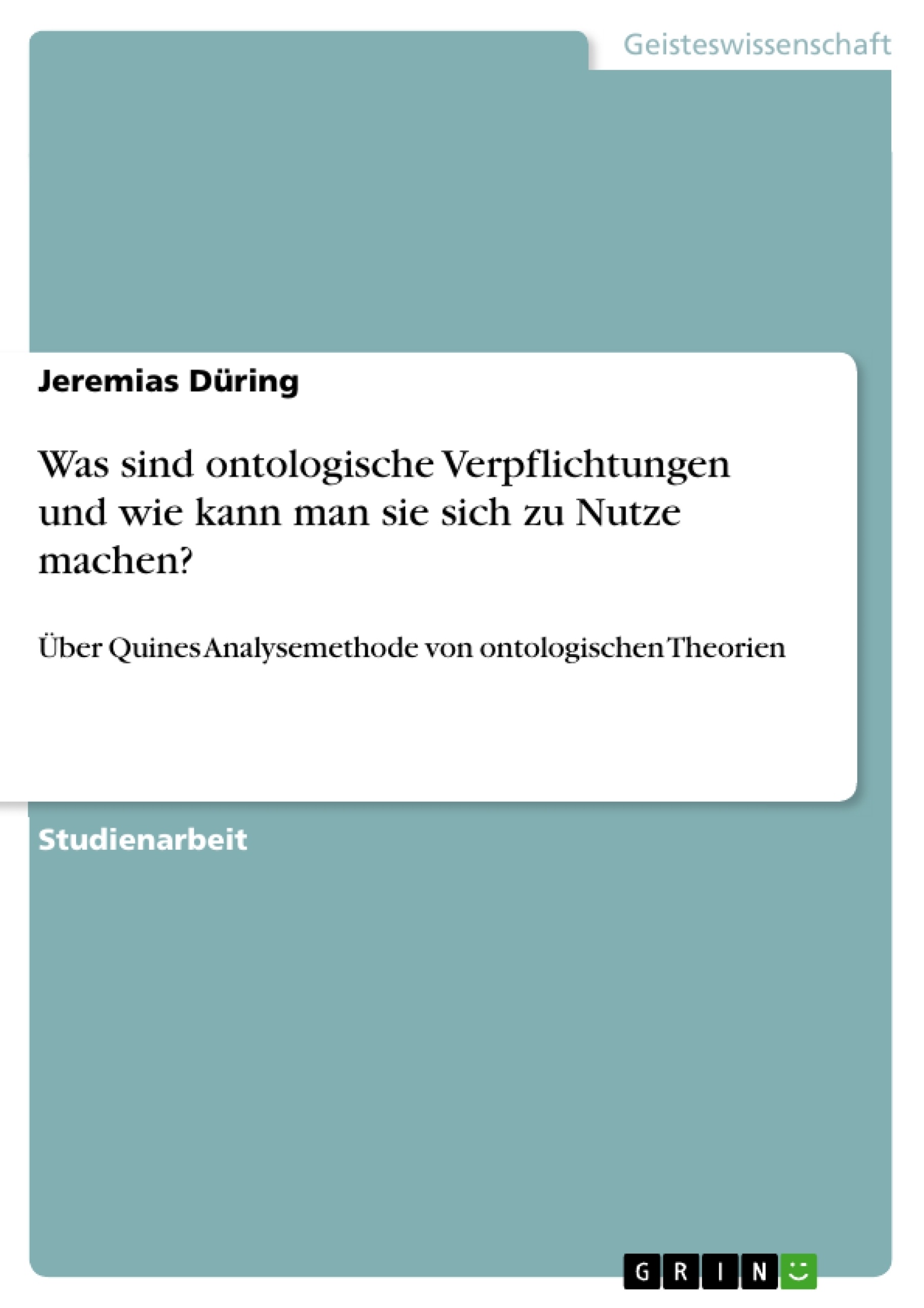Diese Arbeit soll zum Einen aufzeigen, wie Quine den Begriff der ontologischen Verpflichtung erklärt. Um diesen Zusammenhang verständlich zu machen, werde ich im folgenden Kapitel den Argumentationsgang im Bezug auf die negativen Existenzaussagen rekonstruieren. Danach werde ich mich dem zweiten Teil meiner Fragestellung zuwenden. Anhand eines Beispiels aus der sogenannten Universaliendebatte werde ich zeigen, wie sich die logische Analyse der ontologischen Verpflichtungen als philosophisches Entscheidungswerkzeug nutzen lässt. Abschließend werde ich mich mit einigen Schwierigkeiten befassen und bewerten, inwieweit sich Quines Methode als Entscheidungshilfe eignet.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stürzte die Ontologie durch die Schriften der Logischen Empiristen in eine schwere Krise. Ihnen zufolge seien ontologische Fragen empirisch unlösbar und damit belanglos. Dieser vernichtenden Behauptung zum Trotz entwickelte der amerikanische Philosoph Willard Van Orman Quine in seinem Aufsatz "On What There Is" von 1948 ein neues Verständnis von Ontologie. Diese soll nun nicht mehr die Welt, sondern vielmehr unsere Theorien über die Welt zum Gegenstand haben.
Als Ausgangspunkt für seine Argumentation dient Quine die vermeintlich einfache Frage: Was gibt es? Die zunächst naheliegende Antwort sei sogar noch kürzer als die Frage selbst: Es gibt Alles. Wer dies sagt, äußert im Grunde nur eine Tautologie. Er sagt nichts anderes, als dass es die Dinge gibt, die es gibt. Deshalb ist eine genauere Untersuchung des Problems dringend erforderlich. Zahlreiche Einzelfälle, bei denen man sich auch nach Jahrhunderten des philosophischen Disputes nicht einig wird, behindern eine zufriedenstellende Beantwortung der Ausgangsfrage. Einer dieser Einzelfälle ist das Problem der negativen Existenzaussagen. Durch eine ausführliche Erörterung dieses Problems leistet Quine die Vorarbeit, um auf den für sein Ontologieverständnis entscheidenden Begriff der ontologischen Verpflichtung zu stoßen. Als zweiten Schritt entwirft er eine Methode zur logischen Analyse jener Verpflichtungen, die ein probates Mittel sei, um zwischen Theorien über die Welt abwägen zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Problem: Platons Bart
2.1 Widerlegung des Platonischen und Meinongschen Ansatzes
2.2 Quines Lösung
3. Die ontologische Verpflichtung
4. Anwendungsbeispiel: Universalienstreit
5. Bewertung der Quineschen Methode
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
8. Anhang