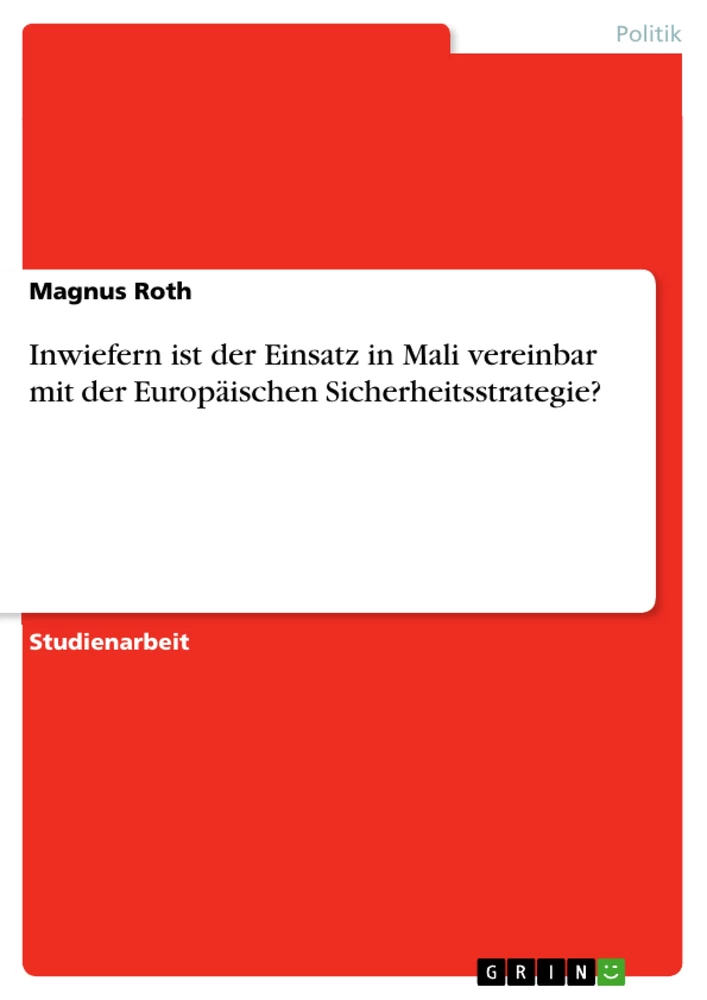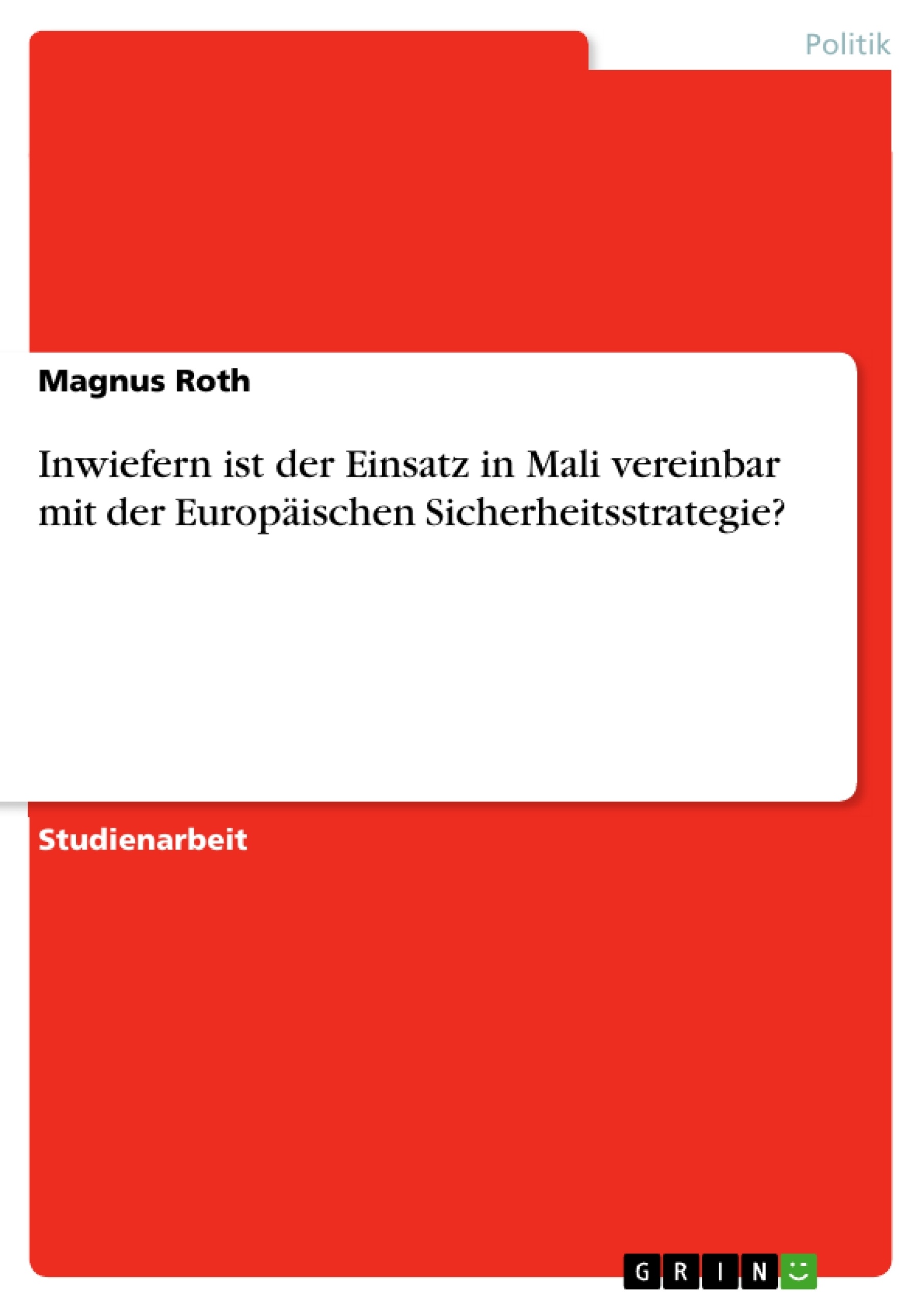Die Europäische Sicherheitsstrategie feierte im Jahr 2013 ihr zehnjähriges Bestehen. Von einem kohärenten außenpolitischen Auftreten der Europäischen Union (EU) kann man immer noch nicht reden. Die EU tritt in der Öffentlichkeit nicht einheitlich in Erscheinung. Die Europäische Sicherheitsstrategie wurde als erstes gemeinsames außenpolitisches Konzept der EU Leitlinien für die Außenpolitik definiert. Die Republik Mali, die seit Anfang 2012 aufgrund des Aufstandes der Tuareg im Fokus der europäischen Öffentlichkeit steht, wird als Beispiel für ein einheitliches Handeln der EU herangezogen. Mittlerweile sind tausende europäische Truppen im Land stationiert. Dabei stellt sich die Frage: Inwiefern ist der Einsatz in Mali vereinbar ist mit der Europäischen Sicherheitsstrategie?
Daraus lässt sich folgende Hypothese aufstellen: „Die Ziele der Europäische Sicherheitsstrategie entsprechen nicht den Zielen, die im Einsatz in Mali verfolgt werden“. Die Überprüfung dieser Hypothese wird im nachfolgenden vorgenommen. Dafür wird zunächst die Weltordnung, in der die Europäische Union (EU) agiert und reagiert dargestellt. Anschließend wird Kontext in der die Europäische Sicherheitsstrategie aufgestellt wurde zu zeigen. Darauffolgend werden die Europäische Sicherheitsstrategie von 2003 und der Bericht über die Umsetzung der Sicherheitsstrategie von 2008 verkürzt auf die zentralen Thesen dargestellt. Im Anschluss gibt es eine kurze Einführung in den Mali-Konflikt, deren Konfliktparteien, sowie deren Relevanz für Europa. Nachfolgend werden Übereinstimmungen oder Abweichungen der Europäischen Sicherheitsstrategie mit dem Mali-Konflikt untersucht.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die EU in der Welt nach dem Kalten Krieg
3. Die Europäische Sicherheitsstrategie
3.1 Definition Strategie
3.2 Inhalt der Europäischen Sicherheitsstrategie
3.3 Der Bericht über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie
4. Mali-Krise seit Frühjahr
4.1 Allgemeine Daten zur Republik Mali
4.2 Bestandsaufnahme des aktuellen Konflikts in Mali
4.3 Auswirkungen des Konflikts in Mali
5. Schlussfolgerungen und Ausblick
6. Anhang