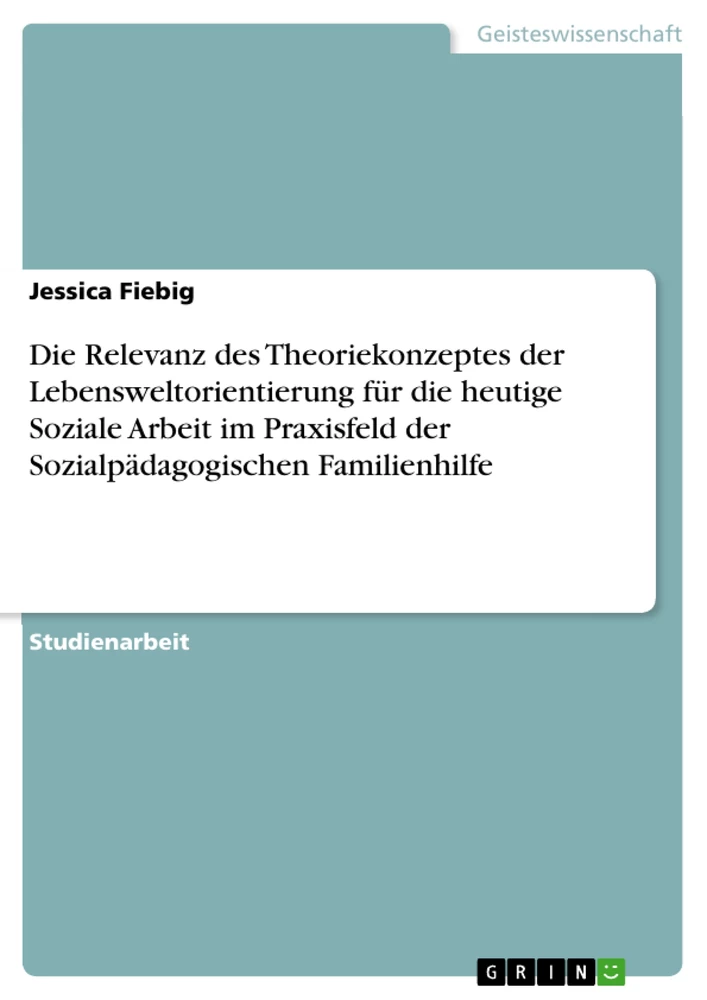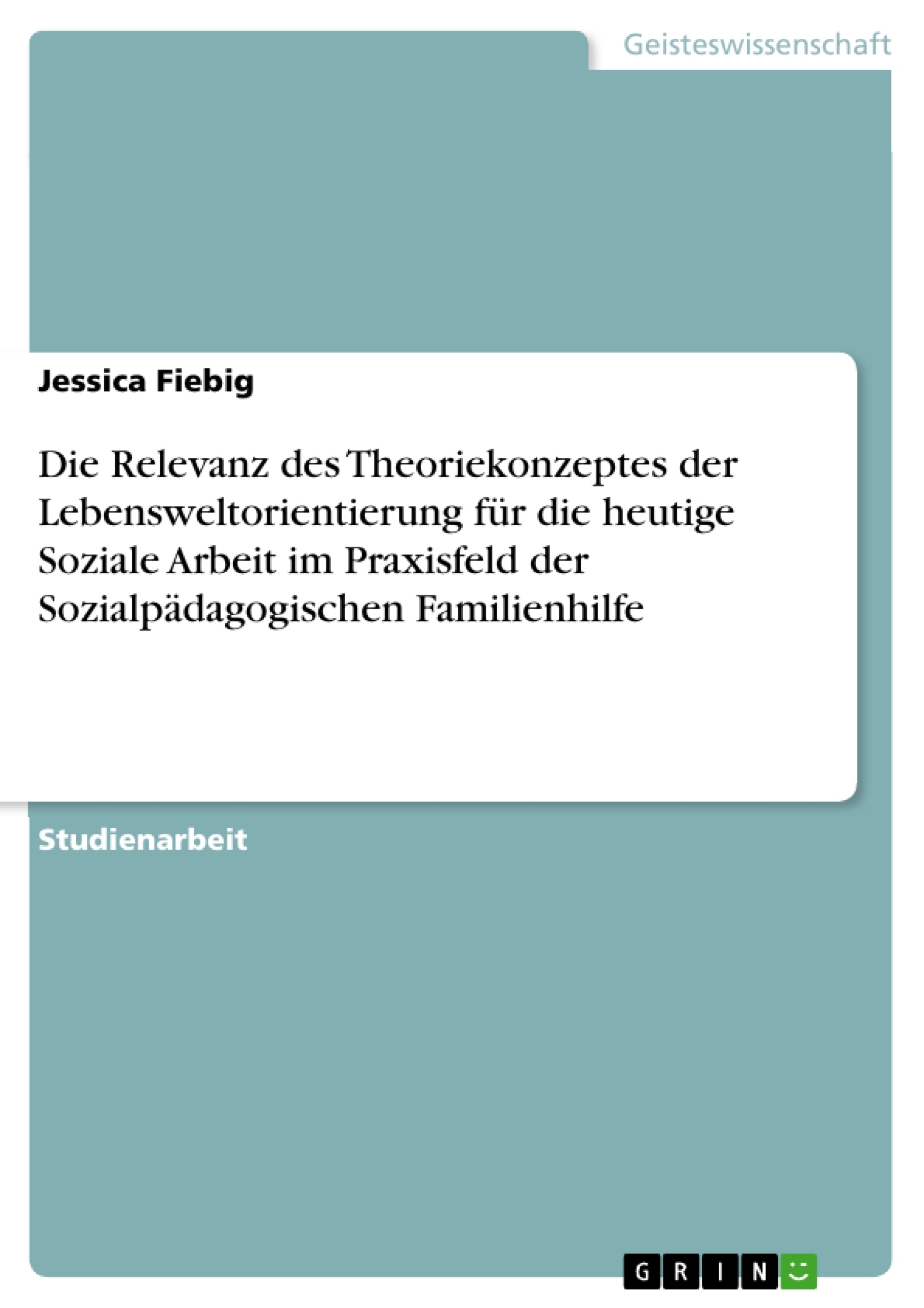Es ist das Ziel dieser Arbeit, auf der Basis der theoretischen Grundlegung der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Thiersch eine Verknüpfung mit dem Praxisfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe vorzunehmen. Es soll auf dem Hintergrund der besonderen Herausforderungen in diesem Praxisfeld die Bedeutung des Theoriekonzeptes konkretisiert und für die sozialpädagogische Praxis in der Sozialpädagogischen Familienhilfe herausgestellt werden. Dabei werden die für die Praxis der Sozialpädagogischen Familienhilfe relevanten Prinzipien der Alltagsorientierung, Partizipation und Selbsthilfeorientierung, sowie der Vernetzung und Ganzheitlichkeit exemplarisch dargestellt. Zudem wird das spannungsreiche Verhältnis von Kontrolle und Hilfe auf dem Hintergrund einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit behandelt.
Es werden daher zunächst allgemeine theoretische Grundlagen des Theoriekonzeptes der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Thiersch in ihren historischen und theoretischen Bezügen sowie im Kontext aktueller gesellschaftlicher Veränderungen dargestellt. Im Folgenden wird sich auf die besonderen Aufgaben und Herausforderungen der AdressatInnen der Sozialpädagogischen Familienhilfe bezogen, sowie dem Auftrag und den Aufgaben Sozialer Arbeit in diesem speziellen Praxisfeld. Daraufhin wird der Lebensweltorientierte Ansatz für die Soziale Arbeit durch die Anwendung auf das Praxisfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe konkretisiert. Dabei werden die Möglichkeiten des Ansatz für eine zeitgemäße Soziale Arbeit in diesem komplexen und herausfordernden Praxisfeld herausgearbeitet. Den Abschluss bildet eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Umsetzung einer fachlichen und professionellen Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit in der heutigen Sozialpädagogischen Familienhilfe.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung...1
1. Das Theoriekonzept der Lebensweltorierten Sozialen Arbeit nach Thiersch....2
1.1 Die Theorie der Lebensweltorientierung... 2
1.2 Gegenstand und Funktion einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen...3
1.3 Entwicklung des Theoriekonzeptes der Lebensweltorientierung unter dem Aspekt historischer und theoretischer Bezüge...5
2. Soziale Arbeit mit Familien im Praxisfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe...7
2.1 Soziale Arbeit mit Familien im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen...7
2.2 Bewältigungsaufgaben und soziale Risiken von AdressatInnen der Sozialpädagogischen Familienhilfe...8
2.3 Auftrag und Aufgaben der Sozialpädagogischen Familienhilfe....9
3. Die Bedeutung einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit für das heutige Praxisfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe....10
3.1 Handlungsmaxime einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit für das Praxisfeld der Sozialpädagogischen Familienhilfe...10
3.1.1 Alltagsnähe und Lebensweltorientierung als Bezugspunkt des professionellen Handelns... 10
3.1.2 Vernetzung, Kooperation und Ganzheitlichkeit... 12
3.1.3 Kontrolle und Hilfe im Kontext der Lebensweltorientierung...13
3.1.4 Partizipation und Selbsthilfeorientierung... 14
3.2 Kritische Bilanz... 15
Schluss... 16
Literaturverzeichnis... 18