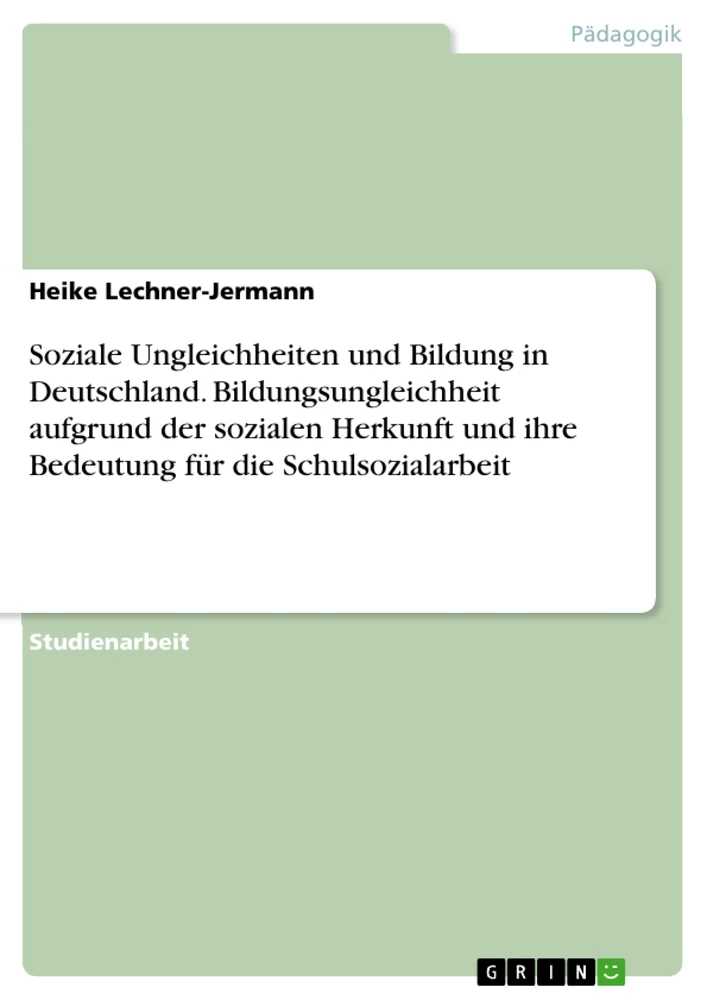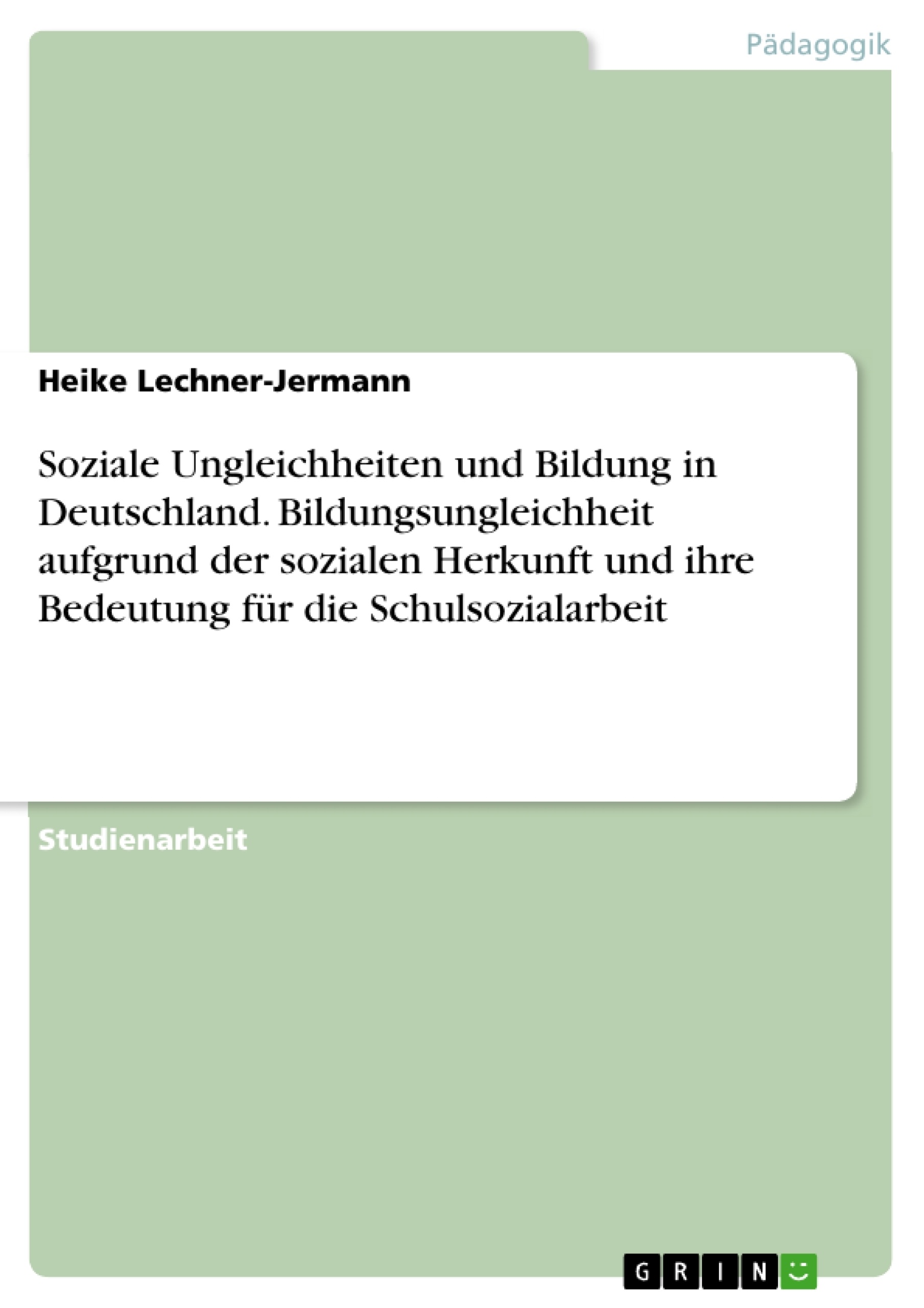Bildung ist eine der wichtigsten sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts und nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Sie ist Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und setzt die Weichenstellung für fast alle anderen Bereiche wie Arbeit, Einkommen Wohnen, Sozialstatus, politische Partizipation und private Lebensqualität der einzelnen Gesellschaftsmitglieder. Das Recht auf Bildung ist daher nicht nur ein autonomes Menschenrecht, sondern auch ein Instrument, um anderen Menschenrechten zu deren Einfluss zu verhelfen. Im Bereich Bildung zeigt sich soziale Gerechtigkeit folglich darin, dass Bildung in einer Gesellschaft für alle Menschen frei von Diskriminierung garantiert wird und Armut, Geschlecht, Migrationshintergrund und soziale Herkunft keine Rolle beim Zugang zu Bildung spielen dürfen. Dieses Ziel hat Deutschland aber noch nicht erreicht.
Das Bildungssystem in Deutschland weist, das zeigen mehrere Studien auf, in Bezug auf Bildungsgerechtigkeit größere Mängel auf. Hier wird ersichtlich, dass ein großer Zusammenhang zwischen Leistungskompetenz und sozialer Herkunft besteht und Deutschland noch weit davon entfernt ist, sich mit Chancengleichheit in Bezug auf Bildung zu rühmen, obwohl soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit Werte sind, die in Deutschland durchaus von Bedeutung sein sollten.
Doch welche Ungerechtigkeiten bestehen im Hinblick auf soziale Herkunft tatsächlich im deutschen Schulsystem und wie kann Soziale Arbeit, bzw. hier konkreter Schulsozialarbeit, dies versuchen auszugleichen? Diese Arbeit befasst sich mit dieser Problematik. Dazu werden zunächst einige relevante Begriffe definiert, um darauffolgend die bestehenden Ursachen sozialer Bildungsungleichheiten aufzuzeigen. Die theoretischen Ansätze zur Erklärung der herkunftsspezifischen Ungleichheiten werden anhand der Ansätze von Pierre Bourdieu und Raymond Boudon dargestellt, um die bereits erläuterten Aussagen zu den Ursachen der Bildungsbenachteiligung zu erklären. Darauffolgend geht es dann um die Folgerungen der Schulsozialarbeit auf die vorhergehenden Erkenntnisse und was Schulsozialarbeit zur Minderung der herkunftsspezifischen Benachteiligung im Bereich Bildung tun kann.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung... 1
2. Begriffserklärungen... 2
2.1 Soziale Ungleichheit... 2
2.2. Bildungsungleichheit... 3
2.3. Soziale Herkunft... 3
3. Ursachen der Bildungsbenachteiligung... 4
3.1 Die Bildungsexpansion... 4
3.2. Institutionelle Bildungsungleichheit... 6
4. Erklärungsmodelle der Bildungsungleichheiten... 7
4.1 Die Reproduktion ungleicher Bildungschancen nach Bourdieu... 7
4.2 Primäre und sekundäre Herkunftseffekte nach Boudon Abbildung?... 10
4.2.1 primäre Herkunftseffekte... 10
4.2.2 sekundäre Herkunftseffekte... 11
5. Folgerungen für die Schulsozialarbeit... 13
5.1 Übergang Grundschule an die weiterführenden Schulen (2.Schwelle)... 13
5.2 Übergang in Ausbildung oder Studium (3. Schwelle)... 14
5.3. Schulsozialarbeit an Gymnasien... 14
5.4. Unterstützung in der Schulentwicklung... 15
6. Fazit... 16
Literatur- und Quellenverzeichnis:... 18
Abbildungsverzeichnis... 21