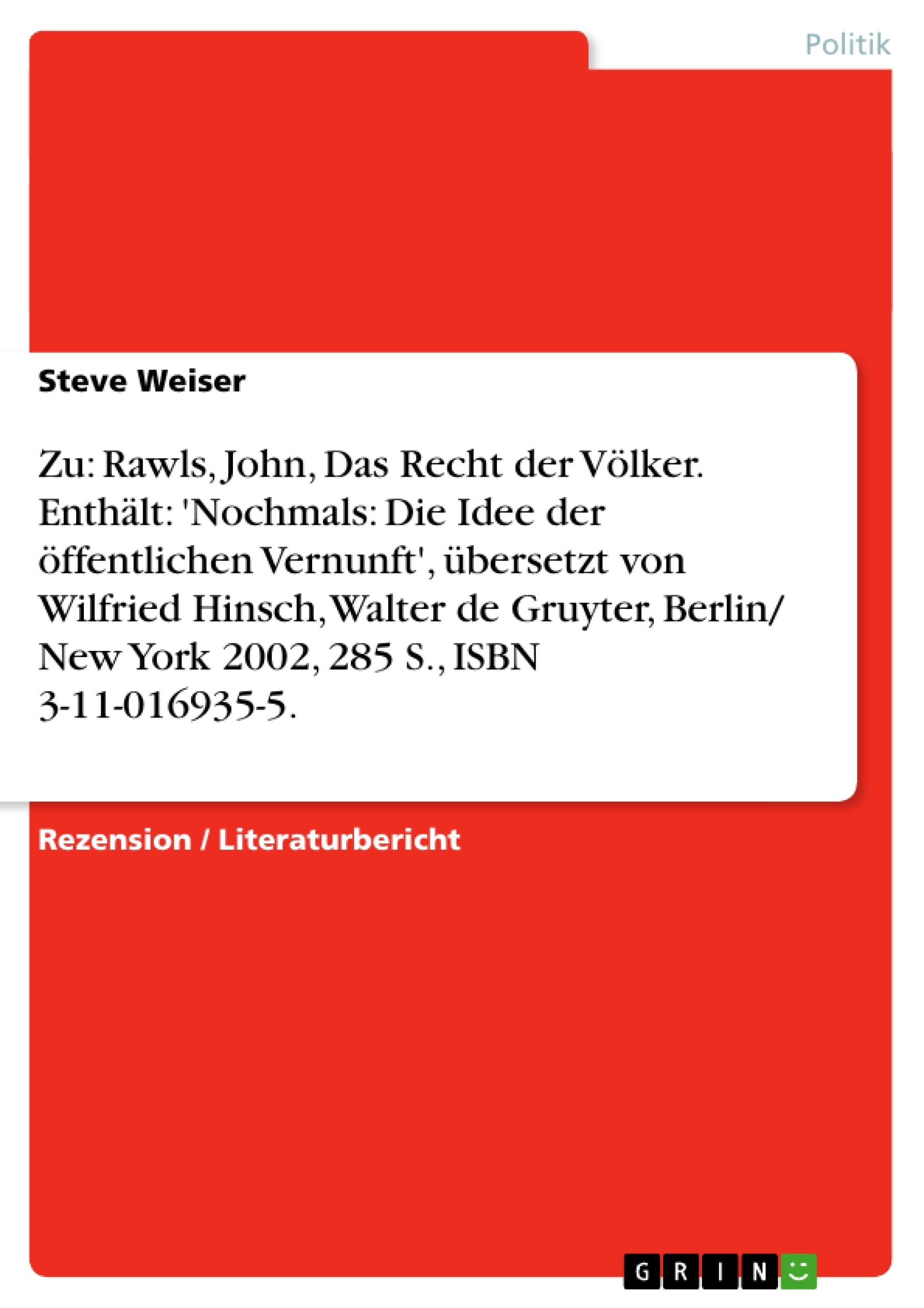John Borden Rawls (geb. 1921, gest. 2002) war einer der bekanntesten politischen Philosophen und der Vertragstheoretiker unserer Zeit. Während seiner fast vierzigjährigen Tätigkeit als Professor für politische Philosophie an der Harvard University, veröffentlichte er 1971 sein wohl berühmtestes Werk „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ („A Theory of Justice“) und wurde somit zum Begründer des egalitären Liberalismus. Sein letztes Werk „Das Recht der Völker“ („The Law of Peoples“, 1999) ist die konsequente Weiterentwicklung des schon in „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ begonnenen Ansatzes einer Ausweitung seiner liberalen Gerechtigkeitskonzeption von nationaler Ebene auf die multilaterale Ebene. Rawls setzt dabei sein Modell eines gerechten Gesellschaftsvertrages ein, um eine friedliche und gerecht Weltordnung - das Recht der Völker - zu entwickeln und so den großen Übeln der Menschheit (Krieg, Unterdrückung und Ungerechtigkeit) zu begegnen.
Die Konzeption ist hierbei allgemeiner und wird auf fünf Gesellschaftstypen angewandt, welche sich in einem hypothetischen Urzustand und hinter dem Wissen einschränkenden „Schleier des Nichtwissens“ befinden. Erstens „vernünftige liberale [und demokratische] Gesellschaften“, die im ersten Teil „der Idealtheorie“ - behandelt werden. Im zweiten Teil der Idealtheorie werden die „achtbaren [hierarchischen] Völker“ näher behandelt, die sich durch Konsultationshierarchien auszeichnen, aber nicht liberal sind. Zusammen werden diese Typen als „wohlgeordnete Völker“ bezeichnet. Drittens gibt es „Schurkenstaaten“, viertens „durch ungünstige Umstände belastete Gesellschaften“ mit denen sich im dritten Teil, der nichtidealen Theorie, auseinandergesetzt wird. Und letztlich „wohlwollende absolutistische Gesellschaften“, die Menschenrecht achten, aber nicht wohlgeordnet sind, weil sie ihren Bürgern politische Partizipation verweigern.
Das Konzept von Gerichtigkeit auf multilateraler Ebene. John Rawls "Das Recht der Völker"
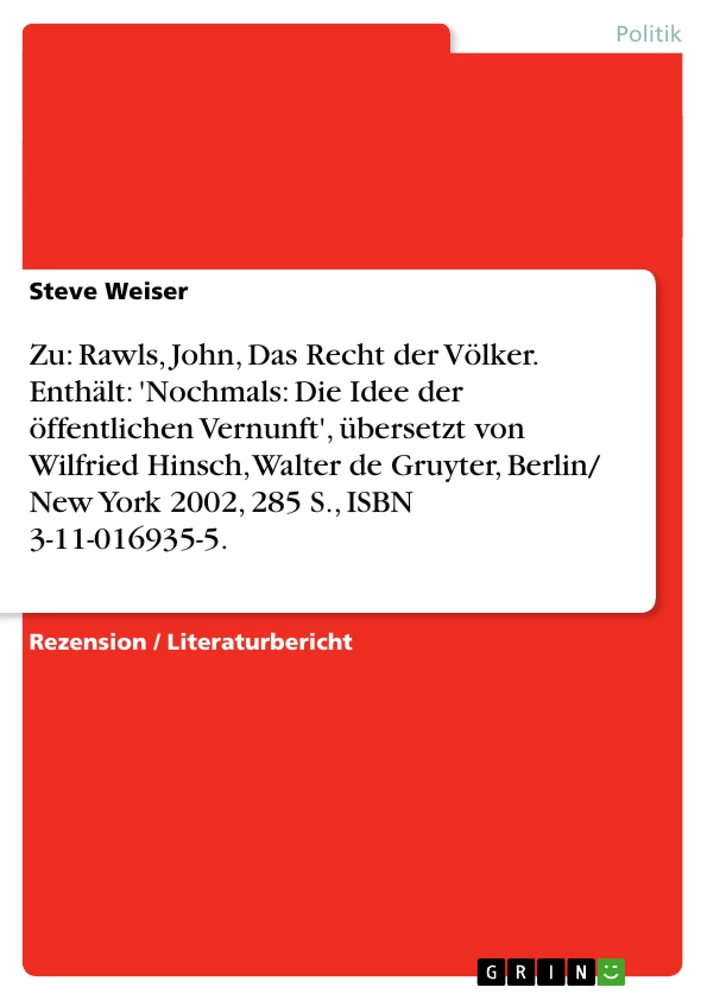
Rezension / Literaturbericht , 2005 , 7 Seiten , Note: 2
Autor:in: Steve Weiser (Autor:in)
Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte
Leseprobe & Details Blick ins Buch