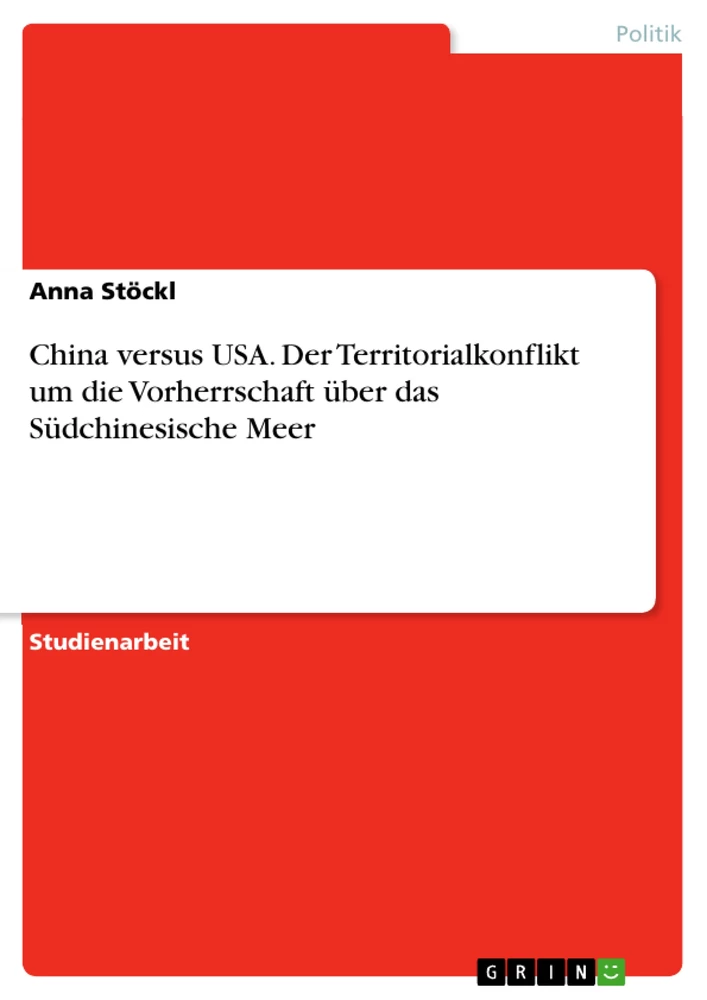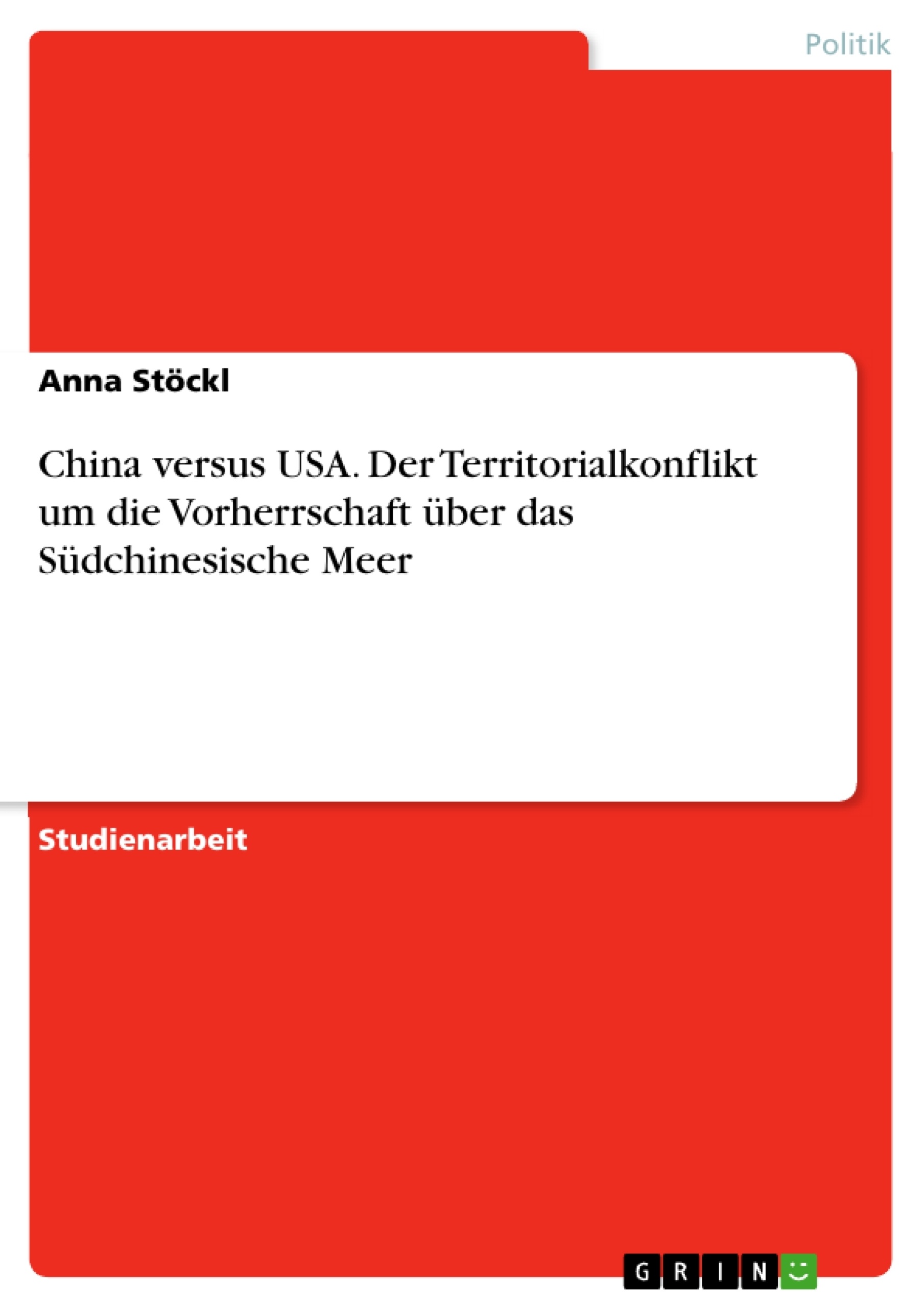Was mit kleineren Territorialstreitigkeiten um die Ansprüche im Südchinesischen Meer begann, entwickelte sich in dem letzten Jahrzehnt zu einem globalen Kampf um die Vorherrschaft. Vor allem seit der militärischen Präsenz durch die Schutzmacht USA ist dem aufstrebenden China ein mächtiger Gegner entgegengestellt. Genau dieses Machtverhältnis nimmt sich die Hausarbeit zum Thema: China versus USA: Der Territorialkonflikt um die Vorherrschaft über das Südchinesische Meer.
Die Frage, die sich seit einiger Zeit in Friedensverhandlungen stellt und auf die sich die Arbeit bezieht lautet: Warum finden die Akteure im Konflikt um das Südchinesische Meer keine Einigung? Der theoretische Hintergrund, der zu Hilfe gezogen wird, ist die neorealistische Theorie von Kenneth N. Waltz. – Erweiterungen der Theorie durch Theoretiker wie Josep M. Grieco, Stephen Walt, John Mearsheimer oder auch Robert Gilpin werden hier ausgeblendet. Zu Beginn wird der Neorealismus deskriptiv erläutert, im Anschluss daran der Konfliktverlauf und die beteiligten Akteure skizziert, um im analytischen Teil folgende These zu untersuchen: Aus Sicht des Neorealismus kommt der Konflikt aufgrund von Machtstreben zu keiner Lösung. Da der Territorialstreit sehr komplex ist, liegt der Fokus auf den wichtigsten Geschehnissen seit dem Jahr 2012 bis heute, historische Ereignisse und weitere Akteure werden lediglich zum allgemeinen Verständnis erläutert.
INHALT
1. Einleitung
2. Theorie Neorealismus
3. Sudchinesisches Meer
3.1. Konfliktverlauf und Akteure
3.2. Aktuelle Situation
3.3. Konflikt aus neorealistischer Sicht
3.4. Auswertung
4. Fazit
5. Abbildungsverzeichnis
6. Literaturverzeichnis