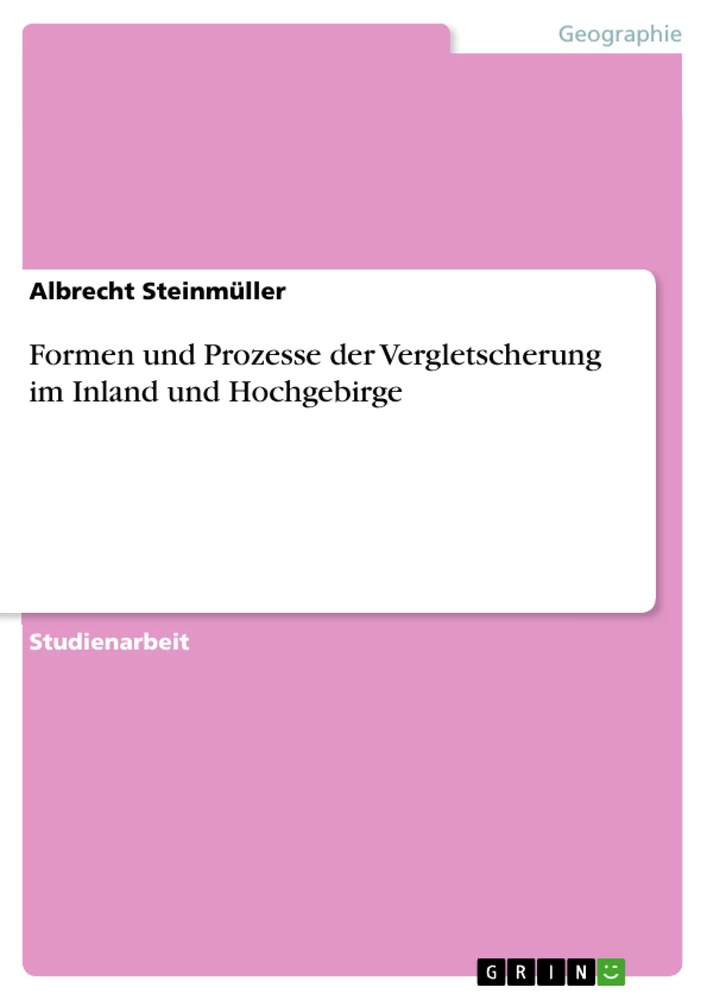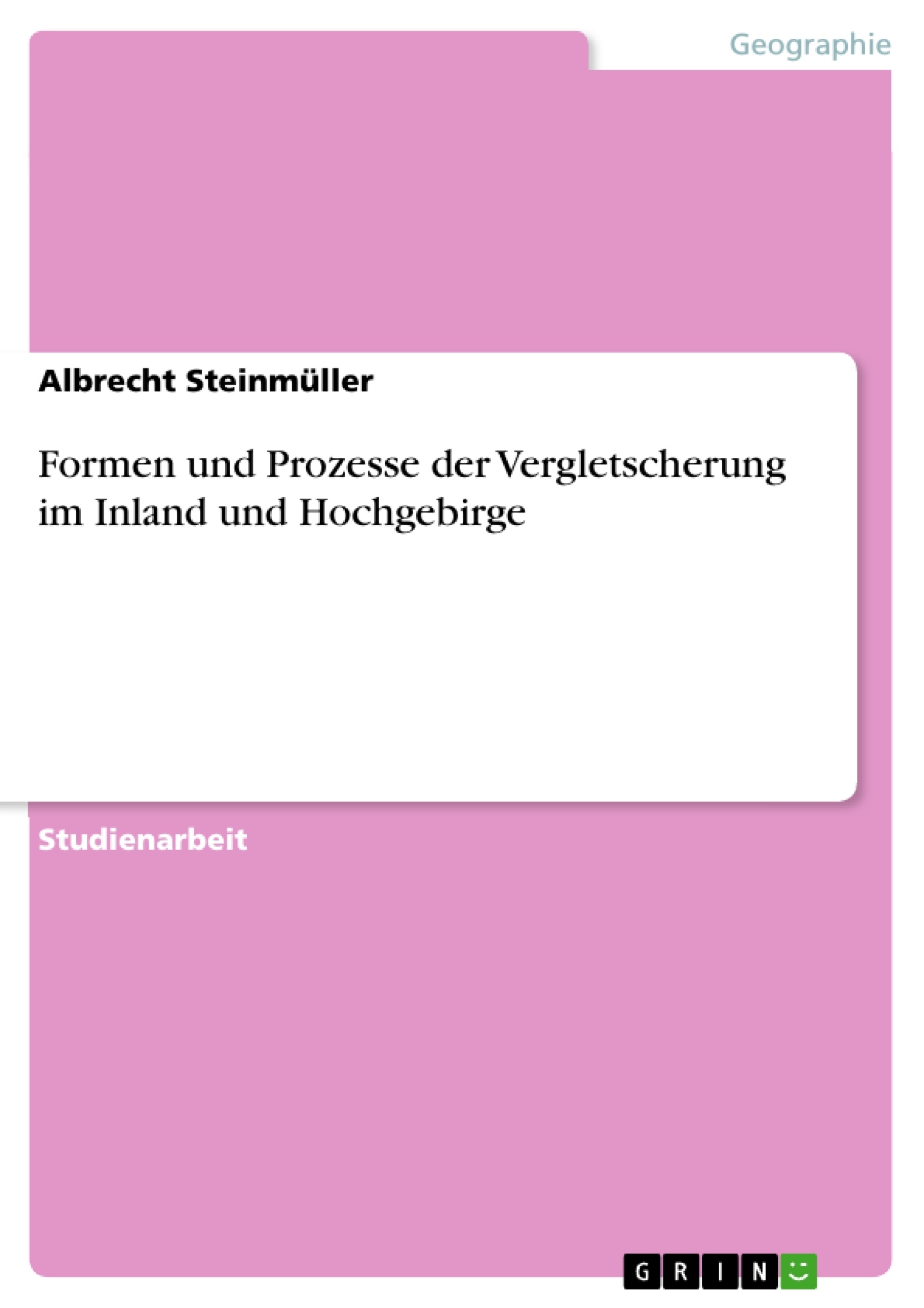Bei der hier vorliegenden Arbeit untersuche ich die Formen und Prozesse der Vergletscherung, wie sie im Hochgebirge und Inland vorkommt. Die Arbeit untergliedert sich in große Überschriften die sich in verschiedene Unterpunkte gliedern. Am Anfang kläre ich allgemeine Begrifflichkeiten und gebe eine Gletscherdefinition. Im Anschluss daran beschreibe ich die Entstehung und die Eigenschaften von Gletschern Als dritten großen Punkt möchte ich die Glaziale Serie und die in ihr beschriebenen Formen und Prozesse erläutern. Abschließend gebe ich ein kurzes Fazit.
Inhalt
1. Einleitung
1.1 Gletscherdefinition
1.2 Klärung der wichtigsten Begriffe
2. Prozesse der Vergletscherung
2.1 Entstehung und Eigenschaften von Gletschern
2.2 Bewegung von Gletschern
2.3 Massenbilanz in einem Gletscher
2.4 Gletschertypen
2.4.1 Inlandeis
2.4.2 Plateaugletscher
2.4.3 Hochgebirge
3. Die glaziale Serie
3.1 Hauptformen
3.1.1 Grundmoräne
3.1.2 Endmoräne
3.1.3 Sander
3.1.4 Urstromtal
3.2 Kleinformen
3.2.1 Hohlformen
3.2.2 Aufschüttungsformen
4. Fazit
Literatur
1. Einleitung
Bei der hier vorliegenden Arbeit untersuche ich die Formen und Prozesse der Vergletscherung, wie sie im Hochgebirge und Inland vorkommt. Die Arbeit untergliedert sich in große Überschriften die sich in verschiedene Unterpunkte gliedern.
Am Anfang kläre ich allgemeine Begrifflichkeiten und gebe eine Gletscherdefinition. Im Anschluss daran beschreibe ich die Entstehung und die Eigenschaften von Gletschern
Als dritten großen Punkt möchte ich die Glaziale Serie und die in ihr beschriebenen Formen und Prozesse erläutern.
Abschließend gebe ich ein kurzes Fazit.
1.1 Gletscherdefinition
„Gletscher sind Massen aus körnigem Firn und Eis, die aus
Schneeansammlungen über Metamorphose hervorgegangen sind. In ihnen sind Gase, organische Substanzen (Pollen) und Gesteinsmaterial (Moränen) enthalten, die vom Nährgebiet zum Zehrgebiet fließen. Durch die Bewegung und wegen der Schichtung des Eises werden typische Texturen geprägt, die auch bei Toteis, das keine eigene Mobiliät mehr aufweist, erhalten bleibt.
Der Raum, in dem sich Gletscher bilden, wird von der Schneegrenze umfahren.
Gletscher bilden im hydrologischen Sinne einen Wasserspeicher, der Wasser langfristig (über sehr viele Jahre) bei Wachstumsphasen speichert und bei Rückzugsphasen wieder abgibt. Somit spielen sie heutzutage eine bedeutende Rolle in der Energie – und Bewässerungswirtschaft und sind gleichzeitig ein wichtiges geomorphologisches Agens.“
(WILHELM (1975) S.156)
1.2 Klärung der wichtigsten Begriffe
Nährgebiet: Gebiet des Schneefallüberschusses
Zehrgebiet: unteres Gebiet des Gletschers mit überwiegendem Massenverlust
Schneegrenze: trennt Nähr- und Zehrgebiet; stellt dynamisches Gleichgewicht dar
zwischen Schneeakkumulation und Ablation.
temporäre Schneegrenze: Höhenlage verschiebt sich mit den Jahreszeiten
orographische Schneegrenze: Lage im Spätsommer (höchste Lage), auch als Firnlinie bezeichnet
klimatische Schneegrenze: mittlere Höhe der Schneegrenze einer Region.
z.B. Westalpen 2500m; Zentralalpen 3400m;
Randtropen 6500m; Äquatorregion 5000m.
Moräne: vom Gletscher mitgeführter oder abgelagerter Gesteinsschutt
(vgl. Quelle: WILHELM, F. (1993) S.116 -117)
2. Prozesse der Vergletscherung
2.1 Entstehung und Eigenschaften des Gletschereises
Gletscher entstehen vor allem in Polargebieten und Hochgebirgen, wo über viele Jahre hinweg mehr Schnee fällt als abschmilzt. Diese anhaltende jährliche Überproduktion ist die einzige unbedingte Voraussetzung für die Bildung von Gletschern.
Es sind keine besonders kalten Winter erforderlich, denn bei mildem Frost kann die Luft mehr Wasserdampf enthalten und daher stärkere Schneefälle als bei tieferen Temperaturen hervorbringen.
Das Fehlen ausreichender Energiemengen um den Schnee komplett wegzutauen ist von ebenso großer Bedeutung. Die Quantität des Schneeüberschusses ist weniger wichtig als die Qualitität. Die Quantität an Schnee entscheidet nur über die Geschwindigkeit, mit der sich der Gletscher entwickelt.
Die Metamorphose des Schnees zu Gletschereis vollzieht sich in mehreren Stadien.
Frisch gefallener Schnee hat eine spezifische Dichte von 0,02 – 0,08. Als erstes schmelzen die Spitzen der sternförmigen Kristalle ab, dadurch wird der Schnee körnig. Hierbei wird die Schneemasse dichter und gleichzeitig fester. Der Druck des sich auflagernden Neuschnees trägt zur Verwandlung bei.
Wenn dieser Vorgang nun mehrere Jahre angehalten hat, verfestigt sich dieser körnige Schnee zu Firn (mittlere Dichte 0,5 – 0,7). Durch den Druck der darüber liegenden jüngeren Schneemassen kristallisieren sich die Firnkörner zu einem festen Gefüge von Gletschereis (mittlere Dichte 0,8 – 0,9). Die mittlere Dichte wird beim Gletschereis unter anderem durch den Anteil der eingeschlossenen Luftbläschen beeinflusst.
Das Gletschereis wird beweglich, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird, der von der Eisbeschaffenheit und dem Gefälle des Untergrunds bestimmt wird. Die Bewegungsrichtung folgt im allgemeinen der Gefällerichtung der Gletscheroberfläche, die verschieden sein kann von der Gefällerichtung des Untergrunds.
Der Druck in einem Gletscher steigt von der Oberfläche in die Tiefe kontinuierlich an, dabei sinkt der Schmelzpunkt von Eis mit wachsendem Druck, um etwa 0,06°C pro 100m. Der Druck in der Tiefe nimmt pro 100m um 9kp/cm² zu.
Da in einem Gletscher jedoch nicht überall die gleichen Druck- und Temperaturverhältnisse herrschen, kommt es durch lokale Spannungen im Eis zu lokalen und zeitlich begrenzten Abweichungen der Mittelwerte, das bedeutet, dass es an verschiedenen Stellen im Eis schmilzt und wieder gefriert, weitestgehend unabhängig von der Umgebungstemperatur. Solch zentimeter- bzw. millimetergroßes Aufschmelzen und Wiedergefrieren des Eises führt zu einer Veränderung des Kristallgefüges und einer Formänderung des sich bewegenden Eises.
In Hochgebirgsgletschern kommt es jedoch aufgrund der ausgeprägten Gefällerichtung zu einer ausgeprägten Scherspannung (sie wirkt bei allen Hangprozessen mit), denn der Druck wird durch das auflastende Eis noch erhöht.
In Gletschern mit großen Eisdicken nimmt die Temperatur aufgrund von geothermischer Wärmezufuhr aus dem Erdinnern in die Tiefe zu.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vom Schnee über Firn
zu Eis (Quelle: Stauffer, Manuskript 1993)
(vgl. Quelle: Ahnert, F. (1996) S. 326 -327;
WILHELM, F. (1975) S. 135 – 156;
WILHELM, F. (1993) S.117 -120)
[...]