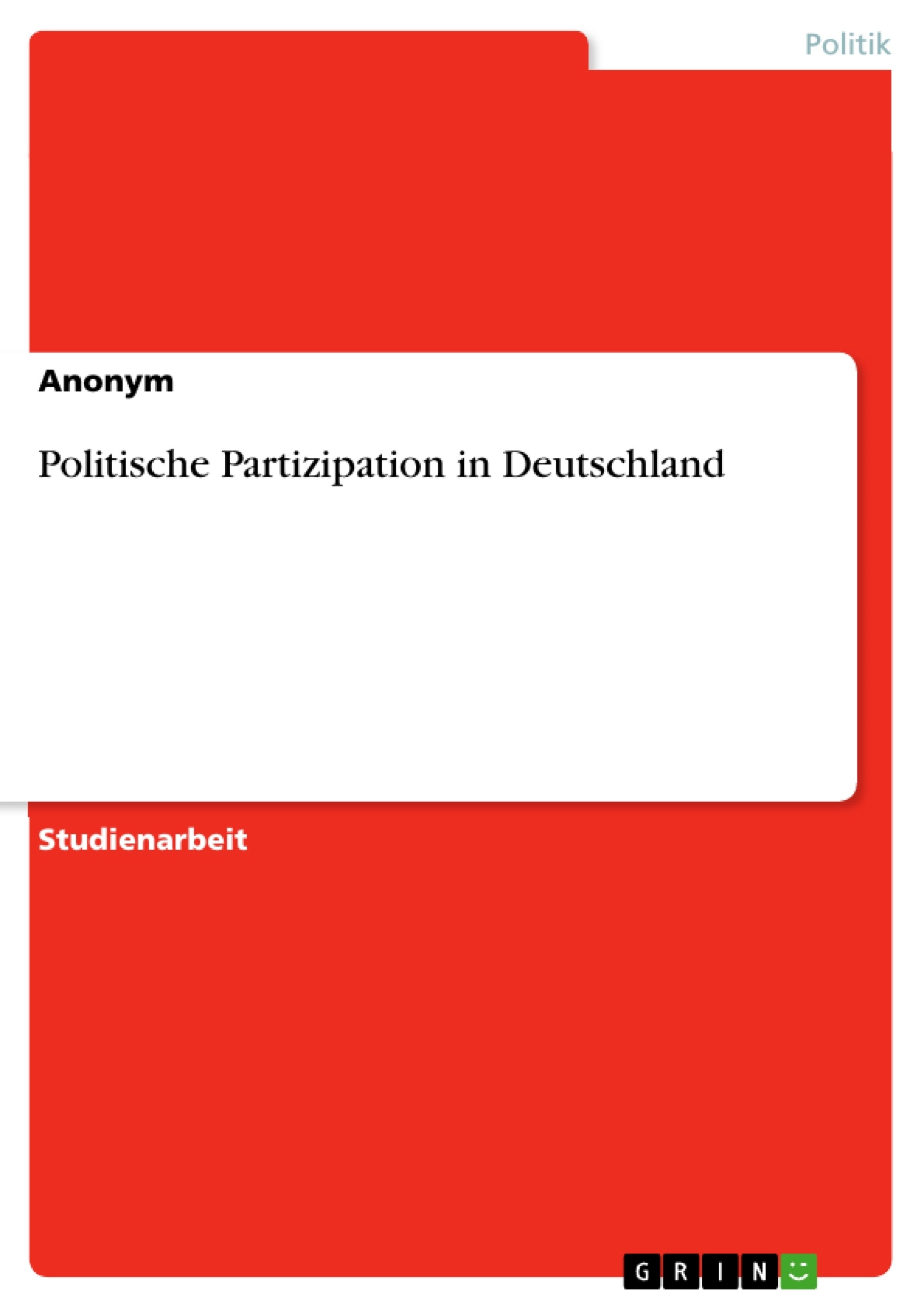In der Hausarbeit wird die politische Partizipation in Deutschland dargelegt. Die zugrundeliegende Fragestellung lautet: „Warum kommt es zu dem Trend der sinkenden Wahlbeteiligung in Deutschland und wie kann man dem entgegenwirken?“.
Um diese Fragestellung zu beantworten, wird als erstes der Begriff „politische Partizipation“ im Zusammenhang mit „Demokratie“ genauer erläutert, dem folgend geht es um die Frage, warum und wieso seit einigen Jahrzehnten ein Rückgang der Wahlbeteiligung erkennbar ist und wie man diesem Trend entgegenwirken kann. Dazu werden Studien herangezogen, die dieses Phänomen empirisch darstellen. Hierbei wird auch ein Einblick in das Phänomen, dass dies besonders bei jungen Menschen zu beobachten ist, dargestellt.
Abschließend werden Maßnahmen/Empfehlungen vorgestellt, die dem Trend der sinkenden Wahlbeteiligung entgegenwirken können.
Politische Partizipation in Deutschland
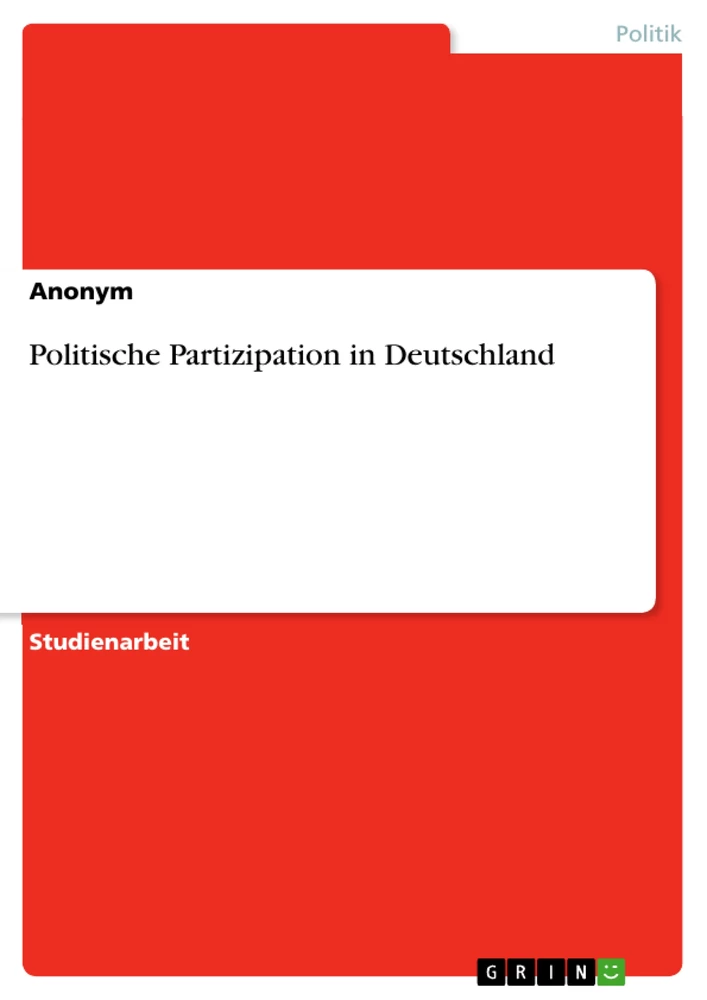
Hausarbeit , 2017 , 11 Seiten , Note: 2,0
Didaktik - Politik, politische Bildung
Leseprobe & Details Blick ins Buch