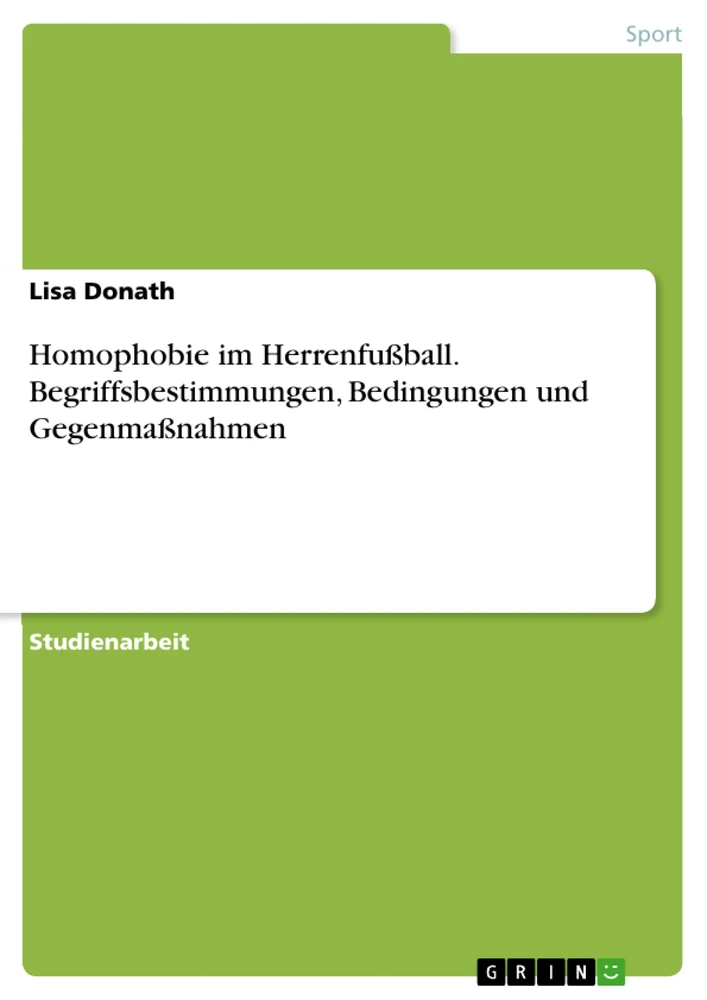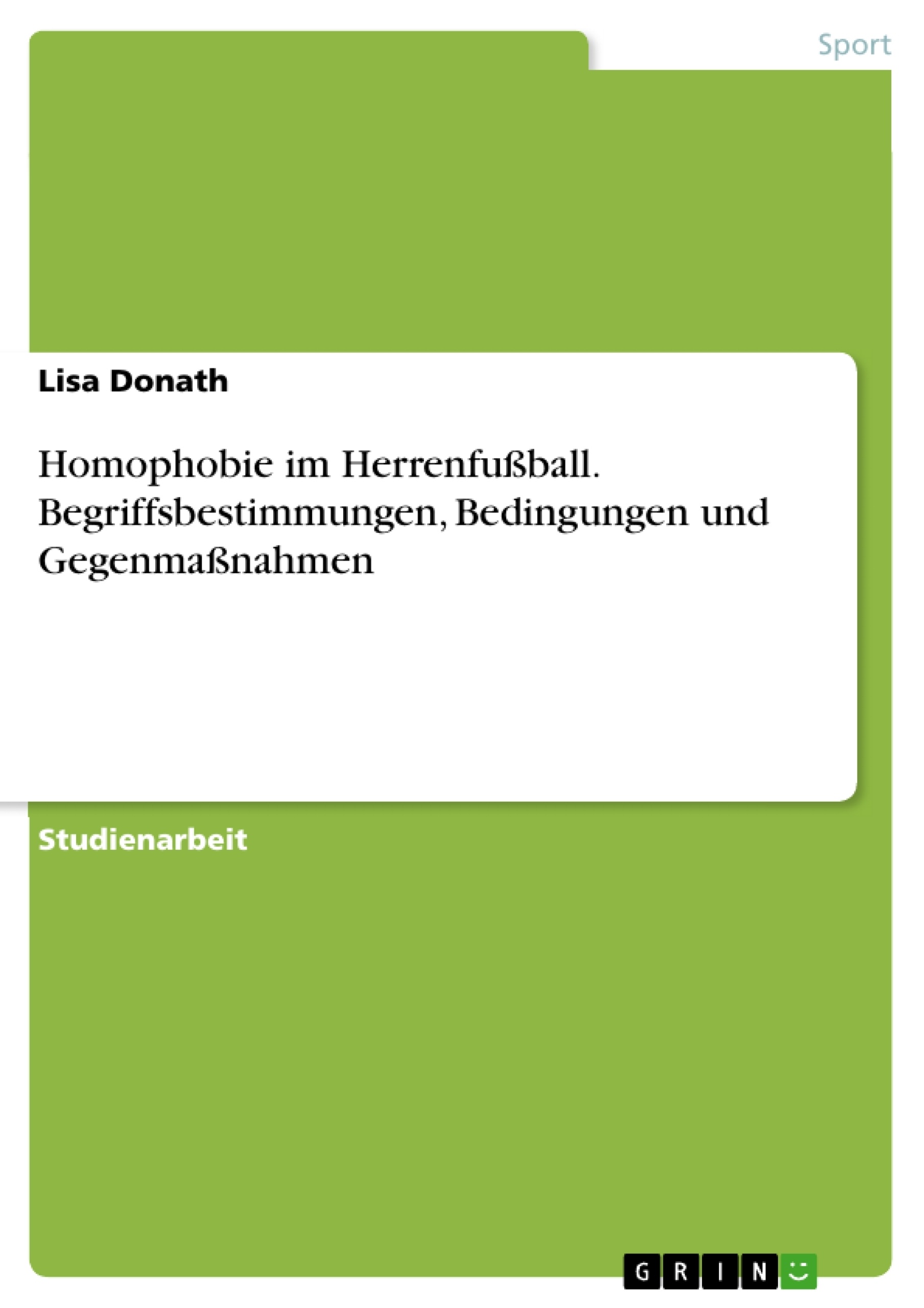Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Homosexualität und der in unserer Gesellschaft damit einhergehenden Homophobie im Sport, explizit im Herrenfußball. Als äußerst aktueller Diskurs im heutigen Spitzensport zeigt sich ein drängender Bedarf diese Thematik zu erklären und als Negativphänomen gleichgestellt mit Rassismus und Sexismus anzugehen und zu bekämpfen.
Bis vor wenigen Jahren waren Homosexualität und andere sexuelle Orientierungen ein absolutes Tabu-Thema. Nur wenige Sportler auf professioneller Ebene bekannten sich öffentlich zu ihrer sexuellen Einstellung und versuchten diese geheim zu halten. In den letzten Jahren hingegen bekannten sich stetig mehr Spitzensportler zu ihrer Sexualität in der Öffentlichkeit. Bei vielen ließ sich jedoch feststellen, dass sie diesen Schritt erst zu ihrem Karriereende wagten (vgl. Pronger 2000).
Im weiblichen Profifußball ist es mittlerweile Gang und Gebe sich zu seiner sexuellen Einstellung zu outen, sodass Sportlerinnen wie unter anderem Nadine Angerer als Vorbilder und Aushängeschilder im Spitzensport agieren. Im Herrenfußball fehlen derartige, aktive Sportler. 2014 bekannte sich als erster deutscher Profifußballer Thomas Hitzlsperger zum Ende seiner aktiven Karriere schwul zu sein. Sein Interview mit der Onlinezeitschrift „Die Zeit“ zeigte deutlich, dass Hitzlsperger sich während seiner aktiven Spielerzeit nicht vorstellen konnte diesen Schritt zu gehen, aus Angst vor Angriffen und Diskriminierungen seitens der Fans aber auch aus Angst vor Benachteiligungen durch den Verband, Sponsoren und seinem Verein (vgl. Zeit.de 2012 & Zeit.de 2014).
Es wird deutlich, dass auf Spitzensportlern ein hoher Druck, den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden, ruht. Dieser Angst, vor Benachteiligungen und Angriffen aufgrund der eigenen sexuellen Orientierung, liegt das Phänomen der Homophobie zugrunde. Warum diese Form der Diskriminierung jedoch im Herrenfußball verbreiteter ist als im Frauenfußball möchte ich im Folgenden klären.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmungen und Konzepte
2.1 Heteronormativität und Homophobie
2.2 Aktuelle Tendenzen in Deutschland
3 Bedingungen im Herrenfußball
3.1 Identitätsentwicklung im Mannschaftssport
3.2 Sport als Bühne
3.3 Zusammenfassung
4 Vorgehen gegen Homophobie
4.1 Politische Situation
4.2 Maßnahmen im Fußball
5 Fazit
6 Literatur
6.1 Monografien und Sammelbände
6.2 Internetquellen
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Homosexualität und der in unserer Gesellschaft damit einhergehenden Homophobie im Sport, explizit im Herrenfußball. Als äußerst aktueller Diskurs im heutigen Spitzensport zeigt sich ein drängender Bedarf diese Thematik zu erklären und als Negativphänomen gleichgestellt mit Rassismus und Sexismus anzugehen und zu bekämpfen.
Bis vor wenigen Jahren waren Homosexualität und andere sexuelle Orientierungen ein absolutes Tabu-Thema. Nur wenige Sportler auf professioneller Ebene bekannten sich öffentlich zu ihrer sexuellen Einstellung und versuchten diese geheim zu halten. In den letzten Jahren hingegen bekannten sich stetig mehr Spitzensportler zu ihrer Sexualität in der Öffentlichkeit. Bei vielen ließ sich jedoch feststellen, dass sie diesen Schritt erst zu ihrem Karriereende wagten (vgl. Pronger 2000).
Im weiblichen Profifußball ist es mittlerweile Gang und Gebe sich zu seiner sexuellen Einstellung zu outen, sodass Sportlerinnen wie unter anderem Nadine Angerer als Vorbilder und Aushängeschilder im Spitzensport agieren. Im Herrenfußball fehlen derartige, aktive Sportler. 2014 bekannte sich als erster deutscher Profifußballer Thomas Hitzlsperger zum Ende seiner aktiven Karriere schwul zu sein. Sein Interview mit der Onlinezeitschrift „Die Zeit“ zeigte deutlich, dass Hitzlsperger sich während seiner aktiven Spielerzeit nicht vorstellen konnte diesen Schritt zu gehen, aus Angst vor Angriffen und Diskriminierungen seitens der Fans aber auch aus Angst vor Benachteiligungen durch den Verband, Sponsoren und seinem Verein (vgl. Zeit.de 2012 & Zeit.de 2014).
Es wird deutlich, dass auf Spitzensportlern ein hoher Druck, den Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden, ruht. Dieser Angst, vor Benachteiligungen und Angriffen aufgrund der eigenen sexuellen Orientierung, liegt das Phänomen der Homophobie zugrunde. Warum diese Form der Diskriminierung jedoch im Herrenfußball verbreiteter ist als im Frauenfußball möchte ich in dieser Arbeit klären.
In den folgenden Kapiteln wird zunächst verdeutlicht, was Homophobie ist und welche Argumente das vermehrte Auftreten im Herrenfußball erklären. Hierfür geht diese Ausarbeitung auch auf die aktuellen Entwicklungen und Zustände in Deutschland ein. In einem weiteren Schritt wird aufgezeigt, wie bestimmte Merkmale des Herrenfußballs die Entstehung homophober Verhaltensweisen begünstigen und so zu dessen Auftreten beitragen. Im letzten Abschnitt dieser Arbeit werden dann Maßnahmen aufgezeigt, mit denen Homophobie begegnet wird.
2 Begriffsbestimmungen und Konzepte
Da diese Arbeit sich im weiteren Verlauf mit der Diskriminierung der sexuellen Orientierung beschäftigt muss zunächst die ihr zugrundeliegende Homophobie erklärt werden. Diese basiert auf der heteronormativen Vorstellung von Geschlechterordnungen, die in diesem Abschnitt näher erläutert werden. Dieses Kapitel verdeutlicht die Entstehung der gesellschaftsdurchziehenden „Angst“ vor Homosexualität auf Basis der Heteronormativität und zeigt zudem auf, warum es sich dabei um ein vor allem männliches Phänomen handelt.
2.1 Heteronormativität und Homophobie
Die deutsche Gesellschaft lässt sich als eine heterosexistische Gesellschaft beschreiben und beruht auf einer heteronormativen Vorstellung von Beziehungen. Das Prinzip der Heteronormativität durchzieht nahezu alle Bereiche des Lebens und somit auch den Breiten- und Leistungssport.
„Sie bezeichnet die gedankliche Grundhaltung, welche sowohl die unreflektierte Annahme der Zwei-Geschlechter-Ordnung mit den sozial konstruierten, dichotom verstandenen Geschlechtern Mann und Frau beinhaltet, als auch die hiermit verbundene soziale Norm der Heterosexualität, aus der sich die abwertende Haltung gegenüber Homosexualität erklärt“ (Hertling 2011, S. 23).
Homosexualität lässt sich auf Grundlage dieser heteronormativen Vorstellungen als „Störung“ (Müller 2009, S.17) der gesellschaftlichen Grundannahmen bezeichnen. Das traditionelle Bild der „dichotomen Zweigeschlechtlichkeit, die vielen Menschen Sicherheit gibt, indem sie die Grenzen der eigenen Selbstverortung eng und geschlechtsabhängig absteckt“ (Hertling 2011, S. 22), wird durch die Erscheinung von Homosexualität gefährdet.
Eben diese Irritation der gesellschaftlichen Norm generiert die sogenannte Homophobie als „Furcht der Heterosexuellen“ (Hertling 2011, S. 22). Folgt man Claus Nachtwey, so umfasst sie jegliche Formen feindlicher Einstellungen „gegenüber homosexuellen Menschen aufgrund ihres (vermeintlich) sexuellen Verhaltens“ (Senatsverwaltung für Integration 2009, S. 5). Sie baut auf Haltungen und Äußerungen auf, die dem heteronormativen Denken entstammen und lässt sich nicht lediglich auf sichtbare physische oder psychische Angriffe reduzieren. Viel verwobener tritt sie überall dort auf, wo sich Ungleichbehandlung Homosexueller feststellen lässt (vgl. Hertling 2011, S. 22f.).
Doch die Abwertung der Homosexualität als Grundsatz einer heterosexistischen Gesellschaft ist zudem auch ein elementarer „Bestandteil der heterosexuellen Männlichkeitskonstruktion“ (Hertling 2011, S. 23). Die normativen Gesellschaftsvorstellungen beinhalten eine klare Geschlechterordnung, an deren Spitze der Mann seinen Platz findet. Durch ständige Inszenierung der eigenen Männlichkeit innerhalb der gleichgeschlechtlichen Bezugsgruppe können Anerkennung und Respekt erreicht und so das Bild der eigenen heterosexuellen Männlichkeit bestätigt werden (vgl. Hertling 2011, S. 55). Seine Überlegenheit erlangt der Mann durch die Herabwürdigung der Frau als schwach, doch in der modernen Gesellschaft wird diese Ordnung „von selbstbewussten Frauen und Schwulen gleichermaßen angezweifelt“ (Hertling 2011, S. 60f.). Die heterosexuell-männliche Vormachtstellung gerät ins Wanken und resultiert in vermehrt frauenfeindlichem und schwulenfeindlichem Verhalten um den Einfluss und die Macht der Frauen und auch der Homosexuellen zu behindern (vgl. Hertling 2011, 60f.). „Abwertung und Stigmatisierung vor allem männlicher Homosexueller“ (Hertling 2011, S. 22) zeichnet die resultierenden homophoben Verhaltensweisen aus. Die bereits beschriebene „Furcht der Heterosexuellen“ lässt zudem vermuten, dass homophobes Verhalten auf Zweifel an der eigenen heterosexuell-männlichen Identität und dem eigenen Verständnis von Männlichkeit“ (Hertling 2011, S. 22) beruht. Alleine die Vorahnung die Erwartungen der Gesellschaft an die eigene Männlichkeit nicht erfüllen zu können oder gar zu wollen schürt die Angst vor homosexuellen Einflüssen (vgl. Hertling 2011, S. 22). Durch die Ablehnung und der Abgrenzung vom „Anderen“, der vermehrt als nicht-männlich bezeichneten Homosexualität, wird die eigene männliche Identität gewahrt und abgesichert (vgl. Hertling 2011, S. 33. mit Bezug auf Timmermanns 2003, S. 63).
Die Herabwürdigung der männlichen Homosexualität sexualisiert und effeminiert den homosexuellen Mann und rückt ihn in die Nähe des Weiblichen. Dem homosexuellen Mann wird unterstellt, dass er sich durch „weibische“ Gesten und Haltungen, als auch feminine Verhaltensweisen auszeichnet (vgl. Hertling 2011, S. 32 und 57).
Dieses Phänomen kommt bereits in der kindlichen Sozialisation zum Vorschein. Eltern erwarten zeitig von ihren Söhnen Mut, körperliche Stärke und Selbständigkeit als typisch männliche Eigenschaften (vgl. Hertling 2011, S. 52). Jungen wird sehr früh gezeigt, dass Emotionalität, Unselbstständigkeit, Fürsorglichkeit und Empathie Zeichen von Schwäche sind. Sie sind Merkmale von Mädchen als filigrane, zarte Wesen der Gesellschaft. Die gleichen Charakteristika werden häufig auch männlichen Homosexuellen zugeschrieben.
Doch nicht nur in der familiären Sozialisation werden Grundsteine für das heteronormative Geschlechterbild gelegt. Auch die gleichgeschlechtliche Bezugsgruppe übt großen Einfluss auf die soziale Entwicklung aus. Die Abwertung des Weiblichen ist für heterosexuelle Männer und Jugendliche so elementar, dass alleine die Anschuldigung, homosexuell zu sein, ein entscheidendes „Instrument der sozialen Kontrolle“ (Schenk 1994, zitiert nach Timmermanns 2003, S. 63) in der Bezugsgruppe darstellt (vgl. Hertling 2011, S. 33).
Demnach bildet Homophobie einen wesentlichen Bestandteil heterosexuell-männlicher Identitätskonstruktionen (vgl. Hertling 2011). Durch die Distanzierung von jeglichen als weiblich konnotierten Geschlechtsrollen kann die eigene Männlichkeit gesichert werden.
Beleidigungen und andere homophobe Verhaltensweisen sind Werkzeuge um die „Übermacht als Mann zur Schau zu stellen“ und verdeutlichen die „verspürte Notwendigkeit“ dieser Handlungen (Hertling 2011, 57 & vgl. Rauchfleisch 2001, S. 165).
Abschließend lässt sich sagen, dass „Homophobie (...) einer der am meisten gebilligten Ausgrenzungsmechanismen im heutigen Deutschland“ (Hertling 2011, S. 23) darstellt. Die „biologische Norm“, die der Heteronormativität zu Grunde liegt, ist in den Gedanken und Einstellungen der Gesellschaft tief verankert. Der Heterosexismus kommt zum Ausdruck durch homophobe Verhaltensweisen, aber vor allem auch durch das „Verschweigen und (...) NichtErwähnen von Homosexualität in der Öffentlichkeit und (...) in der Gegenwart von Kindern.“ (Hertling 2011, S. 29). Als Bestandteil der männlichen Identitätskonstruktion lässt sich zudem festhalten, dass Homophobie ein explizit männliches Problem ist.
2.2 Aktuelle Tendenzen in Deutschland
Das eben beschriebene Phänomen der Homophobie beruht vor allem auf dem heteronormativen Bild von Geschlecht und den damit einhergehenden heterosexuellen Erwartungen. Homosexualität wird nicht als gleichwertige Sexualität anerkannt. Stattdessen wird sie herabgewürdigt und stereotypisiert.
„Bochow geht im Jahr 1993 davon aus, dass etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung als stark schwulenfeindlich eingestuft werden kann, einem weiteren Drittel unterstellt er eine ambivalente Einstellung gegenüber Homosexualität, die durchaus stark geprägt sein kann von Stereotypen und Klischees“ (Hertling 2011, S. 23 und vgl. Timmermanns 2003, S. 14).
Die Mehrheit der Heterosexuellen fällt jedoch nicht durch aktives, aggressives und verletzendes Verhalten gegenüber Homosexuellen auf. Sie gehören eher zu den „stillschweigenden DulderInnen homophoben und heterosexistischen Verhaltens“ (Hertling 2011, S. 23). Doch auch dieses passive Verhalten hemmt und beeinträchtigt das Leben Homosexueller. Ein deutlicher Beleg für die Anwesenheit von Homophobie in Deutschland stellt die stark erhöhte Suizidrate Homosexueller dar. Überproportional häufig treten vor allem Suizidversuche unter homosexuellen Jungen auf.
„In einer Genfer Studie1 aus dem Jahr 2003 berichten 55 Prozent aller homosexuellen befragten Männer davon, bereits mindestens ein Mal in ihrem Leben ernsthafte Suizidgedanken gehabt zu haben, 19 Prozent der Befragten bestätigen, mindestens einen aktiven Suizidversuch in ihrer Lebensgeschichte unternommen zu haben“ (Hertling 2011, S. 24).
Durchschnittlich liegt die Suizidrate der Gesamtbevölkerung deutlich unter diesen Werten.
Suizidversuche treten etwa viermal häufiger unter homosexuellen Männern auf, als in allen anderen Bevölkerungsgruppen (vgl. Hertling 2011, S. 23 und vgl. Wiesendanger 2005, S. 48). Diese Befunde lassen auf eine stark homophobe und abwertend heterosexistische Lebenswelt schließen.
Doch Homophobie in Deutschland lässt sich nicht nur durch Befunde zu Suizidversuchen feststellen. Unsere Gesellschaft setzt sich immer wieder verstärkt für Respekt gegenüber Andersartigkeit ein. Verschiedenste Projekte beispielsweise im Kampf gegen Rassismus lassen sich überall in Deutschland wiederfinden. Jedoch lässt sich dieses Bild von Toleranz nicht im tagtäglichen Umgang mit Homosexualität feststellen (vgl. Hertling 2011, S. 29). Stattdessen zeigen die Ergebnisse des Eurobarometers, einer europaweiten Studie2 aus dem Jahr 2006, eine starke Dissonanz, wenn es um Homosexualität geht. In Deutschland sprachen sich 52 Prozent für die rechtliche Gleichstellung, durch die Öffnung der Ehe für Homosexuelle, aus. In Bezug auf das Adoptionsrecht Homosexueller ist die Bevölkerung jedoch kritischer. Hier stimmten nur 42 Prozent der Deutschen und lediglich 32 Prozent aller EuropäerInnen für das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Folglich sprechen sich etwas mehr als die Hälfte der Deutschen gegen das Adoptionsrecht aus (vgl. Hertling 2011, S. 25). Ergänzt man diese Ergebnisse durch die Befunde der 2009 von der Europäischen Kommission durchgeführten Sonderumfrage zum Thema „Diskriminierung in der EU“, so zeigt sich, dass nur 36 Prozent die Diskriminierung Homosexueller in Deutschland für verbreitet halten (vgl. Hertling 2011, S. 25f.). Dies wiederspricht jedoch den Befunden des Eurobarometers. „In Deutschland wird Homosexualität gesellschaftlich oberflächlich geduldet“ (Hertling 2011, S. 26), jedoch muss zwischen Scheintoleranz und wirklicher Aufgeschlossenheit unterschieden werden.
Doch nicht nur in der Erwachsenengesellschaft tritt homophobes Verhalten auf. Stefan Timmermanns führte 2003 eine Studie3 durch in der „61 Prozent der befragten Schüler und 32 Prozent der befragten Schülerinnen eine ablehnende Haltung gegenüber Homosexualität“ (Hertling 2011, S. 27 und vgl. Timmermanns 2003, S. 125) aufwiesen. Auch eine Studie aus dem Jahr 2006 von Bernd Simon bestätigt diese Erkenntnisse.
[...]
1 Von Häusermann und Wang durchgeführte Genfer Studie „project santé gaie“ aus dem Jahr 2003 untersuchte die Gesundheit schwuler Männer in Genf und Genfer Umgebung. Hierzu wurden 571 Männer in der Genfer Schwulenszene befragt. In der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil der Männer mit Suizidversuch bei drei Prozent (vgl. Wiesendanger 2005, S. 50)
2 Im Zuge der halbjährlich von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Studie „Eurobarometer“ wurden zwischen September und Oktober 2006 Interviews mit 29.152 mindestens 15-jährigen Mitgliedern der Europäischen Union geführt („margin of error“/Fehlerspielraum: 3,1 Prozent; vgl. Online Veröffentlichung der Europäischen Kommission unter http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66:en.pdf (PDF, S. 231f.)
3 Timmermanns erfragte im Rahmen seiner Evaluation schwuler Aufklärungsprojekte die Einstellung von 298 SchülerInnen gegenüber Homosexuellen. Die Angaben beziehen sich auf die Erhebung vor der Durchführung des jeweiligen Aufklärungsprojekts.