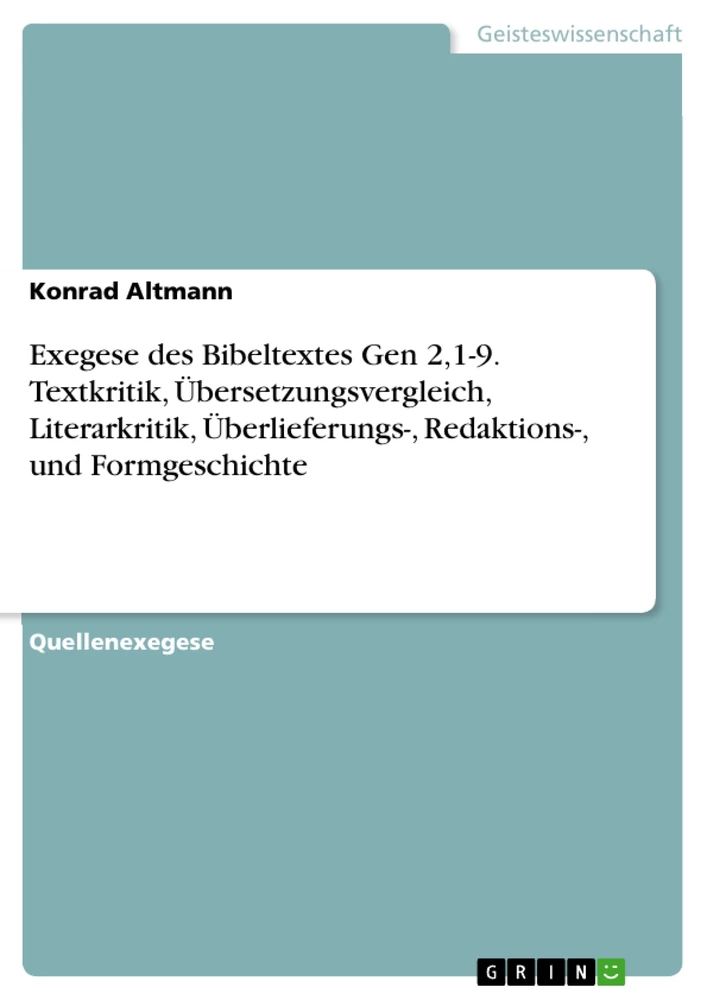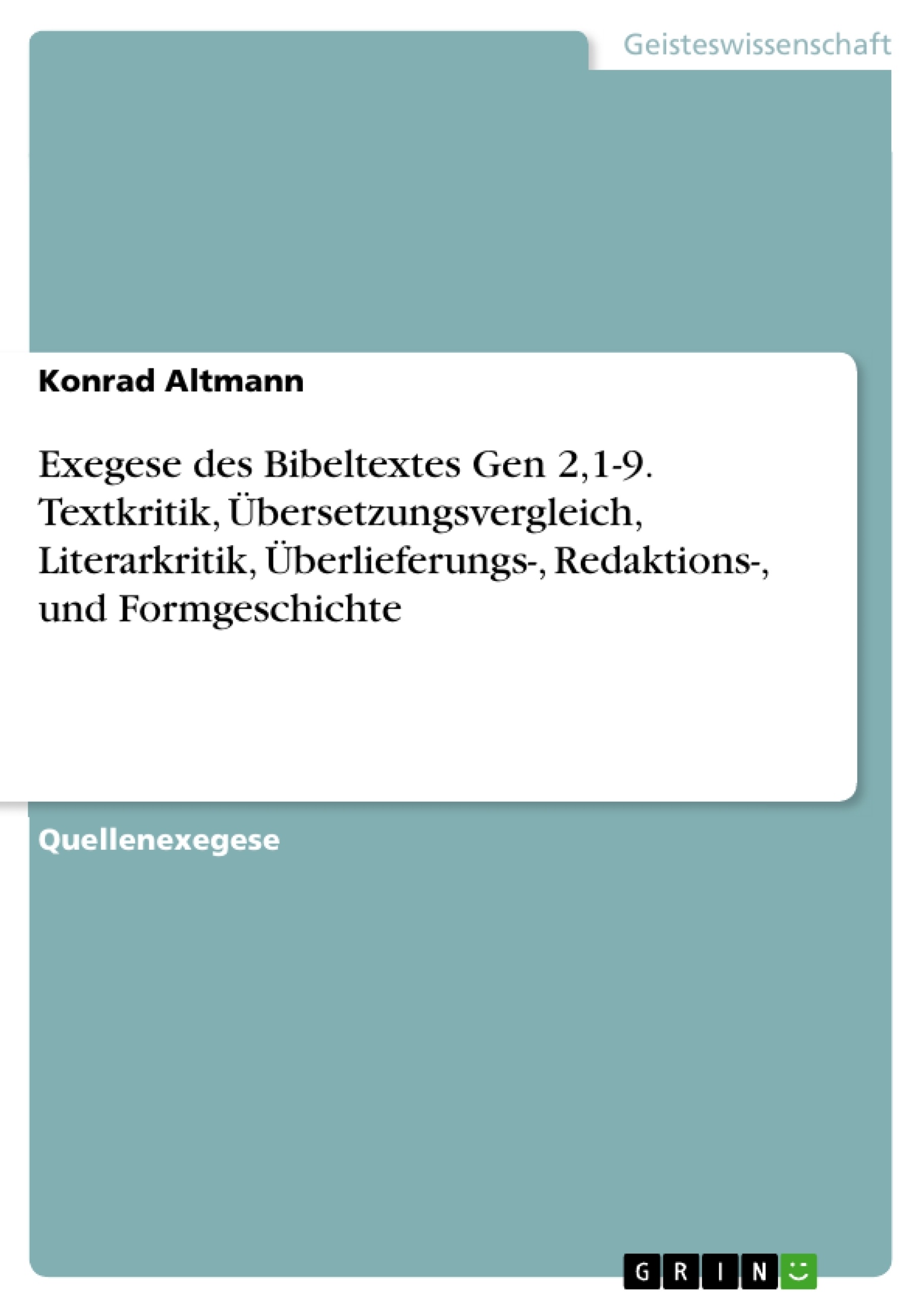Innerhalb dieser Proseminararbeit soll die Exegese des Bibeltextes Gen 2,1-9 anhand verschiedener Methodenschritte erfolgen. Diese Schritte der Exegese sind Textkritik und Übersetzungsvergleich, Literarkritik, Überlieferungsgeschichte, Redaktionsgeschichte, Formgeschichte, Traditionsgeschichte sowie die Bestimmung des historischen Ortes und die historische Interpretation. Orientiert wird sich dabei vorrangig an den von Uwe Becker zusammengestellten Hinweisen zu den Methodenschritten der Exegese des Alten Testaments.
Eine Ausnahme ist der siebte Gliederungspunkt dieser Proseminararbeit: Hier wird sich vor allem nach dem Leitfaden der Methodik von Odil Hannes Steck gerichtet, da dieser ausführlicher auf den historischen Ort und die zugehörige Interpretation eingeht als Uwe Becker es tut.
Der Text Gen 2,1-9 war mir bereits vor der Vergabe der Aufgabenstellung, diesen exegetisch zu untersuchen, inhaltlich im Groben bekannt. Es handelt sich um einen Teil der Schöpfungsgeschichte. In diesem wird auf die Schöpfung des Menschen durch Gott eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Textkritik und Übersetzungsvergleich
2 Literarkritik
3 Überlieferungsgeschichte
4 Redaktionsgeschichte
5 Formgeschichte
6 Traditionsgeschichte
7 Historischer Ort und Interpretation
Schluss
Literaturverzeichnis
Anhang