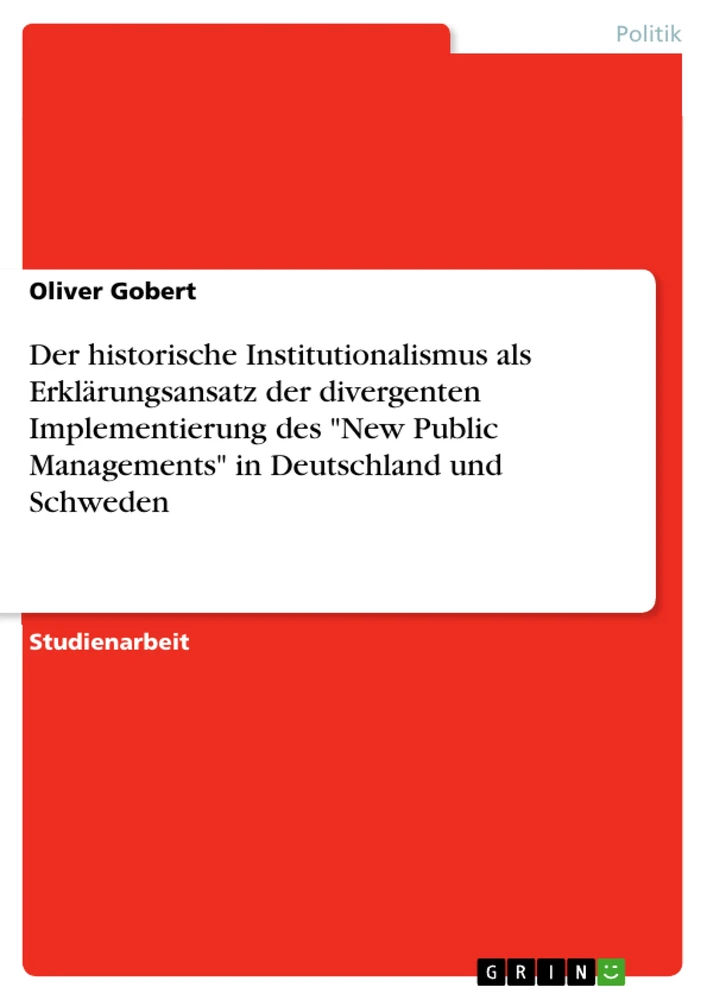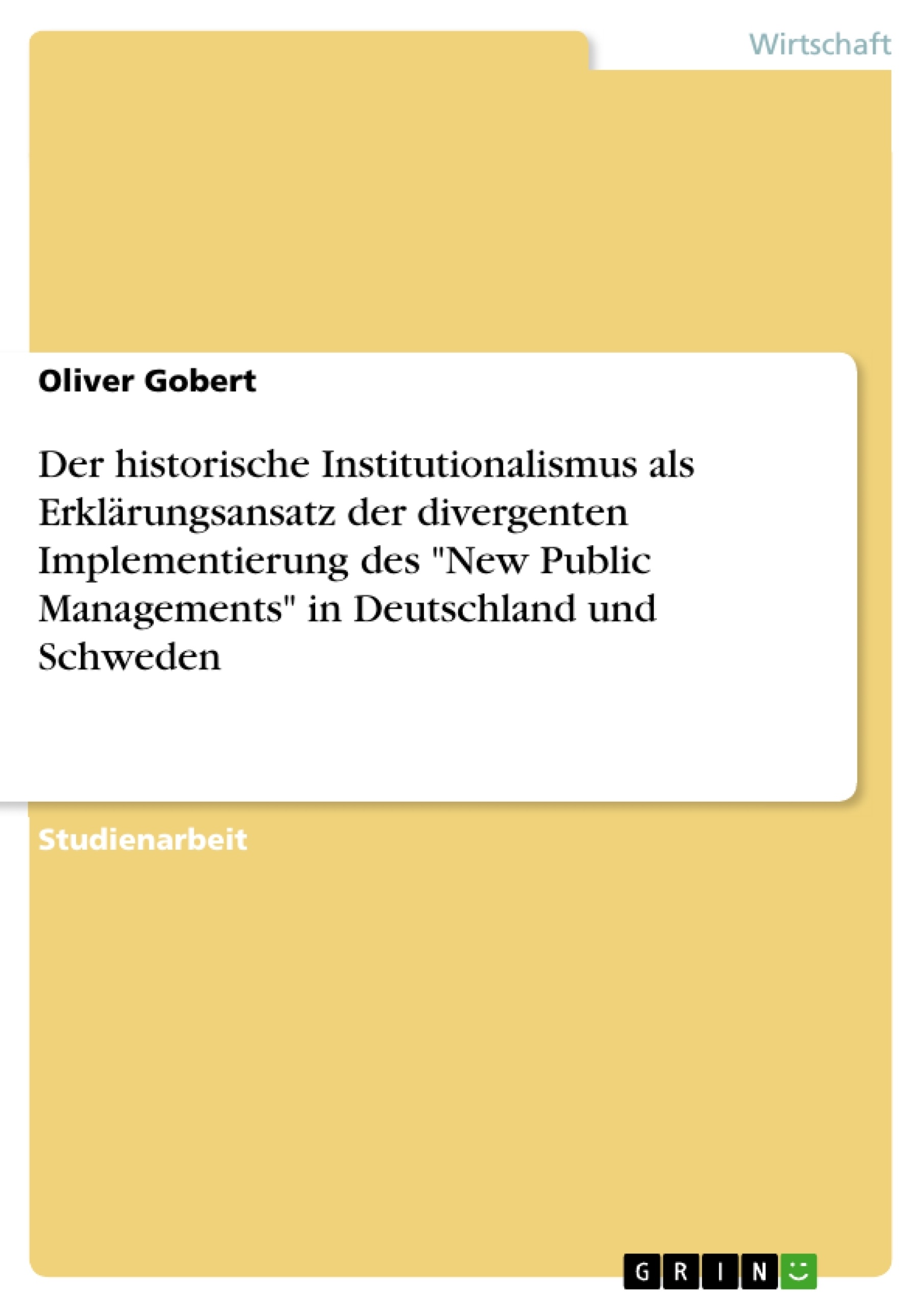Im Rahmen dieser Hausarbeit wird untersucht, wie sich die Reformbewegung des New Public Management (NPM) auf die kommunalen Verwaltungen in Deutschland und Schweden ausgewirkt hat und worauf etwaige Unterschiede zurückzuführen sind. Dem wird insbesondere Relevanz zugemessen, da Deutschland als Nachzügler in Sachen NPM-Reform in der Literatur angesehen wird, Schweden jedoch eine europäische Vorreiterrolle bei der Implementierung des NPM einnimmt.
Anhand der folgenden Untersuchungshypothesen möchte ich meine Fragestellung beantworten: (1) In Deutschland und Schweden wurde das NPM in den Kommunen unterschiedlich umgesetzt; (2) die Gründe der divergenten Umsetzung des NPM sind auf die unterschiedliche Verwaltungstradition der beiden Länder zurückzuführen. Den methodischen und theoretischen Rahmen dieser Hausarbeit liefert der Historische Institutionalismus, um die divergente Implementierung des NPM in beiden europäischen Staaten zu erklären und um zu erforschen, welche Ursachen bzw. Auslöser institutionellen Veränderungen zugrunde liegen. Die Umsetzung des NPM wird in dieser Hausarbeit daher als abhängige Variable betrachtet, während die unterschiedlichen Verwaltungstraditionen der Beispielländer und der Historische Institutionalismus die unabhängigen Variablen der Analyse bilden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hintergrund: Die Reformbewegung des New Public Managements
3. Theoretischer Rahmen & Methodik
3.1 Verwaltungsreformen aus neo-institutionalistischer Perspektive: Historischer Institutionalismus
3.2 Kriterien der systematischen Fallauswahl: Unterschiedliche Verwaltungstraditionen
4. Vergleichende Analyse zur Umsetzung des New Public Managements
4.1 in Deutschland
4.2 in Schweden
5. Analyse der unterschiedlichen Umsetzung des New Public Managements in den Beispielländern
6. Diskussion der Analyseergebnisse
7. Literaturverzeichnis
8. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Ab Mitte der 1970iger Jahre bildete die internationale neoliberale Staatskritik die Grundlage für den Wechsel des verwaltungspolitischen Leitbildes vom akti- ven Staat hin zum schlanken Staat. Staats- und Bürokratieversagen standen im Zentrum dieser Kritik, Marktmechanismen galten als Zugpferd des sozio-öko- nomischen Fortschritts. Damit einhergehend erfuhren betriebswirtschaftliche und ökonomische Sichtweisen einen erheblichen Bedeutungszuwachs (BOGUMIL; JANN 2008: 43). Der neoliberale Geist der Effizienz hielt nicht nur Einzug in die Vereinigten Staaten, sondern etwas später auch in zahlreichen Staaten Europas. Der Siegeszug des Effizienzgedankens sollte mit Hilfe eines Ablegers der modernen Managementlehre, dem sogenannten New Public Ma- nagement (NPM), auch auf die öffentlichen Verwaltungen übertragen werden. Im geschichtlichen Kontext des Vollzugs der deutschen Einheit und einherge- henden Einschränkungen haushaltspolitischer Ausgaben begann die deutsche öf- fentliche Verwaltung das NPM umzusetzen. Andere europäische Länder wie Schweden diskutierten die Einführung von Konzepten und Instrumenten des NPM bereits Ende der 1980iger Jahre (JANN 2004: 43-44).
Im Rahmen dieser Hausarbeit wird untersucht, wie sich die Reformbe- wegung des NPM auf die kommunalen Verwaltungen in Deutschland und Schweden ausgewirkt hat und worauf etwaige Unterschiede zurückzuführen sind. Dem wird insbesondere Relevanz zugemessen, da Deutschland als Nach- zügler in Sachen NPM-Reform in der Literatur angesehen wird, Schweden je- doch eine europäische Vorreiterrolle bei der Implementierung des NPM ein nimmt (BIRKOHOLZ; MAAß, et al. 2006: 27). Anhand der folgenden Untersu- chungshypothesen möchte ich meine Fragestellung beantworten: (1) In Deutsch- land und Schweden wurde das NPM in den Kommunen unterschiedlich umge- setzt; (2) die Gründe der divergenten Umsetzung des NPM sind auf die unter- schiedliche Verwaltungstradition der beiden Länder zurückzuführen. Den me- thodischen und theoretischen Rahmen dieser Hausarbeit liefert der Historische Institutionalismus, um die divergente Implementierung des NPM in beiden eu- ropäischen Staaten zu erklären und um zu erforschen, welche Ursachen bzw.
Auslöser institutionellen Veränderungen zugrunde liegen. Die Umsetzung des NPM wird in dieser Hausarbeit daher als abhängige Variable betrachtet, wäh- rend die unterschiedlichen Verwaltungstraditionen der Beispielländer und der Historische Institutionalismus die unabhängigen Variablen der Analyse bilden.
2. Hintergrund: Die Reformbewegung des New Public Managements
Das „New Public Management“ bezeichnet eine Bewegung bzw. eine Richtung innerhalb der Verwaltungsreform und Staatsmodernisierung. Dabei verdeutlicht schon der Begriff, dass versucht wird, ob ein Managementkonzept mit einem allgemeinen Verwaltungssystem einhergehen kann. Weiterhin beschäftigt sich das NPM nicht mit dem klassischen Management im privatwirtschaftli- chen und unternehmerischen Sinn, dessen Grundlage die Existenz von Marktge- setzlichkeiten bzw. das Vorhandensein einer Eigenfunktionsweise des Marktes voraussetzen würde, sondern mit der Umsetzung von Reformen im öffentlichen Bereich. Bei den Reformen soll nun der Effizienzgedanke in den Vordergrund gestellt werden. Die Effizienz stellt im Allgemeinen einen elementaren Zielge- danken des NPM dar (ZECHLIN 2015).
Durch die aufkommende Kritik am verwaltungspolitischen Leitbild des „aktiven Staates“ zu Beginn der 1980iger Jahre erhielt das aus den USA stam- mende NPM-Modell Rückenwind. Im Vordergrund der Kritik stand die Behaup- tung, der Staat an sich löse keine Probleme, sondern sei ein nicht zu vernachläs- sigender Bestandteil der eigentlichen Problemlage. Im Zuge dieser Analyse wurde versucht, die einzelnen Bausteine und Ziele des NPM auch in Europa zu implementieren. Dazu zählen insbesondere das Kontraktmanagement zwischen Politik und Verwaltung, „nach dem die Politik nur noch Ziele (‚was‘) definieren und die Ausführung der Verwaltung überlassen sollte (‚wie‘), um eine wirt- schaftlichere Aufgabenerledigung zu gewährleisten“ (HOLTKAMP 2012a: 219 Des Weiteren soll die Zusammenführung der Aufgaben- und Finanzverantwor- tung durch die Budgetierung erreicht werden, damit insbesondere die Fachberei- che im Haushaltsvollzug mehr Kompetenzen erhalten können und um die Ver- waltung zu einem wirtschaftlicheren Verhalten zu motivieren. Eines der wich tigsten Kernelemente des NPM ist die output-orientierte Steuerung, um die gro- ßen Handlungsspielräume der Verwaltung durch die Politik zu überwachen. Ebenfalls sollten Haushaltspläne einem produktorientierten Haushaltsbuch wei- chen, damit die von der Politik vorgegebenen Produkte und deren Zielerrei- chungsgrade wiederum durch die Politik selbstständig evaluiert werden können (HOLTKAMP 2012a: 207-208). Eine weitere Vorgabe des NPM stellt die starke Betonung der kundenorientierten öffentlichen Verwaltung dar (NASCHOLD; BOGUMIL 1998: 79).
3. Theoretischer Rahmen & Methodik
Den theoretischen Rahmen dieser Arbeit liefert der historische Institutionalismus, der einen Erklärungsansatz der neo-institutionalistischen Verwaltungsreform darstellt. Methodisch basiert die Hausarbeit auf einer vergleichenden Fallbetrachtung der Implementierung des NPM in Deutschland und Schweden. Die Kriterien für die Auswahl der Fälle, die im systematischen Fallvergleich betrachtet werden, werden im Abschnitt 3.2 eingehender erläutert.
3.1 Verwaltungsreformen aus neo-institutionalistischer Perspektive:
Historischer Institutionalismus Der klassische theoretische Ansatz des Institutionalismus befasst sich insbeson- dere mit formalen Institutionen. Ab den 1970iger Jahren beschäftigten sich neu- ere theoretische institutionalistische Ansätze vor allem damit, das Zusammen- wirken von Institutionen und Akteuren zu erklären (FLORACK 2013: 116-117 Nach der neo-institutionalistischen Definition beeinflussen Institutionen das Handeln der Akteure, sodass Institutionen im politischen Prozess sowohl hand- lungsermöglichend als auch handlungsbeschränkend wirken (KUHLMANN; WOLLMANN 2013b: 57). In diesem Zusammenhang spricht DOWDING von „struc- tural suggestion“ (DOWDING 1995: 44).
Nach HALL und TAYLOR können drei Strömungen des Neo-Institutionalis mus unterschieden werden: Der Rational-Choice-Institutionalismus, der Sozio- logische Institutionalismus und der Historische Institutionalismus (HALL; TAY- LOR 1996: 936). Die Einteilung der Ausprägungen der neo-institutionalistischen Ansätze erfolgte anhand des Strukturiertheitsgrades des Verhältnisses zwischen Institutionen und Akteuren. Des Weiteren wird konzeptionell untersucht, in wel- cher Form Prozesse der Institutionenentstehung und des Wandels von Institutio- nen erklärt werden können (HALL; TAYLOR 1996: 936). Die weiterentwickelten theoretischen Ansätze des Neoinstitutionalismus können fortführend verwendet werden, die Existenz von unterschiedlichen Verwaltungssystemen und die Im- plementierung von Verwaltungsreformen zu erklären:
„Die verschiedenen Ansätze des Neo-Institutionalismus bieten die Möglichkeit, Verwaltungssysteme und -reformen im Hinblick auf ihre Entstehungsfaktoren einerseits und ihre Wirkungsmechanismen andererseits zu analysieren und dabei Institutionen eine zentrale analytische Stellung als erklärenden Variablen einzuräumen“ (KUHLMANN; WOLLMANN 2013b: 57).
Die Perspektive des Rational-Choice-Institutionalismus ist vor allem ak- teurzentriert. Er geht von verfestigten Akteurpräferenzen und -zielen aus, wobei Akteure stets strategisch, rational und nutzenmaximierend im Sinne eines homo oeconomicus agieren (FLORACK 2013: 119). Der Soziologische Institutionalis- mus steht dem akteurzentrierten Institutionalismus gegenüber, da er den metho- dologischen Individualismus der Rational-Choice-Theorie ablehnt. Vielmehr werden Institutionen als Kulturphänomene betrachtet, die einen Katalog sozial- adäquaten Verhaltens zur Verfügung stellen, welcher einen Ausweg aus Koope- rationsdilemmata weist (KUHLMANN; WOLLMANN 2013b: 63). Dem homo oeco- nomicus wird somit ein homo sociologicus entgegengestellt. Die potentiellen Stärken der beiden dargestellten neo-institutionellen Ansätze liegen insbeson- dere darin, zu erklären, wie und warum Institutionen entstehen und weshalb In- stitutionen über lange Zeiträume hinweg fortbestehen (FLORACK 2013: 120- 121).
Der Historische Institutionalismus nimmt laut HALL und TAYLOR eine vermittelnde Position bei den neo-institutionalistischen Ansätzen ein, da der In- stitutionenbegriff weit ausgelegt ist (HALL; TAYLOR 1996: 936-941). Es wird davon ausgegangen, dass Präferenzen und Wahlhandlungen durch langfristig an- gelegte institutionelle Kanäle vorstrukturiert werden. Reformen sind stets vor dem Hintergrund längerfristiger institutioneller Systementwicklungen zu be- trachten. Im Denkmodell des Historischen Institutionalismus werden diese als Pfadabhängigkeiten, die Entscheidungsalternativen systematisch eingrenzen, bezeichnet. Aus Sicht dieses Denkmodells sind Verwaltungssysteme Zusam- menschlüsse von Akteuren, die aus einem Prozess der Institutionalisierung her- vorgegangen sind. Dabei ist selbst die Interaktion von Akteuren institutionali- siert und geprägt durch in der Vergangenheit strukturierte Verhandlungsmuster, die als Entwicklungspfad bezeichnet werden. Diese Pfadabhängigkeiten lassen wenig Spielraum für neue Ansätze oder innovative Lösungen (FLORACK 2013: 118-119). Insbesondere verwaltungspolitische Reformvorhaben sind durch so- genannte policy legacies des vorliegenden Verwaltungssystems geprägt. Der Be- griff der policy legacies zielt in einem großen Kontext auf politisch eingespielte Muster als Reaktion auf Problemlagen ab (KUHLMANN; WOLLMANN 2013b: 61). Diese werden dann problematisch, wenn alte Lösungsstrategien neue Herausfor- derungen nicht bewältigen können, da verwaltungspolitische Problemlagen in- stitutionell beschränkt sind und vorgegebene soziale Interpretationsmuster den Handlungsspielraum weiter begrenzen. Vorhandene Handlungsmöglichkeiten und optionale Spielräume werden weiterhin durch die vorliegende Pfadabhän- gigkeit eingeschränkt. Das Verlassen des Pfades ist nur dann möglich, wenn ex- terne Impulse auf das Kontinuum und die institutionelle Weichenstellung ein- wirken und die damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten erweitern. Auslö- ser, um das Kontinuum zu unterbrechen, sind beispielsweise ökonomische oder soziale Krisen (KUHLMANN; WOLLMANN 2013b: 61-62). Im Gegensatz zum Ra- tional-Choice-Institutionalismus oder zum Soziologischen Institutionalismus er- öffnet die theoretische Basis des Historischen Institutionalismus die konzeptio- nelle Möglichkeit, institutionellen Wandel und die Kausalität der Umsetzung von Reformen zu erklären. Der Ansatz ist nach MAHONEY & THELEN auch ge- eignet, inkrementelle Wandlungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung zu er- klären, wohingegen andere Ansätze, wie zum Beispiel der soziologische Institu- tionalismus, vorrangig institutionelle Kontinuität erklären (MAHONEY; THELEN 2010: 5-10). Der Historische Institutionalismus ist daher besonders geeignet, um die Hypothesen und die Fragestellung dieser Hausarbeit zu untersuchen.
3.2 Kriterien der systematischen Fallauswahl:
Unterschiedliche Verwaltungstraditionen Eine Möglichkeit zu vergleichen besteht nach NOHLEN in der Gegenüberstellung von Wissen und Erfahrungen in bekannten Zusammenhängen mit zunächst un- bekannten Kontexten (NOHLEN 1994: 507 ff.). Bei einem zweckmäßigen poli- tikwissenschaftlichen Vergleich handelt es sich um eine systematisierend vorge- nommene Gegenüberstellung mit eigens entwickelten Kategorisierungen und Typologien. Das heißt, ein systematischer politikwissenschaftlicher Vergleich weist immer klare Bestimmungen auf, was und wie verglichen werden soll. In den meisten Fällen können zweckmäßige Kriterien nicht unmittelbar daraus ab- geleitet werden, wenn Einzelphänomene betrachtet werden. Um einen Vergleich durchführen zu können, müssen Kriterien identifiziert werden, die alle zu ver- gleichenden Phänomene aufweisen und die vergleichbar erfasst werden können (JAHN 2007: 15). Sinn und Zweck der vergleichenden Methode ist es, deskriptiv das Phänomen zu erfassen und anschließend vergleichend zu analysieren, warum das Phänomen in der bestehenden Form zu Stande gekommen ist (JAHN 2007 15-16).
[...]