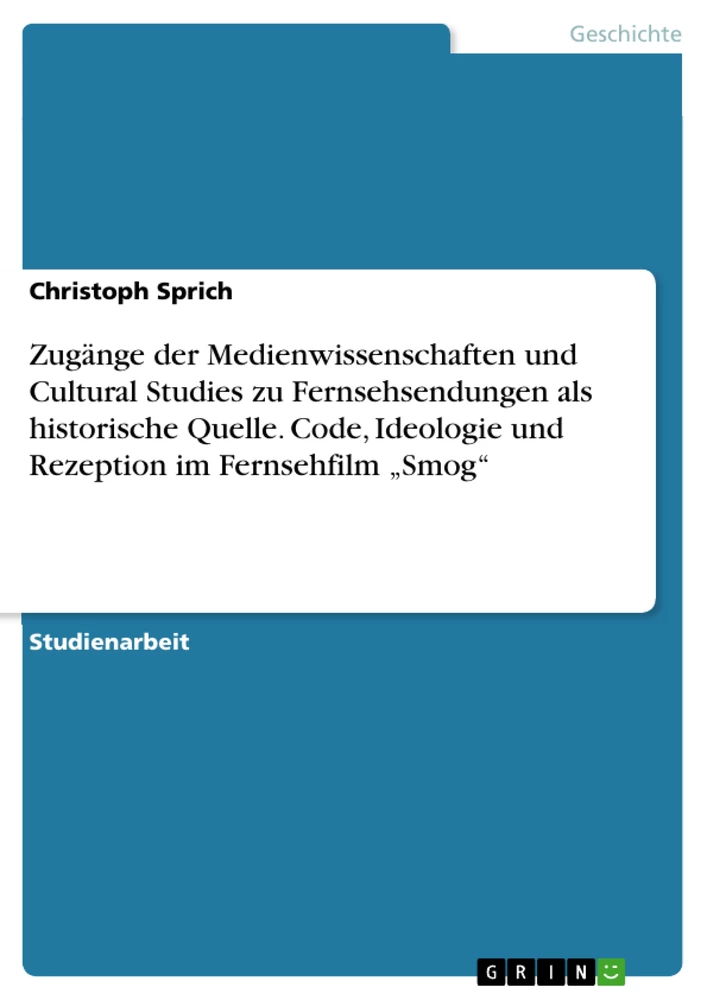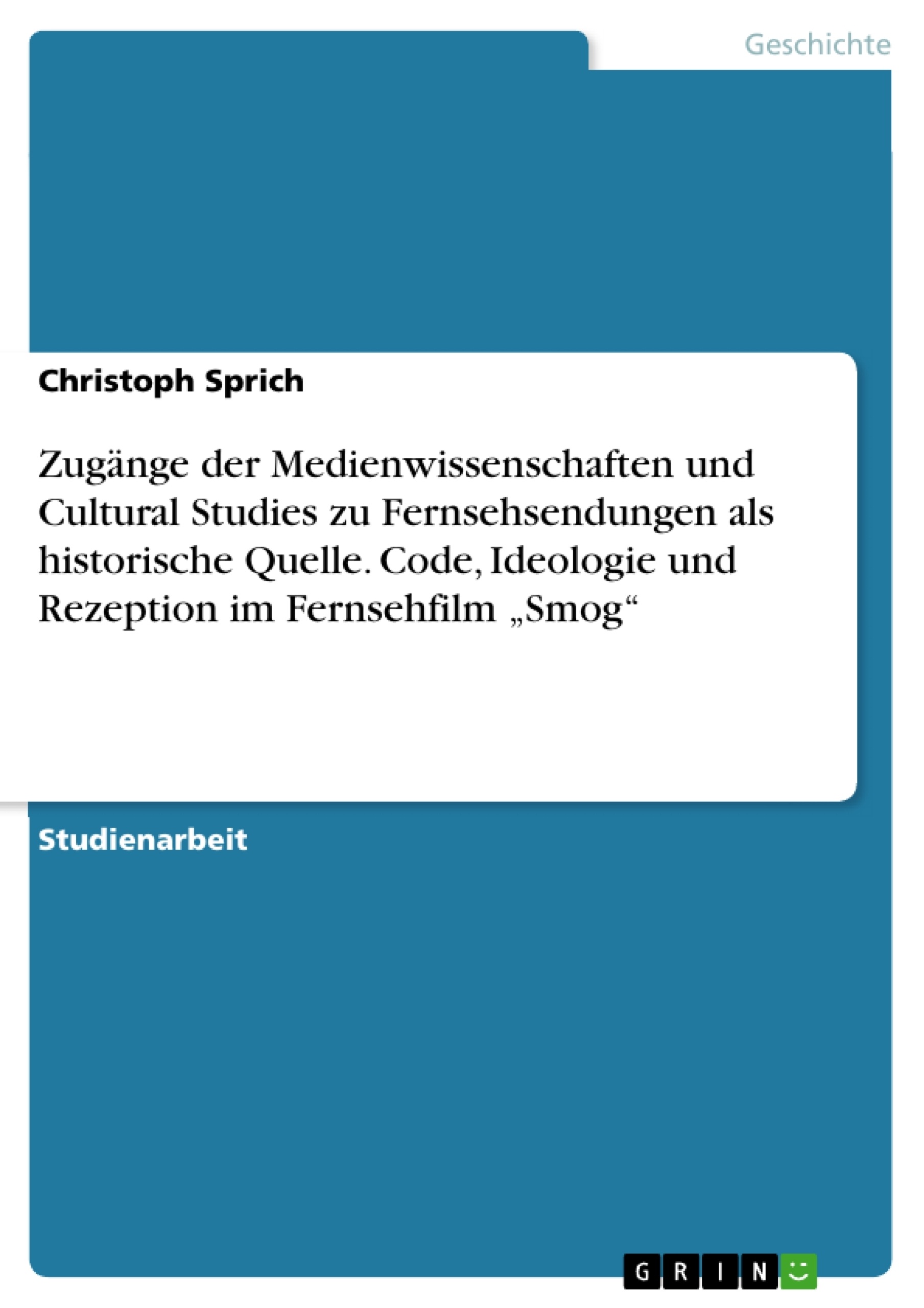Angesichts der zentralen Bedeutung, die audiovisuelle Medien wie der Kinofilm, das Radio und später vor allem das Fernsehen für die Alltagskultur des 20. Jahrhunderts innehaben, wurde in den Kulturwissenschaften ein pictorial turn und später ein iconic turn gefordert: Die in den Geisteswissenschaften vorherrschende Fokussierung auf reine Schriftzeugnisse sollte überwunden werden. Auch in der Geschichtswissenschaft setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass bewegte Bilder einen Quellenwert besitzen.
Die Annahme, dass das Massenmedium Fernsehen (und jedes andere Massenmedium) einem Spiegel der Gesellschaft gleicht, der relevante Themen und zugrunde liegende Einstellungen abbildet, bedarf einer Operationalisierung der medialen Funktion des Mediums. Dasselbe gilt für die Medienwirkungen, also den Wandel von Geisteshaltungen durch Einflussnahme auf die Zuschauer.
Einen Beitrag, um die „Medienblindheit“ der Geschichtswissenschaft zu erhellen, können die Medien- und Kommunikationswissenschaften liefern. Diese Arbeit soll den Film "Smog" unter Zuhilfenahme medienwissenschaftlicher Theorien analysieren. Dabei soll die Quelle umfassend in ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund verortet werden: Als medialer Ausdruck gesellschaftlicher Wahrnehmungsmuster, aber auch als Ergebnis des künstlerischen Schaffens der Beteiligten.
In der Analyse werden u.a. der narrative (Story und Dramaturgie), visuelle (Symbole, Komposition, Schnitt) und sprachliche Code (Dialoge) sowie Rezeption und Ideologischer Code im Film untersucht.
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
1 Medientheorien
1.1 Versuch einer Systematisierung und Vorauswahl, Forschungsüberblick
1.2 Medium und Medialität – Einige Grundannahmen
1.3 (Massen)Medien und Gesellschaft: Gesellschaftliche „Realität“ ist Medienrealität
1.4 Cultural Studies als Medienanalyse
1.4.1 Stuart Hall: Das „encoding/decoding“-Modell
1.4.2 John Fiske: Ideologie als Code
1.5 Filme und Fernsehsendungen als Zeichensysteme
1.6 Medientheorien in der geschichtswissenschaftlichen Quellenanalyse: Ein Zwischenfazit
2 Medienproduktanalyse: „Smog“
2.1 Der Film: Künstlerische Codes
2.1.1 Narrativer Code: Story und Dramaturgie
2.1.2 Visueller Code: Symbole, Komposition, Schnitt
2.1.3 Auditiver Code: Geräusche und Musik
2.1.4 Sprachlicher Code: Dialoge
2.2 Rezeptionsmöglichkeiten und Rezeption
2.3 Ideologische Codes und Diskurse im Film
Fazit
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis