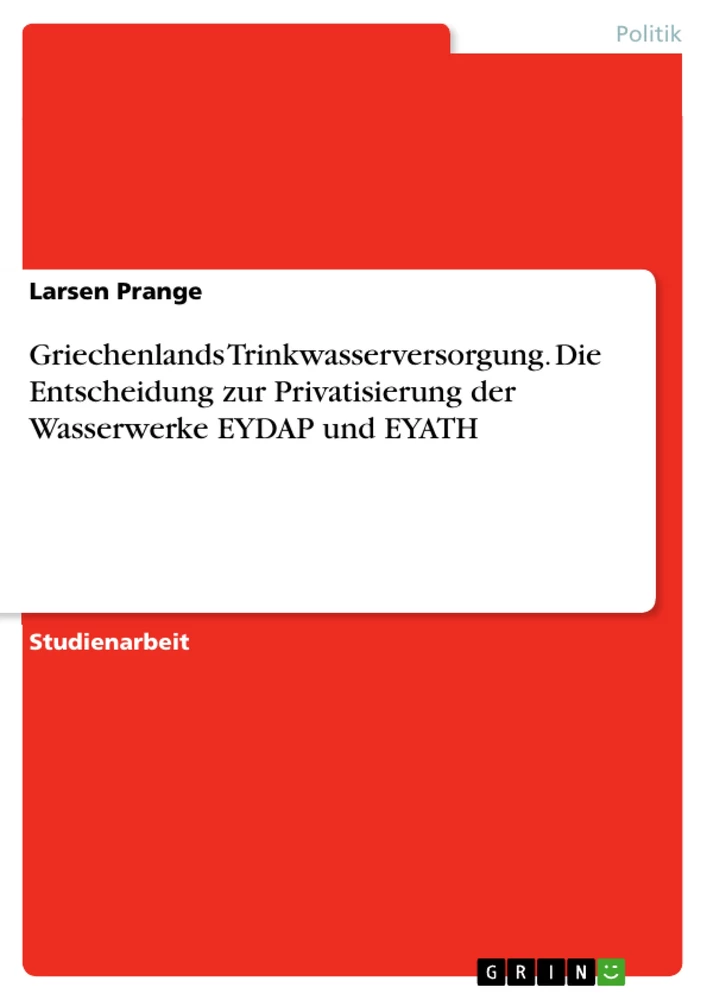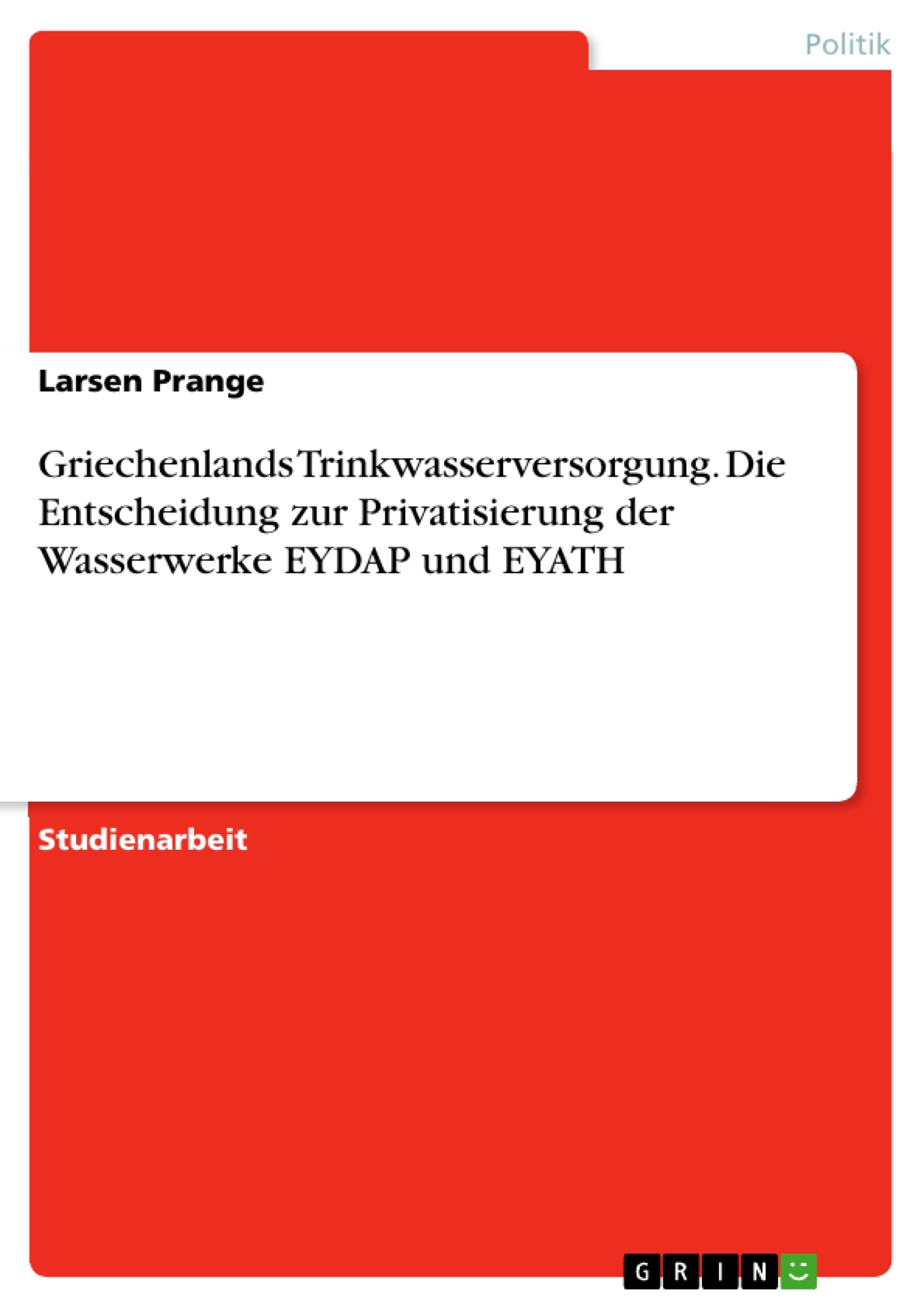Die Leitfrage dieser Arbeit lautet: Wie wurde die nationalpolitische Entscheidung Griechenlands zur Privatisierung der Wasserwerke EYDAP S.A. und EYATH S.A. von der Troika im Rahmen der Bekämpfung der Staatsschuldenkrise beeinflusst?
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Privatisierung der Wasserwerke EYDAP S.A. und EYATH S.A. als zu erklärende abhängige Variable (Explanandum). Im zweiten Kapitel wird daher aufgezeigt, welche Akteure bei der Erstellung der MoU eingebunden waren, welche Bestandteile der Wasserwerke EYDAP S.A. und EYATH S.A. privatisiert werden sollen und in welcher Form diese Privatisierung durchgeführt werden soll.
Durch die zu untersuchende Fallzahl von n = 1 (Griechenland) und das verfolgte Ziel der Untersuchung, ein besseres Verständnis für die Korrelation zwischen der Trinkwasser-Privatisierung und der wirtschaftlichen Abhängigkeit Griechenlands vom ESM (Explanans) sowie der damit verbundenen Einflussnahme der Troika auf die nationalpolitischen Entscheidungen Griechenlands (Explanans) zu erhalten, handelt es sich bei dieser Arbeit um eine qualitative Einzelfallstudie. Um anhand der genannten Korrelation den supranationalen Einfluss der Troika zu verdeutlichen, werden die unterschiedlichen Positionen internationaler, transnationaler und supranationaler Akteure zum Privatisierungsvorhaben in diesem Politikprozess skizziert, und die Abweichungen zu den Forderungen der Troika als supranationaler Handlungsakteur für den ESM dargestellt. Hierdurch wird aufgezeigt, inwieweit die Staatstätigkeit Griechenlands bezogen auf die Trinkwasser-Privatisierung in besonderem Maße von den Abstimmungen mit der Troika abhängt.
Als theoretische Grundlage für die Untersuchung wird im dritten Kapitel die Internationalisierungshypothese herangezogen und erläutert, welche die Annahme vertritt, „dass die Staatstätigkeit zunehmend vom Wandel der internationalen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Konstellationen beeinflusst wird“ (Reiter/Töller 2014). Aufgrund der eingeschränkten Erklärungskraft der Internationalisierungshypothese wird zusätzlich die sozio-ökonomische Theorienschule herangezogen, welche in der Staatstätigkeit eine „Reaktion auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen und auf hierin wurzelnde Funktionsprobleme politischer Gemeinwesen“ (Schmidt/Ostheim 2007) sieht. [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Privatisierung der Wasserwerke EYDAP S.A. und EYATH S.A.
2.1 Privatisierung
2.2 Die Wasserwerke EYDAP und EYATH
2.3 Griechenland und die Troika
3 Die theoretischen Grundlagen
3.1 Internationalisierungshypothese
3.2 Sozio-ökonomische Theorienschule
4 Fallanalyse
4.1 Staatsschuldenquote und Memorandum of Understanding
4.2 Reaktionen auf die Trinkwasserprivatisierung in Griechenland
5 Fazit und Ausblick
6 Literaturverzeichnis