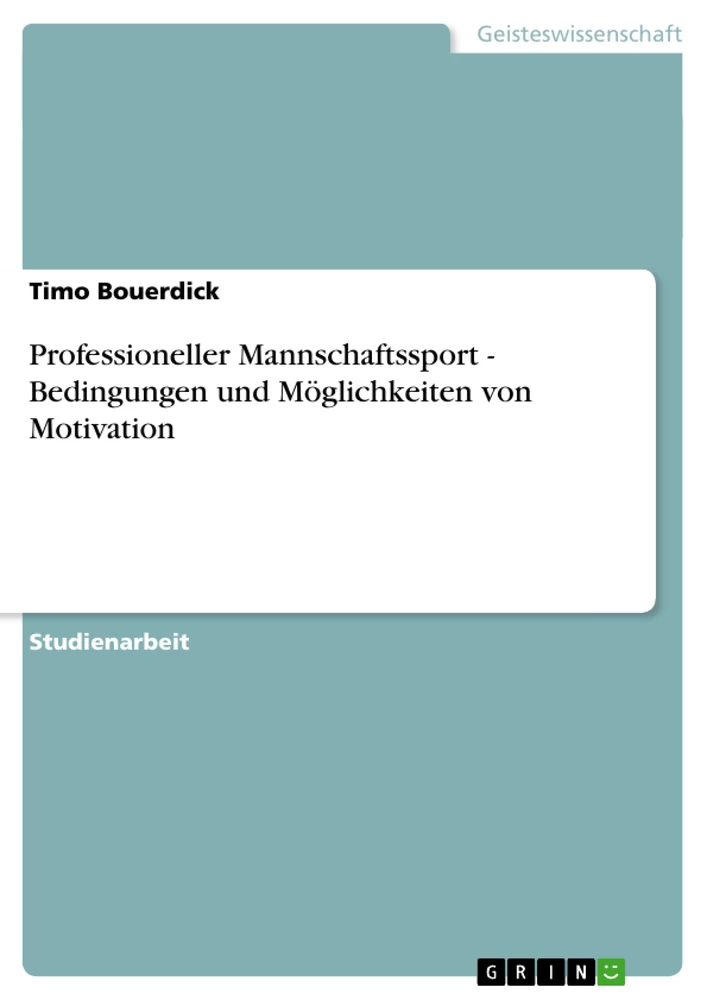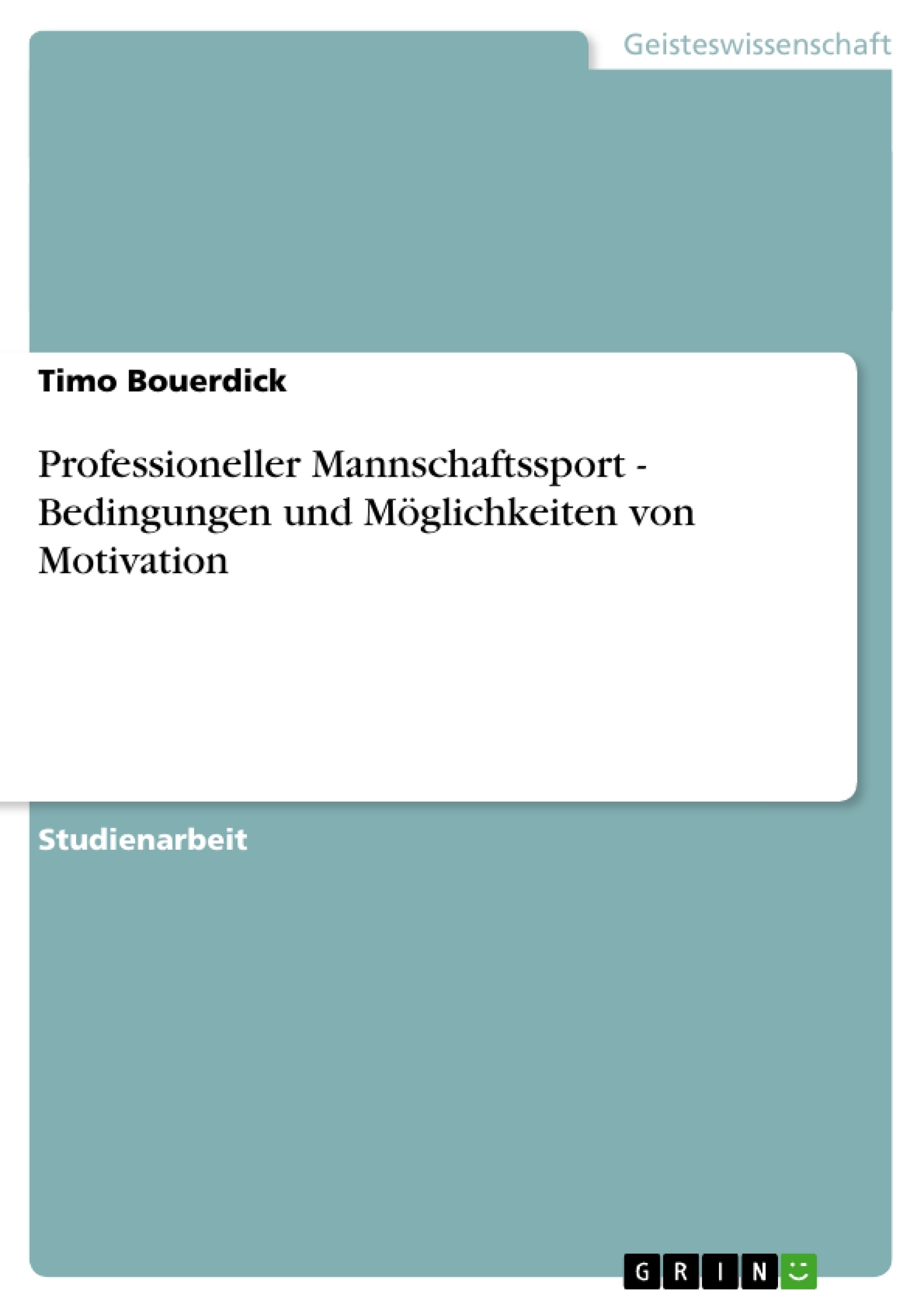Dieses Werk ist im Rahmen der Übung „Einführung in die Organisationssoziologie“ entstanden und behandelt die Thematik Motivation im professionellen Mannschaftssport. Zu Beginn werden die Begriffe Organisation und Motivation kurz dargestellt um daran anschließend diese in Verbindung mit professionellen Mannschaftssport zu bringen um Bedeutung und Potentiale von Motivation im diesem Sektor zu beschreiben. Es wird versucht die Bedingungen und Möglichkeiten von Motivation im Mannschaftssport, mit Beispielen des Fussballsports, darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Einführung
1.1 Was sind Organisationen
1.2 Was ist Motivation
1.2.1 Soziologische Perspektive
1.2.2 Psychologische Perspektive
1.2.3 Ökonomische Perspektive
1.2.4 Arten von Motivation
1.2.4.1 Intrinsische Motivation
1.2.4.2 Extrinsische Motivation
2. Der Sportverein als Organisation
2.1 Der professionelle Sportverein
2.2 Rahmenbedingungen des professionellen Teamsports
3. Motivation im professionellen Mannschaftssport
3.1 Motivation in Organisationen
3.2 Besonderheiten der Organisation Mannschaft
3.3 Intrinsiche Motivation
3.4 Extrinsische Motivation
3.4.1 Monetäres Anreizsystem im Profi-Fußball
3.4.2 Emotionale Anreize
3.4.3 Perspektivische Anreize
4. Fazit
4.1 Die Bedeutung von Motivation im Profisport
4.2 Die Potentiale von Motivation
Literaturverzeichnis
Einleitung
Diese Hausarbeit ist im Rahmen der Übung „Einführung in die Organisationssoziologie“ entstanden und behandelt die Thematik Motivation im professionellen Mannschaftssport.
Zu Beginn werden die Begriffe Organisation und Motivation kurz dargestellt um daran anschließend diese in Verbindung mit professionellen Mannschaftssport zu bringen um Bedeutung und Potentiale von Motivation im diesem Sektor zu beschreiben.
Sicherlich können hier nur ein erster Einblick und Anhaltspunkte gegeben werden, da allein der gesamte Bereich der Motivation den Umfang dieser Arbeit bei weitem überschreiten würde. Dennoch wird versucht die Bedingungen und Möglichkeiten von Motivation im Mannschaftssport, mit Beispielen des Fussballsports, darzustellen.
1. Einführung
1.1 Was sind Organisationen
Organisationen sind in ihrer Struktur zielgerichtete, geplante soziale Systeme.[1] Sie sind in der Regel „Zusammenschlüsse von Personen als Akteure“[2]. Diese Zusammenschlüsse haben mehrere gemeinsame Merkmale. Sie besitzen eine spezifische Zweckbestimmung, welche von den Akteuren durch Zusammenlegung von Ressourcen geschaffen wird. Ihre Gliederung erfolgt arbeitsteilig mit Zielrichtung auf den eigentlichen Zweck, zur Steuerung der Ressourcen und der Arbeitsteilung besitzen Organisationen eine Leitungsinstanz. Diese Merkmale finden sich in einer formalen oder informalen Verfassung wieder.
1.2 Was ist Motivation
1.2.1 Soziologische Perspektive
Motivation ist neben den Fähigkeiten und Fertigkeiten einer der wesentlichen Bestimmungsfaktoren des menschlichen Handelns.[3] Sie bestimmt über die Richtung, Intensität und Dauer unseres Handelns. Darüber hinaus ist die Motivation der eigentliche Initiator unseres Handelns.[4]
1.2.2 Psychologische Perspektive
Psychologisch betrachtet ist die Motivation ein Sammelbegriff für Prozesse und Effekte welche einen gemeinsamen Kern besitzen, dieser besteht darin das ein Individuum sein Verhalten an den erwarteten Folgen orientiert und hinsichtlich Richtung und Energieaufwand steuert.[5]
1.2.3 Ökonomische Perspektive
Aus dieser Perspektive heraus ist Motivation vor allem die Basis für hohe Leistung der Mitarbeiter.
Sie ist daher neben der fachlichen Qualifikation das entscheidende Moment für den unternehmerischen Erfolg.[6]
1.2.4 Arten von Motivation
Im Prinzip existieren in diesem Kontext zwei, sich gegenseitig beeinflussende, Arten von Motivation. Die intrinsische und die extrinsische Motivation, welche beide voneinander abhängig sind.[7]
1.2.4.1 Intrinsische Motivation
Unter intrinsischer Motivation versteht man der Person innewohnende Faktoren, zum Beispiel der Grad des Interesses an der Arbeit. Hierbei steht die eigentliche Aktivität oder deren Ziel eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung dar.
1.2.4.2 Extrinsische Motivation
Diese Art der Motivation hingegen bezieht sich auf Möglichkeiten externer Einflussnahme im Sinne eines Anreizes von außen, als Beispiel sei hier die Vergütung genannt. Hierbei geht es um die Möglichkeit mittelbarer oder instrumenteller Bedürfnisbefriedigung.
2. Der Sportverein als Organisation
Der Sportverein an sich ist als Organisation, grundlegend als Typus des Interessenverbandes[8], beschreibbar. Er ist seiner Struktur nach ein zielgerichtetes, auf die Ausübung von sportlichen Aktivitäten fixiertes, sowie geplantes soziales System, eine Mitgliederstruktur und ein geregeltes Sportangebot sind existent.
2.1 Der professionelle Sportverein
Im Besonderen trifft dies auf professionelle Sportvereine zu, diese sind zusätzlich zur Ausrichtung auf das Sportliche, als eigentliche Zweckbestimmung, vor allem ein Wirtschaftsunternehmen mit dementsprechendem Aufbau und organisationeller Struktur.
Daher existieren zwei Ebenen der Organisation, welche einen hohen Grad an circulärer Interdependenz aufweisen. Zumeist gibt es in beiden Bereichen, wirtschaftlich und sportlich, Leitungsinstanzen, welche allerdings in gegenseitiger Abhängigkeit stehen.
Beide erschaffen durch die im professionellen Vereinssport existenten Abhängigkeiten zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Ergebnissen ein direktes, dynamisches Zusammenspiel von Erfolg und Misserfolg mit gegenseitiger Beeinflussung, wobei der sportliche Erfolg als basal anzusehen ist.
Die Gewinnmaximierung als Unternehmensziel ist daher ebenfalls auf beiden Ebenen existent, einmal als maximaler sportlicher Erfolg und einmal als maximaler finanzieller Gewinn.
[...]
[1] K. Heinemann 1990: Einführung in die Soziologie des Sports. Hofmann Verlag, S.31
[2] M. Abraham/ G. Büschges 2004: Einführung in die Organisationssoziologie. Verlag für Sozialwissenschaften, S.21
[3] Vgl. U. Kleinbeck / H.-H. Quast 1992: „Motivation“ Sp.1420 f. in: E. Frese (Hrsg.): Handbuch Organisation. Stuttgart, Sp. 1419-1434
[4] Vgl. G. Comelli / L. von Rosenstiel 1995: Führung durch Motivation. Becksche Verlagsbuchhandlung, S. 6 f.
[5] Vgl. H. Heckhausen 1989: Motivation und Handeln. Springer Verlag, S.10
[6] Vgl. R. Niermeyer 2001: Motivation: Instrumente zur Führung und Verführung. Haufe, S.9 f.
[7] Vgl. B. Frey/M. Osterloh 2000: Managing Motivation. Gabler Verlag, S.21, S. 24
[8] Vgl. U. Wilkesmann/ D. Blutner/ C. Meister 2002: „Der Fussballverein zwischen e.V und Kapitalgesellschaft“ S.1 in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 54. Jg., Heft 4, 2002, S. 753-774