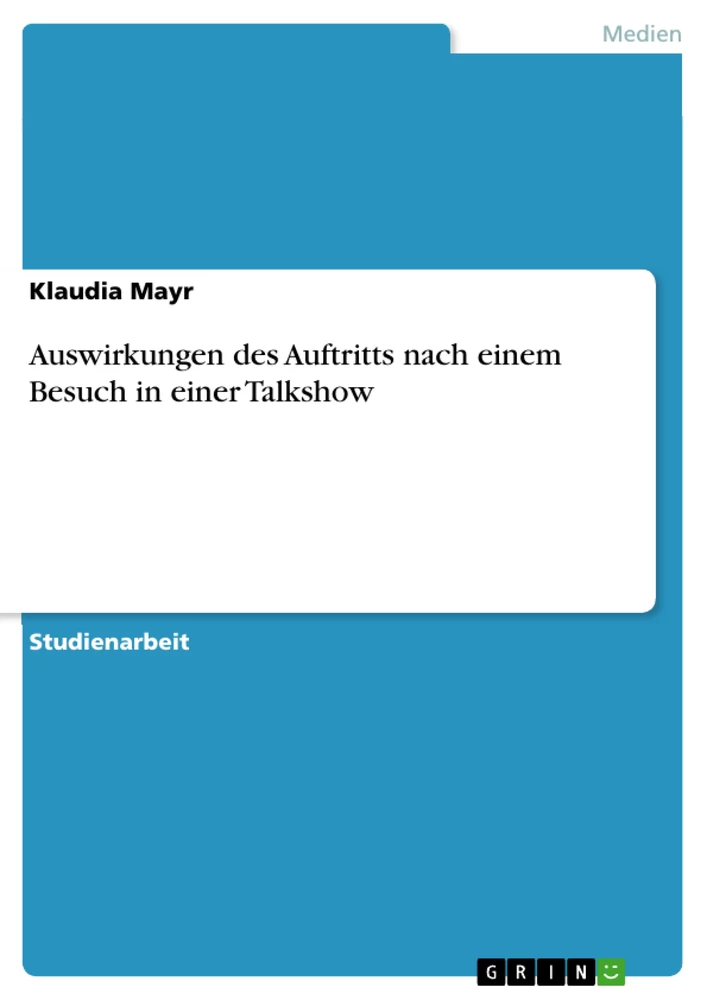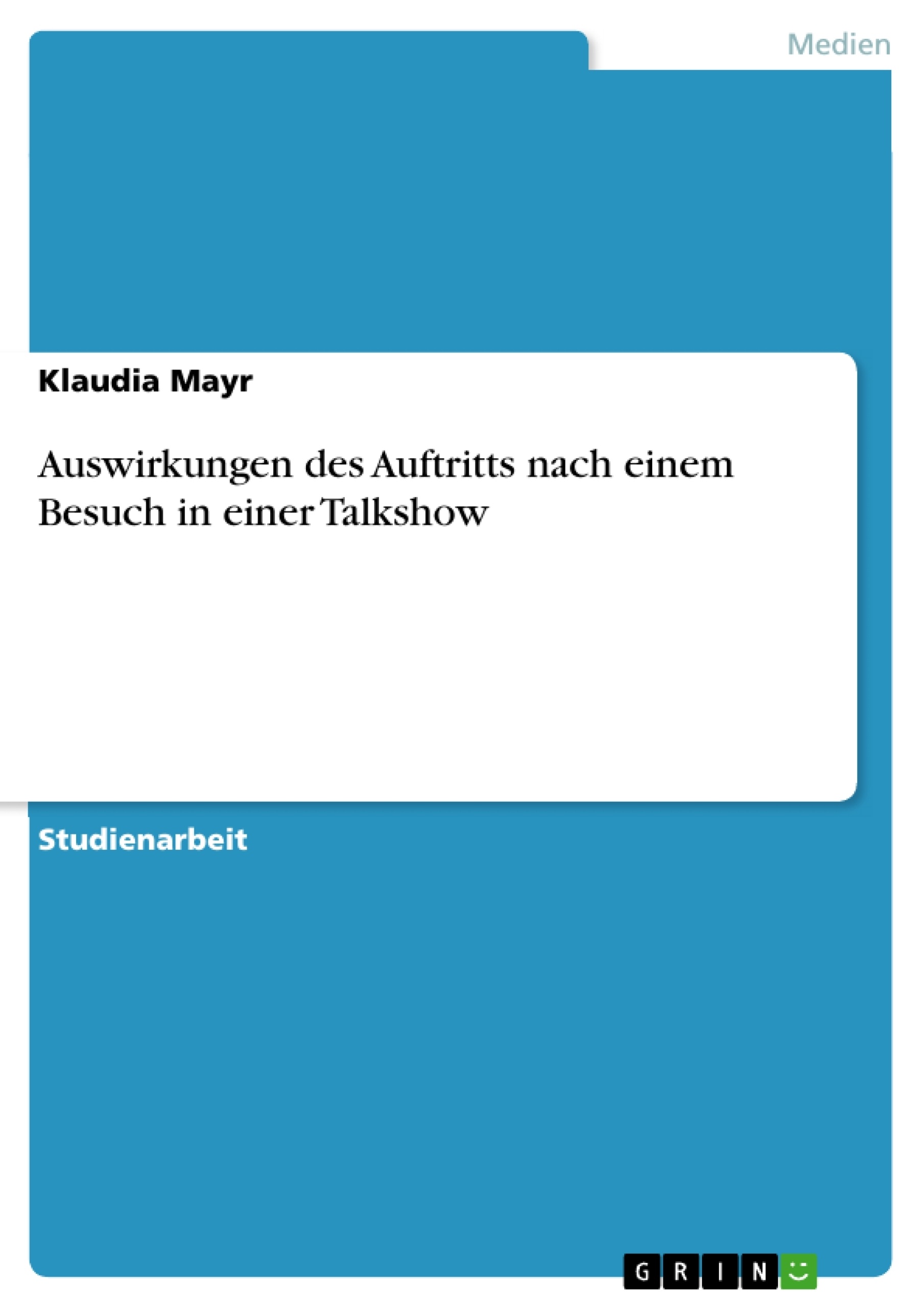Einleitung
Seit vielen Jahren schon, nehmen Talkshows einen hohen Stellenwert im Nachmittags- und Abendprogramm des deutschen Fernsehers ein.
Aber wie kommt es, daß das Fernsehen, was früher nur ein Fenster zur weiten Welt war, heute zu einer Bühne der kleinen und einfachen Leute wird ?
Wie kommt es, daß sich so viele Menschen darum reißen in einer Talkshow aufzutreten und offen über ihre persönlichen Probleme zu sprechen ?
Nun, nicht alle Menschen merken, daß Talkshows kein informatives oder aufklärendes Medium ist, in dem tiefgründige Diskussionen über eine bestimmte Fragestellung geführt werden. Statt dessen handelt es sich um Sendungen, deren Themenkomplexe Beziehungen, Familie, Gesundheit und Schönheit entstammen und von alltäglichen und banalen Problemen bis hin zu schwerwiegenden psychologischen Problemen, die eher in eine Therapie als in eine Talkshow gehören, reichen. Und dennoch werden die Sendungen, die von den Emotionen leben, die sie bei den Gästen, dem Publikum und den Zuschauern auslösen, im hohen Maße konsumiert.
Ein genauer Blick zeigt aber, daß im Kontrast zu dem außerordentlichen Erfolg der neuen Formate beim Massenpublikum sich inzwischen eine scharfe Medienkritik formatiert hat, die in den allzu persönlichen Gesprächen und der öffentlichen Zurschaustellung aller möglichen körperlichen und seelischen Normvarianten nicht die oft propagierte Lebenshilfe für Studiogast und Zuschauer sieht, sondern vielmehr eine Gefahr für Moral und Anstand.
Dieser Tendenz scheinen Menschen zu unterliegen, die sich selbst in einer eher kritischen Distanz zu medialen Angeboten, vor allem dem Fernsehen gegenüber, sehen. Diese schieben eine potentielle Opferrolle denen zu, die entweder aufgrund ihrer prinzipiell mangelnden analytischen Distanz, ihrer schlechten soziokulturellen Ausgangsposition oder auch einer noch nicht voll entwickelten intellektuellen und/oder emotionalen Widerstandsfähigkeit der Macht der Bilder sozusagen schutzlos ausgeliefert sind. Es verwundert daher nicht, daß aus vielen Quellen in diesem Zusammenhang von einem ,,geistig weniger differenzierten Zuschauer" gesprochen wird, oder es handelt sich um Kinder und Jugendliche.
[...]
Inhalt
Einleitung
1. Charakteristika des Genres Affektfernsehen
2. Affektfernsehen-Formate und verwandte Genres
- Affekt-Talks
- Beziehungsshows
3. Intimes und Privates in der Massenkommunikation
4. Sozio-emotionale Wirkungen des (Affekt-)Fernsehens
5. Motivkatalog der Rezipienten
6. Nutzungsmotive: ausgewählte Forschungsbefunde
7. Motivtypen nach Bettina Fromm
- Der Fernseh-Star
- Der Patient
- Der Kontaktanbahner/Verehrer
- Der Ideologe
- Der Propagandist
- Anwalt in eigener Sache
- Rächer
- Der Zaungast
8. Auswirkungen des Auftritts
- Durchsetzung der Motive
- Unmittelbare Eindrücke
- Das Bild vom Fernsehmacher und die Betreuung während der Sendung
- Das Bild vom Moderator
- Soziale Wirkungen des Auftritts
- Selbsteinschätzung und abschließende Bewertung des Auftritts
9. Zusammenfassung der Eindrücke
10. Interview mit Adam
11. Ergebnisse des Interviews
12. Schlußbemerkungen
13. Quellen
Auswirkungen des Auftritts nach einem Besuch in einer Talkshow
Einleitung
Seit vielen Jahren schon, nehmen Talkshows einen hohen Stellenwert im Nachmittags- und Abendprogramm des deutschen Fernsehers ein.
Aber wie kommt es, daß das Fernsehen, was früher nur ein Fenster zur weiten Welt war, heute zu einer Bühne der kleinen und einfachen Leute wird ?
Wie kommt es, daß sich so viele Menschen darum reißen in einer Talkshow aufzutreten und offen über ihre persönlichen Probleme zu sprechen ?
Nun, nicht alle Menschen merken, daß Talkshows kein informatives oder aufklärendes Medium ist, in dem tiefgründige Diskussionen über eine bestimmte Fragestellung geführt werden. Statt dessen handelt es sich um Sendungen, deren Themenkomplexe Beziehungen, Familie, Gesundheit und Schönheit entstammen und von alltäglichen und banalen Problemen bis hin zu schwerwiegenden psychologischen Problemen, die eher in eine Therapie als in eine Talkshow gehören, reichen. Und dennoch werden die Sendungen, die von den Emotionen leben, die sie bei den Gästen, dem Publikum und den Zuschauern auslösen, im hohen Maße konsumiert.
Ein genauer Blick zeigt aber, daß im Kontrast zu dem außerordentlichen Erfolg der neuen Formate beim Massenpublikum sich inzwischen eine scharfe Medienkritik formatiert hat, die in den allzu persönlichen Gesprächen und der öffentlichen Zurschaustellung aller möglichen körperlichen und seelischen Normvarianten nicht die oft propagierte Lebenshilfe für Studiogast und Zuschauer sieht, sondern vielmehr eine Gefahr für Moral und Anstand.
Dieser Tendenz scheinen Menschen zu unterliegen, die sich selbst in einer eher kritischen Distanz zu medialen Angeboten, vor allem dem Fernsehen gegenüber, sehen. Diese schieben eine potentielle Opferrolle denen zu, die entweder aufgrund ihrer prinzipiell mangelnden analytischen Distanz, ihrer schlechten soziokulturellen Ausgangsposition oder auch einer noch nicht voll entwickelten intellektuellen und/oder emotionalen Widerstandsfähigkeit der Macht der Bilder sozusagen schutzlos ausgeliefert sind. Es verwundert daher nicht, daß aus vielen Quellen in diesem Zusammenhang von einem „geistig weniger differenzierten Zuschauer“ gesprochen wird, oder es handelt sich um Kinder und Jugendliche.
Genau deshalb, möchte ich in dieser Arbeit untersuchen, wer sich in Talkshows begibt, was er sich davon erhofft und welche Auswirkungen der Auftritt nachträglich für denjenigen in seiner Umwelt hat.
Dabei möchte ich zuerst zentrale Begrifflichkeiten und Merkmale des Genres Affektfernsehen klären.
1. Charakteristika des Genres Affektfernsehen
Das Affektfernsehen erhebt den Anspruch, Realität abzubilden oder gar zu inszenieren, wie z.B. in Beziehungsshows und Suchsendungen. Vornehmlich unprominente Menschen veröffentlichen hier ihre eigene Person bzw. ihr persönliches Schicksal im authentischen Bericht und/oder in der direkten Selbstdarstellung vor der Kamera.
Hier werden die „wahren“ Geschichten der unprominenten Personen je nach Sendekonzept entweder erzählt oder zum Zwecke der medialen Verbreitung vor einer Kamera inszeniert.
Die Thematisierung häufig sehr intimer Inhalte geht teilweise mit einer emotionalisierenden medientechnischen Präsentationsweise einher, bei der die Akteure nicht selten in starkbewegten Momenten in der Großaufnahme gezeigt werden. Der Live-Charakter der Sendungen, der dem Rezipienten das Gefühl vermittelt, dabei zu sein, kann durch verschiedenste Gestaltungsmittel intensiviert werden, beispielsweise durch die Anwesenheit von Studiopublikum (das sich teilweise am Ablauf beteiligen kann), durch Call-in-Aktionen, durch den direkten Appell an den Zuschauer oder auch durch medial inszenierte Überraschungen.
Ein weiteres Charakteristikum, die Personalisierung, erstreckt sich nicht nur auf die mehr oder weniger schicksalhaften Geschichten, die anhand von unprominenten Einzelfällen illustriert werden, sondern auch auf die Person des Moderators, der ein Klima der Vertrautheit und der Verläßlichkeit schaffen will.
Bei der Intimisierung werden vormals eindeutig im privaten Bereich liegende persönliche Belange und Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen zum öffentlichen Thema.
Außerdem betonen diese Sendungen den emotionalen Aspekt der Geschichten, nämlich das persönliche Erleben und Empfinden, aber weniger die Sachaspekte.
2. Affektfernsehen-Formate und verwandte Genres
Auf der Grundlage der herausgebildeten Merkmale lassen sich nun verschiedene Formate differenzieren, die dem Genre „Affektfernsehen“ in der Definition zuzurechnen sind und die in jeweils spezifischer Ausprägung auf die verschiedenen Stilmittel zugreifen: Affekt-Talk, Beziehungsshow, Spielshow, Suchsendung, Konfro-Talk, Infotainment und Reality-TV. Die drei letztgenannten Formate sind eher randständig im Sinne der Definition, weisen jedoch einige Gemeinsamkeiten mit dem Affektfernsehen auf.
Hier sind nun einige Beispiele für die unterschiedlichen Formate:
- Affekt-Talks: „Hans Meiser“, „Ilona Christen“, „Fliege“, „Arabella“
- Beziehungsshows: „Verzeih mir“, „Nur die Liebe zählt“, „Surprise Show“
- Spielshows: „Herzblatt“, „Geld oder Liebe“, „Flitterabend“, „Traumhochzeit“
- Suchsendungen „Vermißt!“, „Bitte melde Dich!“
- Konfro-Talks: „Explosiv — der heiße Stuhl‘, „Einspruch!“
Ich werde mich heute besonders auf die Affekt-Talks und Beziehungsshows konzentrieren.
Affekt-Talks
Seit 1992 gibt es nun im deutschen Fernsehen Sendungen, in denen nicht Prominente zum Zwecke der Publicity-Gewinnung auftreten, sondern unprominente Menschen.
Diese berichten über authentische und häufig sehr private Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Das Thema hat dabei selten einen gesellschaftsrelevanten Bezug.
Die als „Affekt-Talk“ benannten Talkshows zeichnen sich durch weitere Besonderheiten aus, z.B. in bezug auf Sendezeit und -häufigkeit. Mit der Übernahme der amerikanischen Programmstruktur durch den Sender RTL im Jahre 1992 etablierte sich das Konzept der (werk-)täglich ausgestrahlten Talkshow auch auf dem deutschen Fernsehmarkt. Dabei wurde die Sendezeit vom Abend auf den Nachmittag verlagert. Nach der schnellen Etablierung des Vorreiters „Hans Meiser“ (RTL) folgte ein Jahr später „Ilona Christen“ (RTL). Hinzu kommen immer neue tägliche Affekt-Talks auf fast allen Programmen: „Arabella“ (Pro 7), „Fliege“ (ARD), „Bärbel Schäfer“ (RTL), „Vera am Mittag“ (SAT.l), „Kerner“ (SAT.l) u.a.m.
Durch die regelmäßige Ausstrahlung etablieren sich die Sendungen im Bewußtsein der Rezipienten als feste Einrichtung, und werden „für den Zuschauer zu einer zuverlässigen Größe, die in den Alltag eingeplant werden kann“ (Fromm, 1995).
Darüber hinaus sind auch die Titel der Formate kennzeichnend: „Daß die nachmittäglichen Talkshows den Namen ihrer Gastgeber tragen, ist kein Zufall oder simpler Mangel an Ideen. Mehr noch als jedes andere Programm leben die Sendungen von ihrem frontface“ (EPD/ Kirche undRundfunk, 8/1994). Die Moderation als personalisierte Präsentationsform des Mediums Fernsehen stellt „den personalen Bezug zwischen Programm und Publikum dar: Durch ihn [den Moderator] kommt eine Sendung ins Haus, er ist das erkennbare, wiederkehrende Menschliche“ (Buchwald, 1984). Für den Zuschauer wird er zur „imageprägenden Identifikationsfigur“ (vgl. Steinbrecher & Weiske, 1992).
Die Gespräche, die die Moderatoren mit ihren Gästen führen, weisen auf die „Inszenierung von Nähesprache“ (Holly & Schwitalla, 1995) und damit auf die „Intimisierung der öffentlichen Kommunikation“ (Holly & Püschel, 1993) im Medium „Fernsehen“ hin. Alltagsnahe und enthemmte Umgangsformen werden im Affekt-Talk — sowohl von den Gästen als auch von den Moderatoren — zunehmend praktiziert und vermitteln dem Zuschauer den authentischen Charakter der Sendungen. Dieser Eindruck wird durch die Anwesenheit eines Studiopublikums noch intensiviert.
In neueren Formaten, wie z.B. bei „Bärbel Schäfer“, wird das Studiopublikum im Sinne der „audience participation“ zunehmend am Gespräch beteiligt.
Affekt-Talks beinhalten alle Charakteristika des Affektfernsehens und stehen somit im Zentrum meiner heutigen Analyse.
Sie enthalten viele Elemente der alltäglichen zwischenmenschlichen Kommunikation.
Zwar ist das Gespräch zwischen dem Moderator und seinem unprominenten Gast in eine Sendungsdramaturgie eingebunden, aber es wird weder durch Showelemente in seinem alltagsnahen Charakter beeinträchtigt, noch werden die Inhalte zum Zwecke der medialen Verbreitung inszeniert. Realitäten, die die Gäste erlebt haben und anderen mitzuteilen bestrebt sind — aus welchen Gründen auch immer —‚werden vom Fernsehen aufgegriffen. Auch wenn die Themen sich insgesamt auf alle Bereiche des Lebens erstrecken, stehen häufig sehr persönliche und intime Belange der unprominenten Gäste im Vordergrund.
Beziehungsshows
Während beispielsweise in den täglichen Talk-Shows von den vornehmlich unprominenten Personen Erlebtes berichtet wird, gehen die Beziehungsshows einen Schritt weiter.
Sie greifen im Moment der Aufzeichnung in authentische Schicksale ein und inszenieren diese zum Zwecke der medialen Verbreitung (vgl. Winteri-off-Spurk, Heidinger & Schwab, 1994). Auch wenn es sich hier in keinem Falle um Live-Sendungen handelt, wird der Live-Charakter und damit die Authentizität des Dargestellten durch die Anwesenheit eines Studiopublikums sowie das dramaturgische Moment der Überraschung betont. Die Formate „Verzeih mir“, „Surprise Show“ und „Nur die Liebe zählt“ präsentieren sowohl Gäste mit großen Schicksalen als auch mit kleinen Wünschen, inszenieren Versöhnungen und Beziehungsanbahnungen.
Insbesondere die Sendungen „Verzeih mir“ und „Nur die Liebe zählt“ folgen dem Konzept, in dem „Realkonflikte der Zuschauer dargestellt und teilweise zu einer Lösung gebracht werden sollen. Nach Wegner (1994 ) zeichnen sich diese Shows dadurch aus, daß sie „ein Konzentrat an Emotionen bieten mit der zusätzlichen Garantie des Realen“. Leider kommt es hier aber oft zu einer Verschiebung öffentlicher und privater Zuständigkeitsbereiche.
Nach dem ich die beiden Genres vorgestellt habe, mit denen ich mich heute befassen möchte, werde ich jetzt einige zentrale sozial- und kommunikationswissenschaftliche Grundpositionen zum Thema „Intimes und Privates in der Massenkommunikation“ umreißen, um für ein besseres Verständnis der besonderen Wirkmechanismen des Affektfernsehen beizutragen.
3. Intimes und Privates in der Massenkommunikation
Privatheit und Intimsphäre bezeichnen die Bereiche einer Person, die nicht öffentlich und daher nicht für jedermann zugänglich sind.
Dieses Verständnis hat sich aber gewandelt, und so gewähren Radio und Fernsehen immer mehr einen Einblick in die Privatheit der Menschen, und machen es dadurch öffentlich. Das Private wird nach Außen gekehrt und vor Millionen von Zuschauern präsentiert. Und so fasziniert das Fernsehen die Menschen, die in den Shows das Intime zum öffentlichen Gegenstand machen. Dadurch wird die Öffentlichkeit zu einem Ort der Intimität und gelangt dann in die Wohnzimmer der Zuschauer.
Vor allem, weil das Fernsehen die Fähigkeit hat, räumliche und zeitliche Grenzen zu überwinden, eignet es sich besonders dazu, die sozialen Realitäten anschaulich darzustellen.
Und so stößt das Fernsehen immer mehr in die Räume des Privaten und Intimen, denn nur dieses Medium neigt so sehr zu einer Personalisierung. Und weil diese auf Visualisierung angewiesen ist, bracht das Fernsehen Menschen, die Mut und Angst, Liebe und Haß, Freude und Trauer, Hoffnung und Resignation zum Ausdruck bringen können. Und da sich Leidenschaften vornehmlich im persönlichen Nahraum entwickeln, dringt das Fernsehen mit seinem Bedarf an ausdrucksstarken Bildern immer mehr in die Privatsphäre des Menschen ein.
Im Fernsehen steht besonders die authentische Gefühlsregung und die dramaturgische Handlung im Vordergrund. Außerdem liefert das Fernsehen ähnliche Informationen öffentlich und oft gleichzeitig an alle sozialen Gruppen. Sei es an Kinder, Erwachsene, Männer oder Frauen, sie alle haben die Möglichkeit über jedes Thema aus dem Fernsehen informiert zu werden. Ob in einer Talkshow oder in einer Werbung angesprochenes Thema, kann am nächsten Tag zu einem Gesprächsthema in der Schule oder am Arbeitsplatz werden, da es keine Tabuthemen mehr gibt. Früher unterhielt man sich über ein Tabuthema in seiner eigenen sozialen Gruppe, aber aufgrund des Fernsehens geht der Gedanke verloren, daß es überhaupt irgendwelche Tabuthemen gibt.
Die Massenmedien präsentieren sich heute nach der Auffassung von HABERMAS als „.Adressaten für persönliche Nöte und Schwierigkeiten, als Autoritäten der Lebenshilfe: Sie bieten reichlich Gelegenheit zu Identifikationen – zu einer Art Regeneration des privaten Bereichs aus dem bereitgestellten Fond öffentlicher Ermunterungs- und Beratungsdienste.“ Und so wird die Seelennot und andere persönlichen Nöte und Ängste der Menschen medial inszeniert, weil sie sich dadurch professionelle Hilfe, Betreuung oder Therapie erhoffen.
Und weil das Fernsehen diese menschliche, beratende und therapeutische Hilfe bietet, begeben sich immer mehr Menschen in das Fernsehen, um dort ihre Intimität ganz bewußt in der Öffentlichkeit preiszugeben.
Sie reden über alltägliche Schwierigkeiten in der Schule oder Beruf, über Partnerschaften und sexuelle Probleme oder andere tiefe Lebenskriesen. Und da sich das Spektrum der Sendeformate von Dokumentationen und Magazinen, die über seelische Leiden und ihre Behandlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten informiert, über psychologische Ratgebersendungen und ausgewiesene Lebenshilfemagazine bis hin zu Zusammenschnitten realer Gruppentherapie-Sitzungen und Live-Übertragungen psychotherapeutischer Einzel- und Paargespräche erstreckt, scheint es für jeden intimen Inhalt eine Lösung zu geben.
Jürgen Fliege beschreibt in diesem Zusammenhang die Intention seiner Gespräche in seiner Sendung wie folgt: "„Mit dieser Erfahrung extremer Zuwendung, hoffe ich nicht ohne Grund und entsprechendes feed back unserer Gäste, daß sie, wie mit einem geänderten Vorzeichen und ihrem oft eingeklammerten Leben, alles neu gewichten und wieder ins Gleichgewicht gelangen“.
[...]