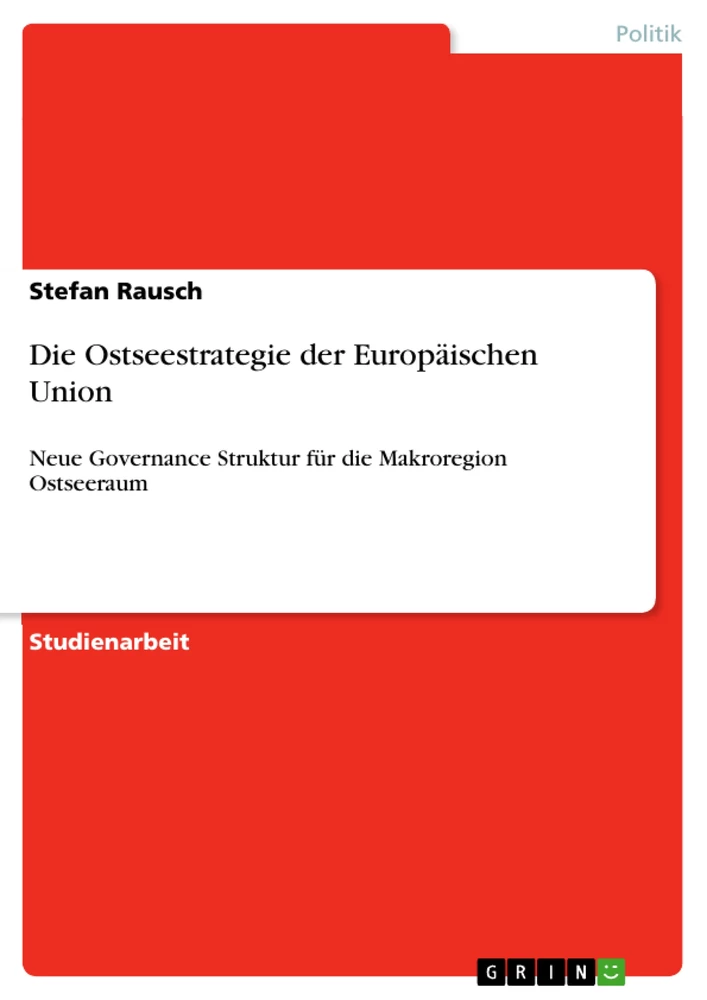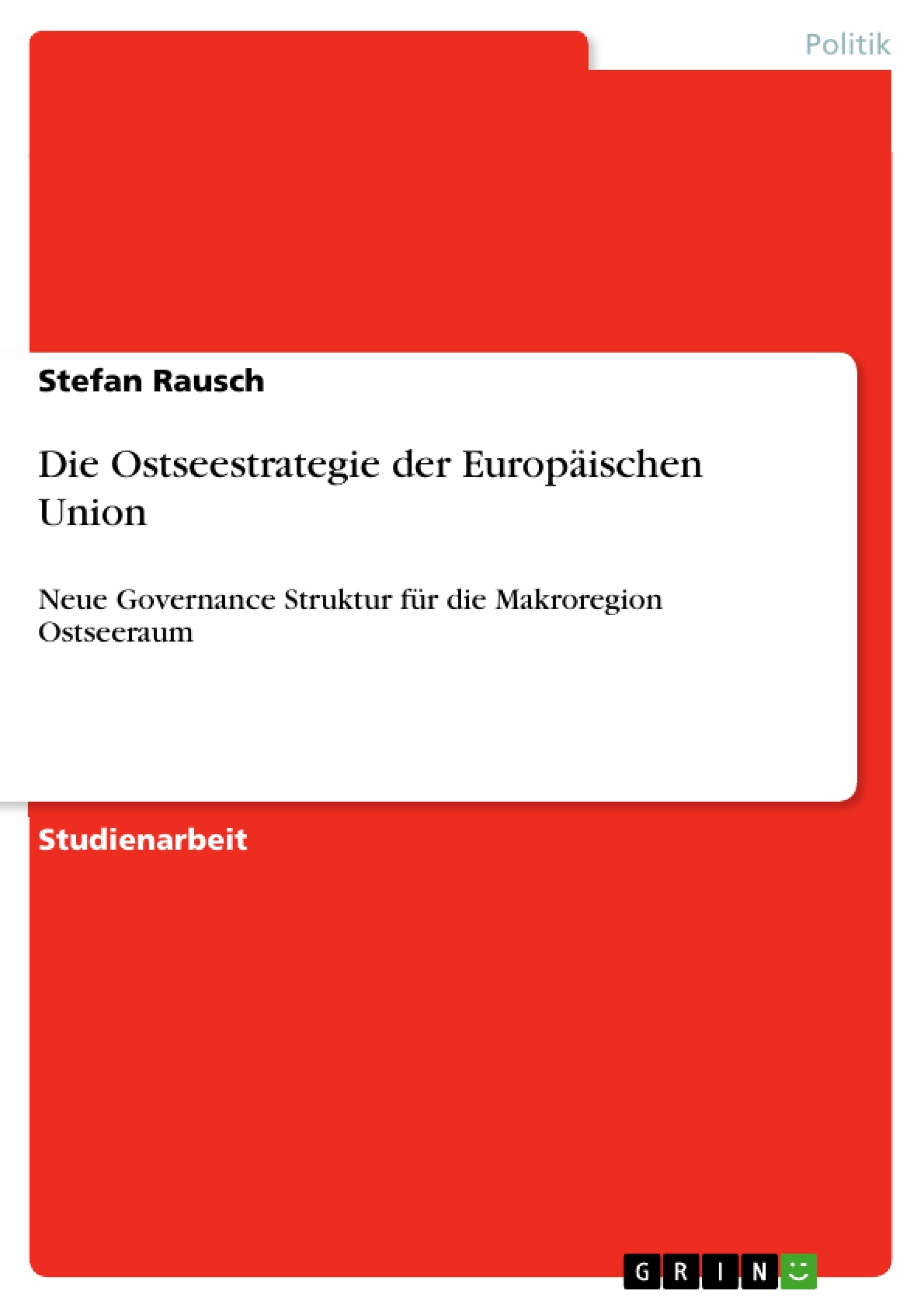Die Ostseeraumkooperation blickt auf eine lange Tradition zurück. Die Hanse mit ihren wirtschaftlich und kulturell vernetzten Mitgliedern prägte bis zu ihrem Ende Mitte des 17. Jahrhunderts den Ostseeraum. Die exakten Grenzen der Region sind dabei ungenau definiert. Sie kann als 1,5 Mio. km² großes und mit 50-60 Mio. Menschen bevölkertes Gebiet verstanden werden, mit einem 415.000 km² großem Binnenmeer – der Ostsee.
Nach den beiden Erweiterungsrunden 1995 (Schweden, Finnland) und 2004 (Polen, Litauen, Lettland, Estland) sind acht von neun direkten Anrainern Mitglieder der Europäischen Union, womit die Ostsee eine „quasi- Binnenmeer“ der Union geworden ist. Ausgehend von der nach 2004 entstandenen Situation stellt die Ostseestrategie der EU (European Union Strategy for the Baltic Sea Region; EUSBSR) die erste makroregionale Strategie ihrer Art dar. Sie knüpft an ein bereits etabliertes, auf mehreren Ebenen existentes Organisations- und Kooperationsnetz. Durch die Strategie eröffnete sich eine neue transnationale Struktur der Governance in der Region, die erstmals direkt von der EU initiiert wurde. Nach der Idee des Europäischen Parlaments, dem Ersuch des Europäischen Rates sowie dem von der EU- Kommission geleiteten Konsultationsprozess wurde sie im Herbst 2009 vom EURat verabschiedet. Eine zweite Strategie für den Donauraum läuft seit Anfang 2011 an.
In dieser Arbeit wird der Fokus auf die politische Steuerung der EUSBSR im Mehrebenensystem Ostseeraum gelegt. Es gilt zu überprüfen, inwiefern diese neue Möglichkeit von ebenenübergreifender Kooperation überhaupt innovativ ist, inwieweit bisherige Erfolge zu verbuchen sind und wo der generelle Mehrwert für die Ostseeraumkooperation liegt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Mehrebenensystem Ostseeraum
2.1 Der Ostseeraum im Blickfeld der EU nach
2.2 Multilevel Governance und EU- Governance
In2.2.1 Multilevel Governance
In2.2.2 Governance in der EU
3. Die Struktur der EU-Ostseestrategie
3.1 Entstehung der makroregionale Strategie
In3.1.1 Begriffsklärung Makroregion
In3.1.2 Entstehungsprozess der Ostseestrategie
3.2 Aufbau und Inhalt der EUSBSR
In3.2.1 Organisationsstruktur und Inhalt
In3.2.2 Die drei „Neins“
4. Die EUSBSR als neue Form der Governance?
4.1 Governance der EUBSR
In4.1.1 Ebenen der politische Steuerung
In4.1.2 Multilevel Governance
In4.1.3 Interne und externe Dimension
4.2 Evaluation und Kritik an der EUSBSR
In4.2.1 Erste interne Evaluationen 2010 und 2011
In4.2.2 Defizite der Strategie
5. Ausblick: EUSBSR - ein Mehrwert für die EU?
Abkürzungsverzeichnis
Anhang
Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Die Ostseeraumkooperation blickt auf eine lange Tradition zurück. Die Hanse mit ihren wirtschaftlich und kulturell vernetzten Mitgliedern prägte bis zu ihrem Ende Mitte des 17. Jahrhunderts den Ostseeraum. Die exakten Grenzen der Region sind dabei ungenau definiert. Sie kann als 1,5 Mio. km² großes und mit 50-60 Mio. Menschen bevölkertes Gebiet verstanden werden, mit einem 415.000 km² großem Binnenmeer – der Ostsee.[1]
Nach den beiden Erweiterungsrunden 1995 (Schweden, Finnland) und 2004 (Polen, Litauen, Lettland, Estland) sind acht von neun direkten Anrainern Mitglieder der Europäischen Union[2] (Im Folgenden: EU), womit die Ostsee eine „quasi- Binnenmeer“[3] der Union geworden ist. Ausgehend von der nach 2004 entstandenen Situation stellt die Ostseestrategie der EU (European Union Strategy for the Baltic Sea Region; EUSBSR) die erste makroregionale Strategie ihrer Art dar. Sie knüpft an ein bereits etabliertes, auf mehreren Ebenen existentes Organisations- und Kooperationsnetz. Durch die Strategie eröffnete sich eine neue transnationale Struktur der Governance in der Region, die erstmals direkt von der EU initiiert wurde. Nach der Idee des Europäischen Parlaments (Im Folgenden EUParl) dem Ersuch des Europäischen Rates (Im Folgenden: EURat) sowie dem von der EU- Kommission (Im Folgenden EUKom) geleiteten Konsultationsprozess wurde sie im Herbst 2009 vom EURat verabschiedet. Eine zweite Strategie für den Donauraum läuft seit Anfang 2011 an. In dieser Arbeit wird der Fokus auf die politische Steuerung der EUSBSR im Mehrebenensystem Ostseeraum gelegt. Es gilt zu überprüfen, inwiefern diese neue Möglichkeit von ebenenübergreifender Kooperation überhaupt innovativ ist, inwieweit bisherige Erfolge zu verbuchen sind und wo der generelle Mehrwert für die Ostseeraumkooperation liegt.
Was ist Multilevel Governance? In Kapitel 2 werden die Formen der Multilevel Governance illustriert, worin sich die Sicht der EU anschließt. Ebenso soll eine kurze Rückblende auf das EU-Engagement nach 1990 einen Überblick zur grundsätzlichen Position der Union im Ostseeraum ermöglichen. Diese theoretische Auseinandersetzung ist für das Verständnis der politischen Steuerung der EU essentiell.
Wie ist die makroregionale Strategie aufgebaut? Kapitel 3 befasst sich detaillierter mit der Definition des von der EU benutzten Terminus „Makroregion“. Ferner konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Entstehungsgeschichte der Strategie, sowie ihrem allgemeinen Aufbau und Inhalt. Es wird sich weiter herausstellen welche Eigenschaften ihr im Konsultationsprozess zu- bzw. abgesprochen wurden.
Welchen Mehrwert hat die EUSBSR für die Multilevel Governance im Ostseeraum? Zur Beantwortung dieser Frage wird die politische Steuerung der Strategie kritisch hinterfragt. Es soll geklärt werden, ob diese Form der Mehrebenenkooperation die Beteiligung unterschiedlicher Akteure forciert oder überhaupt ermöglicht. Außerdem zeigt dieser Absatz die aus den Evaluationen hervorgegangen Defizite auf. Unter diesem Aspekt muss mit Bezug auf Kapitel 2 die Integration von regional verankerten Organisationen bzw. privaten und administrative Körperschaften beleuchtet werden, deren Engagement entscheidend für den Erfolg der Strategie sind. Zuletzt wird resümierend ein Fazit gegeben, welches die Rolle der Strategie über die Ostseeregion hinaus aufzeigt.
Die Fundus an Literatur für die vorliegende Untersuchung ist, dem Thema geschuldet, relativ aktuell. Allenfalls die Multilevel Governance Analyse ermöglicht die Einbindung von Werken der jüngeren Vergangenheit. Die Publikation von Nikolaus Werz (u.a.) „ Kooperation im Ostseeraum. Eine Bestandsaufnahme der wissenschaftlichen und politischen Kooperation unter besonderer Berücksichtigung der neuen Bundesländer“ (2005; Rostock) gewährt eine umfassende Übersicht zur politischen Situation der Region kurz nach der EU- Erweiterung von 2004. Artur Benz leistet mit seinem Werk „ Politik im Mehrebenensystem“ (2009; Wiesbaden) und seinen Beiträgen in eigenen Herausgeberwerken „ Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung “ (mit Nicolai Dose, 2010; Wiesbaden) sowie „ Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder “ (Benz u.a., 2007; Wiesbaden) einen elementaren Beitrag für das Verständnis der Mehrebenensystematik.
Viele Forscher bieten zudem relevante Literatur bei der kritischen sowie deskriptiven Analyse der Ostseestrategie. Eine sehr gute Arbeit zur Entstehungsgeschichte der Strategie und deren Themenfelder stellt Alexandre Dubios (u.a.) „EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study “ (2009; NORDREGIO; Stockholm). Ebenso hervorzuheben sind die diversen Publikationen und Aufsätze von Carsten Schymik, der einerseits praktisch die Strategie bewertet „ Dreimal ‚Nein’ und dennoch erfolgreich? – Erste Ergebnisse der EU-Ostseestrategie “ (2011; Berlin) und das generelle Konstrukt der makroregionalen Strategien untersucht „ Modellversuch Makroregion. Die EU-Strategien für den Ostsee- und den Donauraum “, (2011;SWP;Berlin). Außerdem fasst sein Werk „ EU-Strategie für den Ostseeraum. Kerneuropa in der nördlichen Peripherie ?“ (mit Peer Krumrey, 2009; SWP; Berlin) in einzigartiger Weise den Konsultationsprozess zusammen. Ebenso ausführliche Informationen können aus Eckart Stratenschultes (u.a.) Herausgeberwerk „ Das europäische Meer: Die Ostsee als Handlungsraum“ (2011; Berlin) gezogen werden, besonders aus dem Aufsatz von Rainer Kosmider „ Leuchtturmprojekte und regionale Verantwortlichkeit “.
Zudem fußt diese Arbeit auf den veröffentlichten Dokumenten der EUKom, des EURates, den Evaluation und Schlussfolgerungen verschiedener Treffen und den Aktionsplan der Ostseestrategie.
2. Das Mehrebenensystem Ostseeraum
Vor der Analyse der EU- Ostseestrategie und der muss ein Blick auf die Organisationsstruktur und dem EU Engagement in der Region erfolgen. Die Vielzahl der nach 1990 geschaffenen Institutionen sowie der sukzessiv gewachsene Handlungskorridor der EU schufen ein komplexes Mehrebenensystem. Für das grundsätzliche Verständnis der Notwendigkeit und Initiative der Strategie wird ein Rückblick des EU-Engagements in der Region nach 1990 erfolgen. Ferner wird in diesem Kapitel der Fokus auf den Ansatz der Multilevel- Governance gerichtet um das Mehrebenensystem kategorisch erfassen zu können und Interaktionsmuster aufzuzeigen. Ebenso beschäftigt sich dieser Absatz mit für die EUSBSR nötigen Governance Muster der EU.
2.1 Der Ostseeraum im Blickfeld der EU nach 1990
Bereits vor dem Implementieren der Ostseestrategie war die EU mittelbar bzw. unmittelbar im finanziellen und politischen Sinne im Ostseeraum aktiv. Acht der Neun Anrainer sind EU Mitgliedstaaten. Das politische Verhältnis zu Russland wurde u.a. mit dem Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit von 1997 näher geregelt.[4] Norwegen, welches als kulturell verbundenes Land mit zum Ostseeraum gezählt werden kann, beteiligt sich zudem seit 1994 an dem Europäischen Binnenmark (European Economic Area; EEA) und verfolgt eine der EU-Politik ähnelnde Position in weiteren Bereichen, z.B. als Mitglied des Schengenraums.[5]
Zudem partizipiert die EU, vorrangig die EUKom, an verschiedenen Organisationen innerhalb der Region, bzw. war bei ihren Gründungen zugegen. Neben den Buisness Advisory Counsil (BAC), dem Baltic Sea Forum (Pro Baltica) ist aus umweltpolitischer Sicht die Helsinki Commission (HELCOM) besonders hervorzuheben. Die HELCOM ist der Dachverband der “Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area” welche 1974 von den Ostseeanrainern und der EG unterzeichnet und 1992 aktualisiert wurde. Dem Namen entsprechend beschäftigt sich die HELOM mit der maritimen Umweltschutz der Ostsee und besitzt eine der größten Datensammlungen zur heutigen und vergangen Umweltsituation der Ostsee.[6]
Beim Ostseerat (Council of the Baltic Sea States; CBSS[7] ) war wie die EU bei der Gründungskonferenz 1992 anwesend. Für sie bestand der größte Vorteil des Ostseerates in der gemeinsamen Kommunikation unabhängig von der Position der Staaten gegenüber selbiger.[8] Zudem blickte die damalige EU auf den noch nicht ratifizierten Unionsvertrag von Maastricht, der Modifikation des Binnenmarktes und den jungen Schengen-Prozess.[9] Ihr Interesse lag primär bei der wirtschaftlichen Komponente der Ostseeraumkooperation. Dieser Kurs kann wegen der Vielzahl von Förderprogrammen, die EU-(teil)finanziert sind, nicht überraschen. Die Strukturfonds INTERREG, TACIS oder PHARE basieren auf EU-Geldern. Tobias Etzold deklariert in dieser Hinsicht allerdings einen stetigen Rückgang des Interesses der EU am CBSS nach der Etablierung der Nördlichen Dimension.[10] Wichtig für die EU ist der CBSS nach den Erweiterungen für die Kommunikation mit Russland sowie die Integration von Kaliningrad in die Region.
Die Nördliche Dimension (korrekt: The Northern Dimension Policy) stellt eines der bedeutsamsten EU-Programme für den Ostseeraum dar. Ihr geographisches Tätigkeitsfeld reicht dabei vom euro-arktischen bzw. subarktischen Raum zur Südküste der Ostsee sowie von Nordwest-Russland bis zu Island und Grönland. Sie fördert mit unterstützenden externen Finanzinstituten den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Akteuren. Die Nördliche Dimension wurde auf Initiative Finnlands 1997 etabliert und 1999 (erneuert 2006) vom EURat umgesetzt. Die ND zielt besonders auf das Stärken der wirtschaftlichen Kooperation zwischen EU- und Nicht-EU-Staaten in der Region. Partner sind dementsprechend heute die EU als korporativer Akteur, Island, Norwegen und Russland. Diese gelten in der ND als gleichgestellt. Speziell für Russland hat die ND regionale außenpolitische Priorität, was nicht zuletzt den starken wirtschaftlichen Verflechtungen zur EU geschuldet ist.[11] Daneben sind der Ostseerat, der Arktische Rat, der Nordische Ministerrat und der Euro-Arktische Barentsrat Teilnehmer. Finanziert wird die Policy neben einem geringen bereit gestellten Budget der EU von beteiligten internationalen Finanzinstituten, darunter die Europäische Investmentbank und die Nordische Investmentbank.[12] Inwieweit die Nördliche Dimension weiterhin Beachtung in der EUSBSR findet wird in Kapitel 4.1.3 nochmals kurz aufgeführt.
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die EU in der Region präsent war und am Willensbildungsprozess transnationaler Kooperation teilnahm. Multilaterale politische Zusammenarbeit der Anrainer fand hierbei jedoch auf rein intergouvernementaler bzw. lokaler Ebene statt. Wenngleich die EUKom einen Platz in diversen internationalen oder subregionalen Institutionen hat, fungierte sie zumeist als Mitstreiter und nicht als Schirmherr. Zwar übernahm sie beispielsweise 1997 den Vorsitz der HELCOM, bleibt im Gegensatz dazu im Ostseerat aber nur Mitglied ohne das Recht die Präsidentschaft der Organisation inne zu haben. Mit der Ostseestrategie soll nun eine Unions- initiierte Policy diesen Status reorganisieren.
2.2 Multilevel Governance und EU- Governance
2.2.1 Multilevel Governance
Im Zuge der intensivierten Vernetzung nach dem Umbruch um 1990 wurden grenzüberschreitende Probleme komplexer und vielfältiger, während sich der Handlungskorridor von Nationalstaaten bei deren Bewältigung verkleinerte.[13] Die daraus gewachsene Kooperation, speziell im Ostseeraum, ist zum einen Folge der außenpolitischen Unabhängigkeit der Nationalstaaten und zugleich notwendiges Mittel um grenzüberschreitende Problematiken zu lösen.[14]
Governance als wissenschaftlicher Terminus beschreibt die Art und Weise des Regierens, kann als soziale Ordnung verstanden werden, Netzwerke abbilden sowie als progressiver Ansatz zur Verbesserung des nationalen und internationalen Regierens gelten.[15]
Der Begriff der Multilevel Governance verfestigte sich erst mit der Europaforschung und Theorien der internationalen Politik, obgleich die Föderalismusforschung ebenfalls mit einer Mehrebenensystematik konfrontiert ist.[16]
Der Ansatz der Multilevel Governance setzt grundlegend voraus, dass mehrere territoriale, politisch-administrative Ebenen existieren. Es wird unter diesem Aspekt zwischen höheren und niedrigeren Ebene differenziert, jedoch ohne diese in eine hierarchische Abfolge zu setzen. Arthur Benz erklärt diesbezüglich, dass zentrale Organisationseinheiten für allgemeine Angelegenheiten und regionale Instanzen nur für ihr Gebiet zuständig sind. Daraus rechtfertigt sich allerdings keine Überordnung, da „ das Allgemeine nicht zwingend über dem Besonderen steht“.[17] In dieser Untersuchung liegt der Fokus auf dem Zusammenspiel zwischen den verschiedenen politischen Ebenen der Region, speziell der supranationalen, nationalen und intergouvernementalen. Ungeachtet des völkerrechtlichen, finanziellen und administrativen Status sieht Frank Schimmelfennig den wichtigsten Unterschied zwischen Intergouvernementalismus und Supranationalismus in der Eigendynamik der europäischen Integration. Während ersterer Ansatz die transformativen Aktionen weiterhin unter Kontrolle der Regierungen sieht, hebt der zweite die Rolle der von den Regierungen bevollmächtigten Institutionen hervor, die selbst einen eigendynamischen Prozess in Gang bringen.[18]
Ferner beschreibt Multilevel Governance im Gegensatz zu den Föderalismus- und Organisationstheorien nicht nur die Struktur des Mehrebenensystems, sondern konzentriert sich auf Interaktionsmuster und Koordinationsmechanismen in und zwischen den verschiedenen Ebenen.[19] Mehrebenenpolitik wird insofern relevant, wenn Aufgaben und Kompetenzen innerhalb eines politischen Systems territorial aufgeteilt werden, und bei deren Bearbeitung bzw. Nutzung die einzelnen Einheiten interdependent handeln.[20]
Vom Nationalstaat ausgehend soll dabei eine Kompetenzabgabe nach oben (zu inter-/supranationalen Organisationen), zur Seite (NGOs), nach innen (Einbeziehen anderer Regierungsstellen) und nach unten (subnationale Ebene, z.B. deutsche Bundesländer) erfolgen.[21] Resultate dieser Disposition von Befugnissen sind einerseits ein effizienteres Nutzen von Problemlösungskapazitäten, andererseits das Potenzial größerer außenpolitischer Flexibilität.[22] „ Nationale Staatlichkeit wird in diesem Rahmen transformiert und so den Gegebenheiten der Globalisierung angepasst“.[23] Die Fülle an Organisationen kann für diesen Prozess als großer Vorteil im Ostseeraum gesehen. Allerdings gestaltet sich die Vereinbarkeit der unterschiedlichen Funktionslogiken der Institutionen teilweise schwierig.[24]
Im Zuge des Multilevel Governance Ansatzes können zwei unterschiedliche Typen ausgemacht werden. Der erste Typ zeichnet sich durch eine geringe, limitierte Anzahl von Zuständigkeitsbereichen bzw. Ebenen von Zuständigkeitsbereichen aus. Ebenso greift diese Perspektive wenn keine Überlappung innerhalb der Levels stattfindet und beschreibt damit u.a. ein klassisch föderales System: „ the functions are bundled; and the levels of government are multiple but limited in number.“ [25]
Der zweite Typ, der für die Beurteilung des Ostseeraumes hilfreicher ist, definiert die nicht limitierte Existenz von Ebenen, die sich intra-, intergouvernemental und territorial verschränken. Sie sind organisatorisch und administrativ in ihrem Dasein eher flexibel als starr, da sie sich aufgabenorientiert veränderten Umständen anpassen können.[26] Diese Klassifikation des Mehrebenensystems Ostseeraum als diese Form der Multilevel Governance ist besonders in der Gegenüberstellung von supranational zentraler Organisation und Multilevel Koordination der Ostseestrategie von Prägnanz.[27]
2.2.2 Governance in der EU
Für das hier relevante EU- Mehrebenesystem muss Governance nochmals aufgeführt werden. Im Gegensatz zu Regieren, welches eine dominante administrative Instanz impliziert, illustriert Governance alle Formen der Handlungskoordination zwischen Staat und Gesellschaft.[28] Die EU selbst formulierte ihre diesbezüglichen Handlungsstatuten im Weißbuch der Kommission von 2001. Es wurde allgemein die stärkere Einbindung lokaler, regionaler und nationaler Akteure in den Willensbildungsprozess vorgeschlagen und eine ebenenübergreifende Interaktion gefordert.[29] Desweiteren wird eine stetige Vernetzung u.a. mit privaten Körperschaften thematisiert um die grenzüberschreitende Kooperation zusätzlich zu fördern.[30] Der Ausschuss der Regionen (AdR) definiert Multilevel Governance für die EU in ihrem aktuellsten Weißbuch als: „ das koordinierte, auf Partnerschaft beruhende Vorgehen der Union, der Mitgliedstaaten und der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zur Ausarbeitung und Umsetzung der Politiken der Europäischen Union“. [31] Ebenso beschreibt der AdR dazu die Teilung der Verantwortlichkeiten auf die verschiedenen Verwaltungsebenen als notwendig.[32] Wenngleich diese Weißbücher keine rechtlich verbindlichen Dokumente sind, gehen aus ihnen die grundsätzlichen Positionen der EU gegenüber der Mehrebenesystematik hervor.
Im Mehrebenensystem werden zusätzlich intra- und intergouvernementale Beziehungen unterschieden, wobei erstere Strukturen in einer Ebene beschreiben, letztere die Interdependenz zwischen mehreren Ebenen widerspiegelt. Speziell die intergouvernementalen Strukturen haben in der EU- Governance besondere Stellenwerte beim Willensbildungsprozess, Koordinationsfunktion und der Interessenkumulation in Richtung EU.[33] Sie fungieren als Verhandlungsarenen, die bei top down und bottom up Prozessen wichtige Artikulations- und Austauschplattformen bereitstellen. Top-down und bottom-up bezeichnen hierbei Governance-Formen der ‚offenen Methode der Koordinierung’ (OMK)[34] im EU-Mehrebenensystem. Die offene Methode der Koordinierung gilt seit dem Europäischen Rat in Lissabon 2000 und stellt einen eigenständigen Governance Modus im europäischen Mehrebenensystem dar. Mit ihr wurde eine „ breiter Fächer der Mechanismen gemeinschaftlicher Politik angesprochen, der üblicherweise unter ‚new modes of governance’ subsumiert wird“.[35] Top-down setzt dabei voraus, dass Ziele und Agenda auf der supranationalen europäischen Ebene gesetzt werden, um sie dann nach unten zu koordinieren und entscheidende Akteure zur Nachahmung zu bewegen. Beim bottom-up Ansatz vollzieht sich dieser Prozess von unten, durch Kumulation von Interessen und Partizipation dezentraler privater und öffentlicher Akteure.[36]
Die erwähnten New Modes of Governance können als Initiative der EUKom und des EURates verstanden werden, um Politik in Mitgliedsstaaten zu koordinieren, in denen die Rechtssetzungsverfahren der EU zu überlasten drohen oder sie nicht über formale Rechtssetzungsinstanz verfügt.[37] Besonders der zweite Aspekt berührt die Ostseestrategie in den Politikfeldern Forschungs-, Sozial-, Gleichstellungs- und Umweltpolitik. Bedeutsamkeit dieser Koordinations- und Kooperationsmechanismen besteht, da die EU seinerzeit als vertikal und horizontal fragmentiertes, gekoppeltes System auftrat, welches kein eindeutiges Entscheidungszentrum inne hatte.[38]
Insgesamt muss die Governance der EU als diffuses, schwer definierbares Gebilde charakterisiert werden, bei denen sich intergouvernementale und supranationale Funktionslogiken abhängig vom Politikfeld überschneiden. Unterstrichen wird diese Situation durch die hier nicht weiter thematisierte Variation von Verhandlungsdemokratie auf EU-Ebene und den Regierungssysteme der Nationalstaaten, bzw. subnationalen Körperschaften.[39]
[...]
[1] Werz, Nikolaus; u.a.; (2005), S.15-16. Die Autoren verweisen hierbei auf unterschiedliche Zahlen in Abhängigkeit des definierten Gebietes. In diesem Fall wurden z.B. lediglich die Küstengebiete Deutschlands, Polens und Russlands beachtet, sowie die Staaten Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Dänemark, Finnland und wegen der kulturhistorischen Beziehung das Staatsgebiet Norwegens.
[2] Im Text und im Literaturverzeichnis gelten der Begriff „Europäische Union“ sowie deren Organe ungeachtet der Gegebenheiten vor 1992 und 2009 ebenso für Dokumente und Interaktionen der „Europäischen Gemeinschaft“.
[3] Vgl. Ebd. S.159.
[4] Siehe dazu weiter (u.a.): (97/800, EGKS, EG, Euratom) „ Beschluss des Rates und der Kommission über den Abschluss des Abkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Russischen Föderation andererseits “ im Amtsblatt vom 28.11.1997. (L327/1,2).
[5] Vgl. Germanas, Nerris (2011), S.21.
[6] Vgl. Helsinki Commission, Internetpräsenz. About HELCOM. http://www.helcom.fi/helcom/en_GB/aboutus/
[7] Siehe dazu weiter: CBSS Secretariat, Internetpräsenz, http://www.cbss.org/ (Stand: 05.09.12)
[8] Vgl. Etzold, Tobias (2010), S.96.
[9] Vgl. Schwarz, Martin (2011), S.231.
[10] Vgl. Etzold, Tobias (2010), S.96.
[11] Vgl. Lanko, Dimitri (2011), S.52.
[12] Europäische Union, European External Action Service (EEAS), Internetpräsenz, Northern Dimension.
Elektronische veröffentlicht auf: http://eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm.
[13] Vgl. Werz, Nikolaus; u.a.; (2005), S.136.
[14] Vgl. Koschkar, Martin (2010), S.14. Die außenpolitische Unabhängigkeit ergibt sich hierbei aus dem Aufbrechen der Blockkonfrontation zwischen West und Ost, sowie dem Souveränitätsgewinn z.B. der baltischen Staaten.
[15] Ein tiefer gehendes Definieren des Begriffs Governance ist für diese Arbeit zu komplex und von minderer Relevanz. Die Formen und das Verständnis von Governance variieren auf Grund von politisch theoretischen Ansätzen, nationalen Paradigmen sowie der generellen (wissenschaftlichen) Perspektive auf Staatstätigkeiten und Kooperation. Siehe dazu weiter: Benz, Arthur; Dose, Nicolai (Hrsg; 2010), S.11-36.
[16] Vgl. Benz, Arthur (2010), S.112.
[17] Ebd. S.111.
[18] Vgl. Schimmelfennig, Frank (2010), S.293ff. Der Autor klassifiziert diese Unterscheidung bei der Untersuchung der allgemeinen europäischen Integration und speziell bei der Währungsunion sowie EU-Osterweiterung.
[19] Vgl. Benz, Arthur (2007), S.297.
[20] Vgl. Benz, Arthur (2009), S.21.
[21] Vgl. Werz, Nikolaus; u.a.; (2005), S.137 und Abbildung 16 Global Governance, S.138.
[22] Vgl. Ebd. S.137.
[23] Koschkar, Martin (2010), S.15.
[24] Vgl. Werz, Nikolaus; u.a.; (2005), S.19. In diesem Zusammenhang spricht der Autor von den verschiedenen territorialen Ebenen, völkerrechtlichen Annerkennungen und politischen Machtpotenzialen.
[25] Hooghe, Liesbet; Marks, Gary (2001), S.5f
[26] Vgl. Ebd. S.7.
[27] Siehe dazu: Kapitel 4.1.2. Diese kurze Darstellung von Multilevel Governance soll nur einführend dem besseren Verständnis dienen. Für genauere Begriffsanalysen und Illustration von Formen der Multilevel Governance siehe weiter: Arthur; Lütz, Susanne; Schimank, Uwe; Simonis, Georg (2007:Hrsg.) “Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder.”, hier speziell: Benz, Arthur „ Multilevel Governance “, S.297-310.; Benz, Arthur (2009), „ Politik im Mehrebenensystem“; Benz, Arthur, Dose, Nicolai (2010:Hrsg.) Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung“.
[28] Vgl. Jachtenfuchs, Markus; Kohler-Koch, Beate (2010), S.72.
[29] EUKom (2001), „ Europäisches Regieren. Ein Weißbuch “, S.15ff.
[30] Vgl. Ebd. S.23f.
[31] Ausschuss der Regionen, (2009) Weißbuch des Ausschusses der Regionen zur Multi-Level-Governance“, im Amtsblatt Nr. C 211 vom 04/09/2009. Präambel.
[32] Vgl. Ebd.
[33] Vgl. Koschkar, Martin (2010), Vgl. Schaubild 1 S.94 und Schaubild 2 S.103. Der Autor führt exemplarisch die Rolle des CBSS und der HELCOM bei Governance- Prozessen bezüglich des Internationalen Küstenzonen Management an, sowie deren Funktion in der Koordination und Willensbildung zwischen den Ebenen. Siehe dazu weiter: u.a. Ebd. S. 85-103.
[34] Weitere Informationen zur OMK unter: EURat (2000), Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 23/24.03.2000. Lissabon. Elektronisch veröffentlicht auf: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm, hier speziell: Abschnitt I, Absatz 37.
[35] Jachtenfuchs, Markus; Kohler-Koch, Beate (2010), S.72.
[36] Vgl. Benz, Arthur (2009), S.161f.
[37] Vgl. Ebd. S.156.
[38] Vgl. Heinelt, Hubert; Knodt, Michéle (Hrsg; 2008), S.8.
[39] Vgl. Benz, Arthur (2009), S.164f.