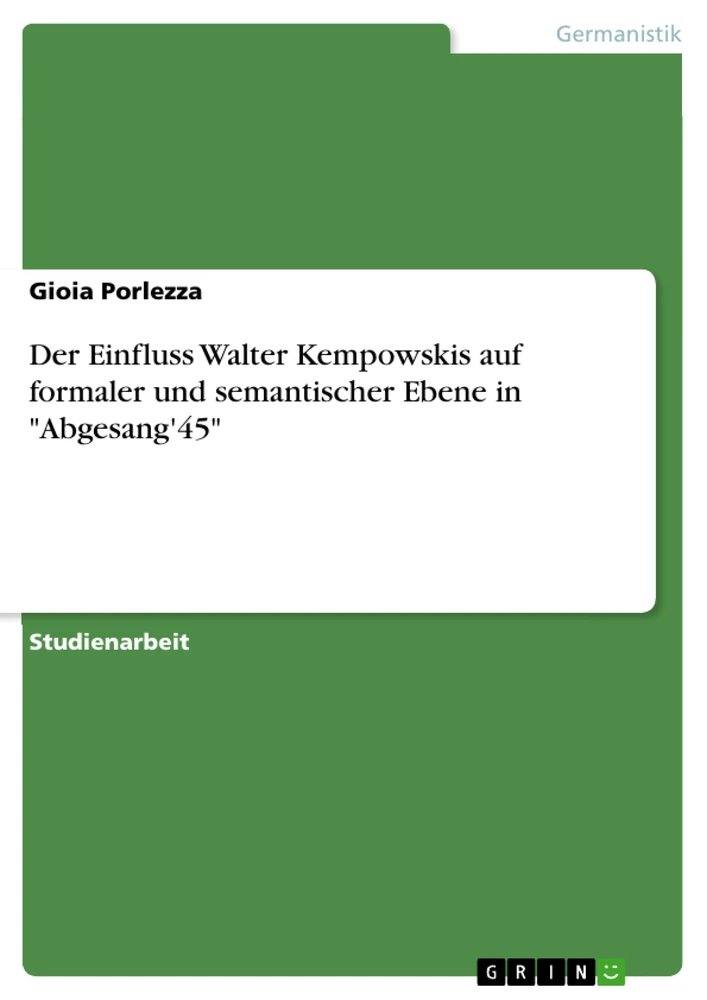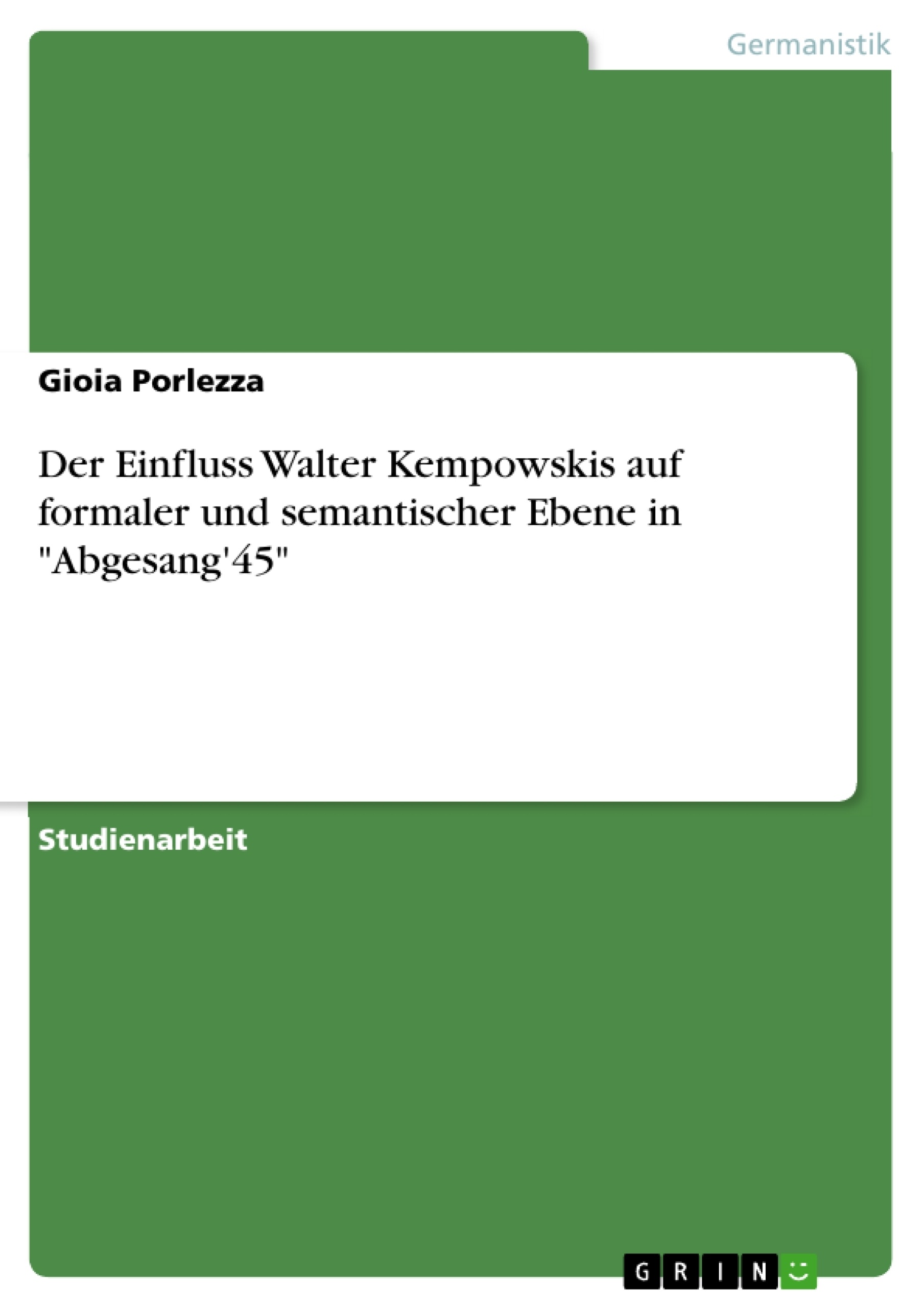"Abgesang ’45" von Walter Kempowski ist das letzte Werk der vierteiligen, aus zehn Einzelbänden bestehenden Buchreihe "Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch". Das letzte Werk unterscheidet sich vor allem dadurch von den übrigen, dass nur vier Tage zum Ende des Krieges hin betrachtet werden. In dieser Arbeit wird von diesen Tagen nur der Mittwoch, 25. April behandelt, da der Umfang des ganzen Werkes den Rahmen dieser zwölf Seiten sprengen würde. Ich habe mich für dieses Datum entschieden, weil der 20. April als Hitlers Geburtstag, der 30. April als Hitlers Todestag und das Kriegsende zu sehr von einem Schwerpunkt geprägt sind. Dass Walter Kempowski nicht nur Herausgeber, sondern auch Arrangeur ist, wird in zahlreichen Quellen von ihm selbst bestätigt. Deshalb bezieht sich meine Fragestellung nicht auf das ob, sondern wie Kempowski als unsichtbarer Autor in den Aufbau eingreift. Anhand von Primär- und Sekundärliteratur werden die bisherigen Erkenntnisse zum Echolot kritisch hinterfragt. In einem ersten Teil wird das Gesamtprojekt Kempowskis eingeführt, sowie die Technik der Collage als Form, aber auch als Stilmittel untersucht. Im weiteren Teil der Arbeit wird anhand des formalen Aufbaus und der semantischen Ordnung die Beantwortung der Fragestellung in einzelnen Abschnitten erarbeitet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Gesamtprojekt Kempowskis
3. Die Technik der Collage
4. Der formale Aufbau der Collage
4.1 Abschnitte
4.2 Paratexte
4.2.1 Zitat des Herrnhut Kalenders (S. 109)
4.2.2 Stars and Stripes - Daily German Lesson (S. 109)
4.2.3 Der Frühling - Friedrich Hölderlin (S.217)
4.2.4 Fotografien
5. Die semantische Ordnung
5.1 Grausamkeit und Alltag - Abschnittsübergreifend
5.2 Perspektivenwechsel - Abschnittsintern
6. Konklusion
Bibliographie