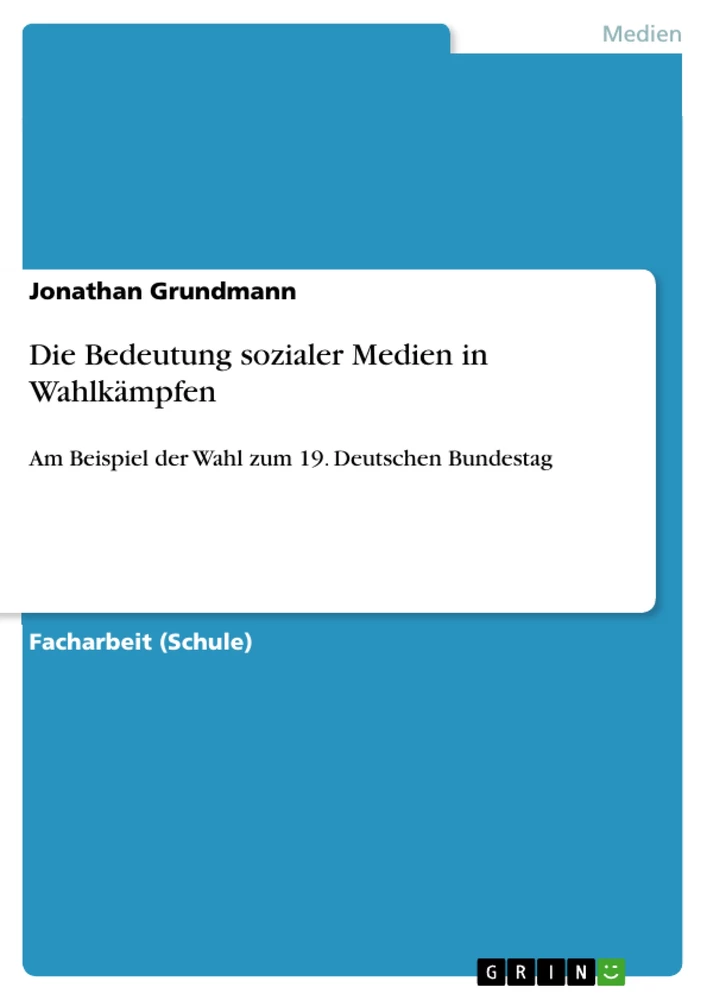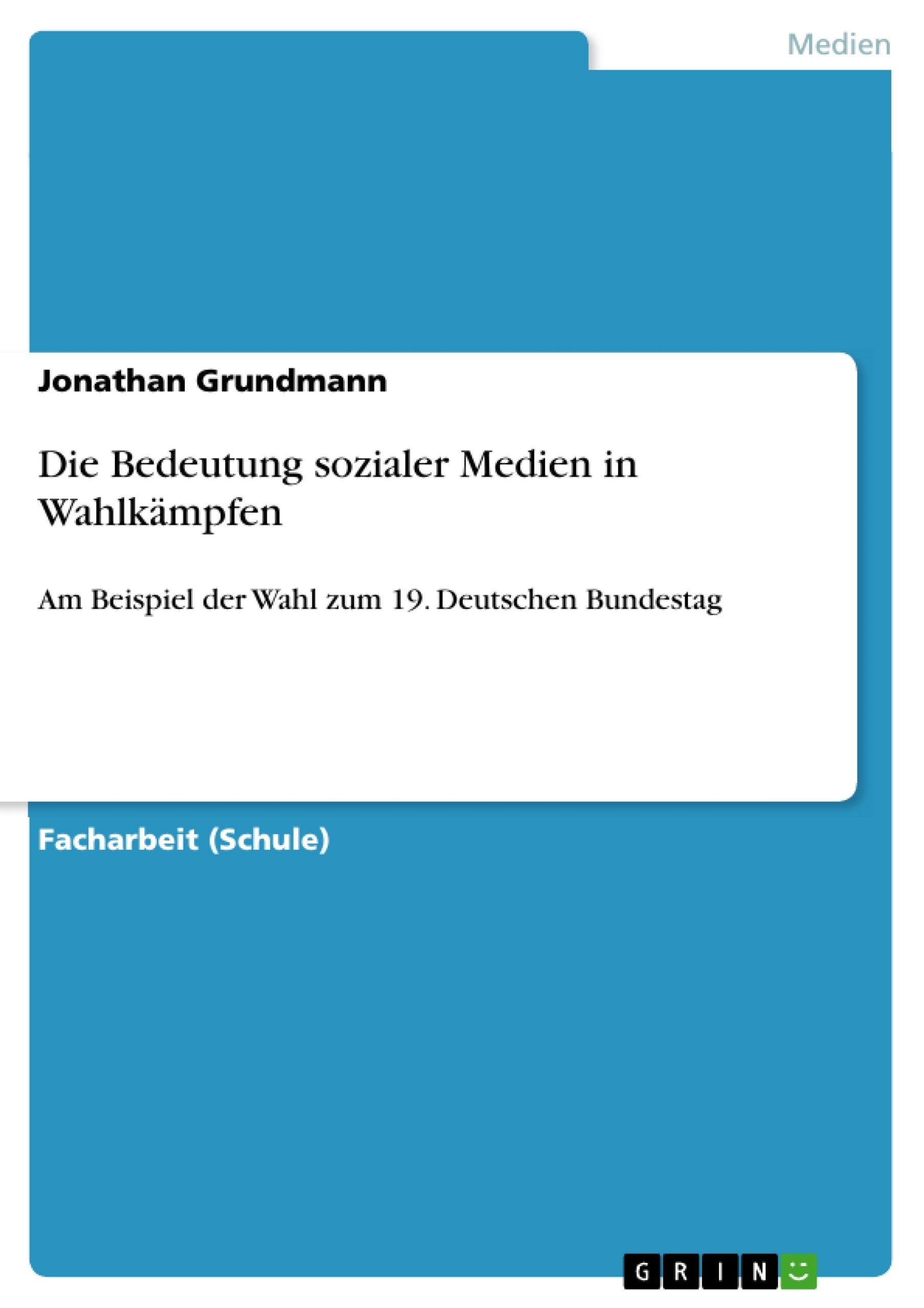Verliert das herkömmliche Wahlplakat zunehmend an Bedeutung? Gehören Informationsstände in der Fußgängerzone demnächst der Vergangenheit an? Wird sich die politische Interessenartikulation, und -aggregation vollständig in den digitalen Raum verlagern?
Spätestens seit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2008, ist es unter Journalisten, politischen Beratern und Beobachtern Konsens, dass das Internet und seine Kommunikationskanäle zentrale Bestandteile einer Wahlkampagne sind.
Als konkretes Fallbeispiel wird der Wahlkampf zur Wahl des 19. Deutschen Bundestags dienen. Im Fokus steht hauptsächlich das Geschehen in den Monaten von Juli bis einschließlich September 2017. Da der Wahlkampf im Netz mittlerweile sehr facettenreich ist, wird der digitale Part des Bundestagswahlkampf 2017 in dieser Arbeit ausschnittsweise anhand geeigneter Beispiele betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
I. Digitaler Wahlkampf: der Ausverkauf des herkömmlichen Wahlplakats?
II. Definitionen
1. Politische Partei
a) Bedeutung in Deutschland
b) Öffentliche Interessenartikulation als Grundfunktion einer Partei
2. Soziale Medien
a) Soziale Netzwerke
b) Internetseiten
III. Hintergründe und theoretische Grundlagen für die anschließende Analyse
1. Welche antretenden Parteien sind relevant?
a) Feststellung der Relevanz
b) Benennung der relevanten Parteien
2. Wer vertritt die relevanten Parteien digital?
a) Beratende Unternehmen nutzen den digitalen Wandel für kommerzielle
Zwecke
b) Wer vertritt wen?
3. Wer sind die Rezipienten der untersuchten Kampagnen?
4. Digitale Kommunikationskanäle der relevanten Parteien und deren Vertreter
a) Welche sozialen Netzwerke sind für die Parteien attraktiv?
b) Facebook – das Medium für „alles“?
c) Twitter als Verbreitungsdienst für Kurzbotschaften
d) Inhalte verbildlichen mit Instagram?
5. Präsentationsmöglichkeiten im Internet
IV. Die Bundestagswahl 2017: die Netzpräsenz entscheidet?
1. Weiterregieren oder Richtungswechsel: die Strategien der Parteien
a) CDU und CSU: weiter so?
b) „Neue“ soziale Gerechtigkeit mit der SPD?
c) Politischer Neuanfang mit der parlamentarischen Opposition?
d) Die digitale Republik mit der FDP?
e) AfD: Vom Netz in die Parlamente?
2. Der Wahl-O-Mat – Algorithmen helfen bei der Wahlentscheidung
a) Thesen als Entscheidungshilfe
b) Bedeutung bei der Bundestagswahl 2017
3. „Fake News“ - ein amerikanisches Phänomen im deutschsprachigen Netz
a) Gezielte Falschinformationen im Wahlkampf
b) Fake News und die Bundestagswahl 2017 – die Gefährdung des freien Wählerwillen?
V. Die Digitalisierung als Sprungbrett für weitere demokratische Partizipation
VI. Literaturverzeichnis
1. Bücher
2. Zeitschriften/Zeitungen
3. Internetquellen
VII. Abbildungsverzeichnis
I. Digitaler Wahlkampf: der Ausverkauf des herkömmlichen Wahlplakats?
Spätestens seit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2008, ist es unter Journalisten, politischen Beratern und Beobachtern sowie anderweitig in diesem Bereich tätigen Personen allgemeiner Konsens, dass das Internet und seine Kommunikationskanäle zentrale Bestandteile einer Wahlkampagne sind.[1] Der damalige Kandidat der Demokraten Barack Obama und sein Kampagnenteam hatten die wachsende Bedeutung der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und deren Optionen zur Wähleraktivierung erkannt und intensiv genutzt. Seine Kampagne gilt als vorbildhaft.[2] Doch auch in bundesdeutschen Wahlkämpfen werden das Internet und insbesondere die sozialen Medien in Wahlkämpfen auf Kommunal-, Landes-, und Bundesebene ausführlich verwendet und die Möglichkeiten stetig weiter ausgeschöpft. Politiker aus der ganzen Republik nutzen die verfügbaren sozialen Medien während und außerhalb ihrer Wahlkämpfe. Diese neu entstandenen digitalen Varianten des Austauschs sind mittlerweile feste Komponenten der politischen Kommunikation.[3]
Verliert das herkömmliche Wahlplakat zunehmend an Bedeutung? Gehören Informationsstände in der Fußgängerzone deshalb demnächst der Vergangenheit an? Wird sich die politische Interessenartikulation, und -aggregation vollständig in den digitalen Raum verlagern? Auf diese Fragen wird die vorliegende Arbeit wohl keine präzisen Antworten finden. Die folgenden Seiten und ihre Inhalte werden viel mehr zum Verständnis von Wahlkampagnen in sozialen Medien und ihrer Bedeutung in Bezug auf den gesamten Komplex der Kampagne beitragen. Die Arbeit wird sich dem digitalen Wahlkampf und dessen Strukturen, Funktionen und Eigenheiten im Allgemeinen widmen.
Als konkretes Fallbeispiel wird der Wahlkampf zur Wahl des 19. Deutschen Bundestags dienen. Im Fokus steht hauptsächlich das Geschehen in den Monaten von Juli bis einschließlich September 2017. Im Rückblick auf vergangene Ereignisse stand der Digitalwahlkampf diesmalig auch erstmals unter breiter kritischer Beobachtung.[4] Da der Wahlkampf im Netz und seine Aspekte mittlerweile sehr facettenreich sind, wird der digitale Part des Bundestagswahlkampf 2017 in dieser Arbeit ausschnittsweise mit geeigneten Beispielen betrachtet.
II. Definitionen
1. Politische Partei
a) Bedeutung in Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland wird medial und umgangssprachlich häufig als „Parlamentsrepublik“ bezeichnet, das Parlament und die dort vertretenen Parteien nehmen die höchste Stellung in der Legislative ein und wählen bzw. bestätigen und kontrollieren die Mitglieder der Exekutive. Das deutsche Parteiensystem umfasst Parteien des gesamten politischen Spektrums, in den Parlamenten vertreten sind aufgrund der Sperrklausel jedoch vergleichsweise wenige Parteien. „Als Parteiensystem werden die Zusammenhänge und die Beziehungen aller Parteien in einem demokratischen System beschrieben.“[5] Die politischen Parteien als Repräsentanten der Meinungsvielfalt in Deutschland stellen den Kern des politischen Systems der parlamentarischen Republik dar.
b) Öffentliche Interessenartikulation als Grundfunktion einer Partei
„Für die demokratische Willensbildung und für den Wahlakt sind Parteien unersetzbar. Sie sind einer der wichtigsten Faktoren der politischen Meinungsbildung.“[6] Eine Schlüsselfunktion politischer Parteien ist das öffentliche Formulieren von Forderungen und Erwartungen von gesellschaftlichen Kräften und die anschließenden Bestrebungen zur Gestaltung der Politik. Das Internet und seine Kommunikationsmöglichkeiten bieten Bürgern und Parteien neue Formen des Austauschs.
2. Soziale Medien
a) Soziale Netzwerke
„Unter sozialem Netzwerk versteht man das Beziehungsgeflecht zwischen einer Vielzahl von Akteuren. Sie werden zudem als Internetplattform bezeichnet, auf der man sich on- line „trifft“, Kontakte pflegt, sich austauscht und vor allem untereinander vernetzt“[7]
Diese Netzwerke bieten die Möglichkeit der internen Kommunikation, der Selbstdarstellung, der gegenseitigen Verlinkung und dem Erstellen und Teilen multimedialer Beiträge in Text-, Video-, Bild- oder anderer interaktiver Form. Ein digitales Beziehungsgeflecht bildet die Kommunikationsbasis eines sozialen Netzwerkes.[8]
b) Internetseiten
Eine Internetseite, in den meisten Fällen bestehend aus mehreren Unterseiten, ist eine digitale Präsenz im Internet. Sie ist über eine Domain erreichbar und bietet eine große Vielzahl an Möglichkeiten der Präsentation des Webseitenbetreibers. Aufgerufen werden kann die Internetseite über das direkte Anfragen der Seitenadresse, über eine Internetsuchmaschine oder über eine Verlinkung von einer anderen Website. „Websites sind neben E-Mails die zweite wichtige Basistechnologie für den Wahlkampf im Internet“[9]
Sogenannte Weblogs sind Internetseiten mit steter Kontinuität und starker Themenbegrenzung. „Es handelt sich bei ihnen um regelmäßig aktualisierte Webseiten, die bestimmte Inhalte (zumeist Texte […], aber auch Bilder oder andere […] Inhalte) in umgekehrt chronologischer Reihenfolge darstellen.“[10]
III. Hintergründe und theoretische Grundlagen für die anschließende Analyse
1. Welche antretenden Parteien sind relevant?
a) Feststellung der Relevanz
Als „relevant“ und somit erwähnenswert für diese Analyse gelten alle Parteien, welche seit der Bundestagswahl 2013 mit einer Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten sind oder deren Abgeordneten im Wahljahr 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen sind.
b) Benennung der relevanten Parteien
Unter Berücksichtigung der oben benannten Kriterien sind die „Alternative für Deutschland“ (AfD), „Bündnis `90/Die Grünen“ (Die Grünen), die „Christlich Demokratische Union Deutschlands“ (CDU), die „Christlich-Soziale Union Bayern e.V.“ (CSU), „Die Linke“ (Die Linke), die „Freie Demokratische Partei“ (FDP) und die „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“ (SPD) relevant für die folgende Untersuchung.
2. Wer vertritt die relevanten Parteien digital?
a) Beratende Unternehmen nutzen den digitalen Wandel für kommerzielle Zwecke
Viele professionelle Werbeagenturen haben sich in den zurückliegenden Jahren auf Marketing im digitalen Kommunikationsraum eingestellt oder sich darauf spezialisiert. Dies trifft auch für die Agenturen zu, welche Parteien in Wahlkämpfen beraten und vertreten. Hinter dem Auslagern solcher kommunikativer Leistungen einer Partei an eine Kommunikationsagentur steht ein pragmatisches Motivationsmuster. Die Partei erhält einen professionellen Auftritt in sozialen Netzwerken sowie eine professionell gestaltete Internetseite um ihre Forderungen darzustellen und ihren Gestaltungswillen zu verdeutlichen; die Agentur und die von ihr Beschäftigten machen Profit.[11] Dieses Vorgehen der Parteien verändert die Struktur der digitalen Wahlwerbung. Dass Parteien von Agenturen bei der Gestaltung der Kampagne und während des Wahlkampfes beraten werden ist allerdings seit Jahrzehnten üblich.
b) Wer vertritt wen?
Fast alle relevanten bei der Bundestagswahl 2017 antretenden Parteien werden von Kommunikationsagenturen beraten. Die AfD arbeitete mit der schweizerischen Agentur „Kunkelbakker“ zusammen, die CSU engagierte die Münchner Agentur „Saint Elmo‘s“, Die Linke wurde von ihrer langjährigen Agentur „DiG/Trialon“ in Berlin beraten und die FDP wurde von der Agentur „Heimat Berlin“ betreut. „Heimat Berlin“ erarbeite bereits nach der Wahlniederlage der Freien Demokraten im Jahr 2013 mit diesen das neue visuelle Auftreten der Partei. Die CDU engagierte die große Werbeagentur „Jung von Matt“, welche auf dem Gebiet der politischen Kampagnenführung bisher keinerlei Erfahrungen hatte. Die SPD wurde mit der Hamburger Agentur „KNSK“ ebenfalls von einer Großagentur betreut, diese begleitete bereits 1998 und 2002 die Kampagnen der Sozialdemokraten. Lediglich die Grünen beschritten einen neuen Weg: sie gründeten eigens für diese Wahl ein Kommunikations- und Beraterteam bestehend aus der Partei nahestehenden Fachleuten.[12]
3. Wer sind die Rezipienten der untersuchten Kampagnen?
Grundsätzlich soll jeder wahlberechtigter Nutzer über die sozialen Medien erreicht werden. Vorrangig liegt der Fokus aber auf einer jüngeren Zielgruppe, dies drückt sich primär in der Gestaltung der digitalen Kampagnen aus. „Die höchste Verbreitungsrate [findet] sich weiterhin bei den Jüngeren: In der Gruppe der 14- bis 19-Jährigen nutzten fast alle Befragten das Internet [...]“[13]
Ein Anteil von 90 % der deutschsprachigen Bevölkerung nutzt das Internet.[14] Die Nutzungsrate sozialer Netzwerke ist dagegen vergleichsweise gering. Die soziale Interaktionsplattform „Facebook“ wird von 33 %, der Kurzbotschaftendienst „Twitter“ von 3 % und die audiovisuelle Plattform „Instagram“ von 9 % der deutschsprachigen Bevölkerung wöchentlich verwendet.[15]
„Die Kombination aus wachsender Internetnutzung und zunehmendem politischen Ange- bot im Netz legt die Vermutung nahe, dass das Internet als politisches Informationsmedi- um […] über die Jahre hinweg an Bedeutung gewonnen hat.“[16]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Über die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten des Internets, insbesondere der sozialen Netzwerke, können die Bürger auf vielfältige Art und Weise mit den Inhalten der politischen Kommunikatoren in Berührung kommen. In der Alterskohorte der 18-29 Jährigen ist das Internet noch vor dem Fernsehen die wichtigste Quelle für den Erhalt politischer Informationen.[17]
4. Digitale Kommunikationskanäle der relevanten Parteien und deren Vertreter
a) Welche sozialen Netzwerke sind für die Parteien attraktiv?
Für die Parteien sind jene sozialen Netzwerke relevant, welche eine große Nutzerzahl in Deutschland aufweisen können und den Parteien geeignete Optionen bieten die eigenen politischen Botschaften dem Wähler direkt zu vermitteln. Folglich sind dies Facebook, Twitter und Instagram. Alle für diese Analyse relevanten Parteien waren vor, während und nach dem Wahlkampf 2017 auf allen drei erwähnten Plattformen aktiv.
b) Facebook – das Medium für „alles“?
Facebook ist das im deutschsprachigen Raum am häufigsten frequentierte soziale Netzwerk, somit nimmt es eine Schlüsselposition in der digitalen Wahlkampagne ein. Die Kernfunktion Facebooks liegt darin, multimediale Beiträge in Form von Texten, Bildern, Videos und Liveübertragungen zu kreieren und diese mit vordefinierten Personenkreisen zu teilen. Der tatsächliche Funktionsradius von Facebook ist wesentlich größer, dieser ist aber für die weitere Betrachtung hier nicht weiter von Bedeutung. Facebook sortiert und filtert algorithmisch sowie individuell welche Inhalte dem Einzelnen angezeigt werden. Hierzu sammelt der Dienstleister über einen längeren Zeitraum die Nutzungsdaten seiner Anwender.[18]
Der Mehrwert für die Wahlkämpfenden besteht vorrangig im hohen Personalisierungs- und Persönlichkeitsfaktor der Plattform: „Worauf achten die Benutzer in sozialen Netzwerken? Die meiste Zeit und in erster Linie auf die Updates ihrer Freunde.“[19] Des weiteren bietet Facebook seinen Kommunikatoren die Möglichkeit gezielt Inhalte für definierte Personengruppen für eine finanzielle Gegenleistung im Algorithmus zu priorisieren. Parteien und politische Vertreter sind also im Stande Teile ihrer politischen Botschafter einem ausgewählten Publikum online zu präsentieren.
c) Twitter als Verbreitungsdienst für Kurzbotschaften
Das Kurzbotschaften-Portal Twitter erlaubt seinen Nutzern kurze Textnachrichten mit einer maximalen Länge von 280 Zeichen zu veröffentlichen. Diese Kurzbotschaften können mit Bildern oder Videos kombiniert werden oder andere Webinhalte verlinken. Unter sogenannten „Hashtags“, also Schlagwortmarkierungen, können veröffentlichte Botschaften, genannt „Tweets“, themenspezifisch gruppiert und chronologisch abgerufen werden. Die Knappheit der Inhalte grenzt Twitter deutlich von anderen Netzwerken ab, sie hat zudem zur Folge, dass politische Kräfte ihre Aussagen konkreter und prägnanter formulieren. Twitter ist am meisten vom Phänomen der „Social Bots“ betroffen, dies sind computergesteuerte und künstlich generierte Nutzerkonten, welche in einer hohen Frequenz bestimmte politische Statements veröffentlichen. Inhaltlich kommt der Datenverkehr der „Social Bots“ überwiegend von Rechts.[20] „Klar ist [...], dass die meisten Social Bots die Agenda der AfD unterstützen: Sie helfen, Begriffe zu etablieren, generieren Reichweite und simulieren Relevanz.“[21]
Durch die regelmäßigen provokanten Veröffentlichungen Donald Trumps während und nach des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes 2017 hatte das Portal weltweit an Reichweite und Popularität gewonnen. Alle relevanten Parteien sind mit mindestens einem Auftritt auf Twitter vertreten. Oftmals dient Twitter als Primärquelle für Journalisten und Politikbeobachter, Aussagen von Politikern und Parteien werden für weitere journalistische Erzeugnisse verwendet.
d) Inhalte verbildlichen mit Instagram?
Die Online-Kommunikationsplattform Instagram zeichnet sich vor allem durch ihre audiovisuellen Präsentations- und Kommunikationsmöglichkeiten aus. Im Fokus der Anwendung stehen vom Nutzer erzeugte oder weiterverbreitete Bilder und Videos; Textbotschaften bzw. Bildbeschreibungen haben eine deutlich geringere Priorität. Das Portal verzeichnet großen Zuwachs in Deutschland, Instagram gehört dem Facebook-Konzern an.[22]
Das Netzwerk bietet Anwendern mit politischer Motivation die Möglichkeit ihre politischen Botschaften, Forderungen und Ideen anschaulich und ästhetisch aufbereitet darzustellen. Mit der 2016 neu eingeführten „Stories“-Funktion können Netzwerknutzer Fotos und Videos temporär begrenzt veröffentlichen, der Beitrag wird nach 24 Stunden automatisch gelöscht.
[...]
[1] Vgl. Merz, Manuel; Rhein, Stefan (Hrsg.): Wahlkampf im Internet, Handbuch für die politische Online-Kampagne. Berlin, 2009, S.167.
[2] Vgl. Heigl, Andrea; Hacker, Philipp: Politik 2.0, Demokratie im Netz. Wien, 2010, S. 11.
[3] Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Soziale Medien im Wahlkampf, https://www.bpb.de/dialog/wahlblog/166544/soziale-medien-im-wahlkampf?type=galerie&show=image&i=166788, abgerufen am: 28.10.2017.
[4] Vgl. Lehmann, Hendrik: Wie die Parteien Wahlkampf in Social Media machen, http://www.tagesspiegel.de/politik/datenanalyse-wie-die-parteien-wahlkampf-in-social-media-machen/20151802.html, abgerufen am 28.10.2017.
[5] Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Parteien in Deutschland, https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/201913/parteiensystem, abgerufen am 30.10.2017.
[6] Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Zur Wahl gestellt: die Parteien, http://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahlen/62501/zur-wahl-gestellt-die-parteien?p=all, abgerufen am 30.10.2017.
[7] Katerna, Sylvia; Schmidt, Sara: Soziale Netzwerke, https://www.uibk.ac.at/psychologie/mitarbeiter/leidlmair/soziale-netzwerke.pdf, abgerufen am 30.10.2017.
[8] vgl. ebd.
[9] Merz, Manuel; Rhein, Stefan (Hrsg.): Wahlkampf im Internet, Handbuch für die politische Online-Kampagne. Berlin, 2009, S. 93.
[10] Schmidt, Jan: Social Software, Onlinegestütztes Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement. In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Nr. 2, 2006, S. 3.
[11] Vgl. Blaschke, Daniela; Bösehans, Birte; Habben, Paulina; Panic, Elisabeth; Steg, Thomas; Wixforth, Daniel: Wahlkampf digital, Was Wählerinnen und Wähler suchen und was die Parteien anbieten. Kassel, 2014, S. 44.
[12] Vgl. Hamberger, Katharina; Lindner, Nadine: Die Kanzlermacher, http://www.deutschlandfunk.de/agenturen-im-wahlkampf-die-kanzlermacher.724.de.html?dram:article_id=393220, abgerufen am 30.10.2017.
[13] Merz, Manuel; Rhein, Stefan (Hrsg.): Wahlkampf im Internet, Handbuch für die politische Online-Kampagne. Berlin, 2009, S. 20.
[14] Vgl. Projektgruppe ARD/ZDF-Multimedia (Hrsg.): ARD/ZDF-Onlinestudie, Kern-Ergebnisse, http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2017/Artikel/Kern-Ergebnisse_ARDZDF-Onlinestudie_2017.pdf, abgerufen am 31.10.2017.
[15] Vgl. ebd.
[16] Faas, Thorsten; Partheymüller, Julia: Aber jetzt?! Politische Internetnutzung in den Bundestagswahlkämpfen 2005 und 2009. In: Schweitzer, Eva Johanna; Albrecht, Stefan (Hrsg.): Das Internet in Wahlkämpfen, Analysen zur Bundestagswahl 2009. Wiesbaden, 2011, S. 120.
[17] Hennewig, Stefan; Güldenzopf, Ralf: Im Netz der Parteien. In: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (Hrsg.): Die Politische Meinung, Nr. 848, S. 44.
[18] Vgl. Brühl, Jannis; Brunner, Katharina; Ebitsch, Sabrina: Der Facebook-Faktor, Wie das soziale Netzwerk die Wahl beeinflusst, http://gfx.sueddeutsche.de/apps/e502288/www/, abgerufen am 31.10.2017.
[19] Hacker, Philipp; Heigl, Andrea: Politik 2.0, Demokratie im Netz. Wien, 2010, S. 35.
[20] Vgl. Kramm, Jutta: „Es gibt keine Smoking Gun“, https://correctiv.org/echtjetzt/artikel/2017/09/20/interview-neudert-bots-wahlkampf-fake-news-russland-afd-bundestagswahl/, abgerufen am 31.10.2017.
[21] Gensing, Patrick: Mission Stimmungsmache, http://faktenfinder.tagesschau.de/inland/twitter-wahlkampf-101.html, abgerufen am 31.10.2017.
[22] Staun, Harald: Politik der Pose, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wahlkampf-auf-instagram-politik-der-pose-15172349.html, abgerufen am 01.11.2017