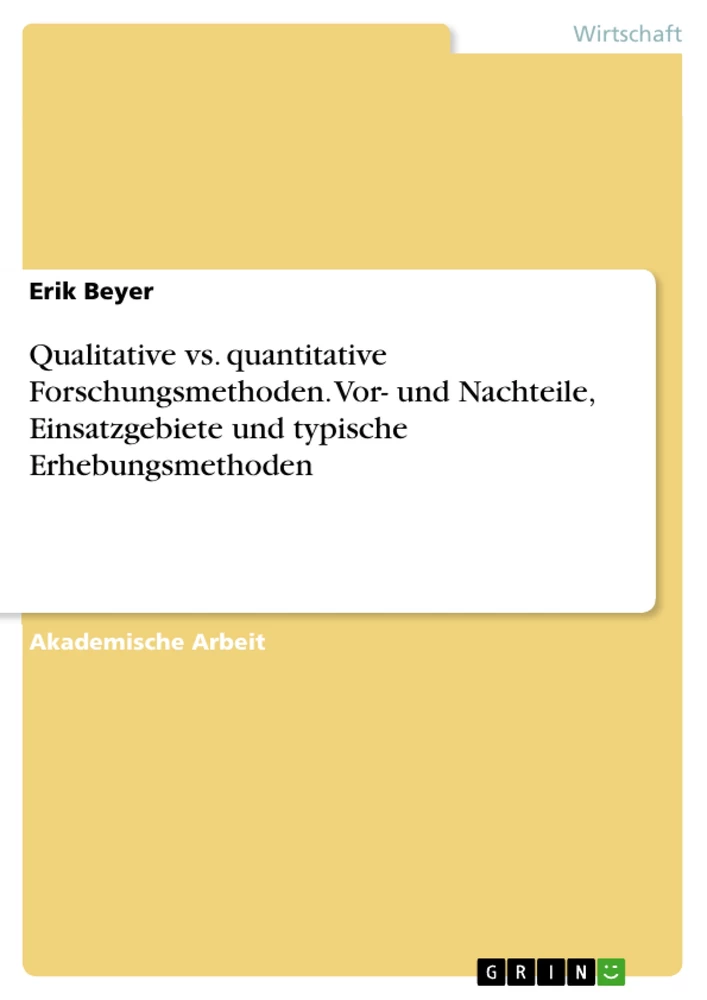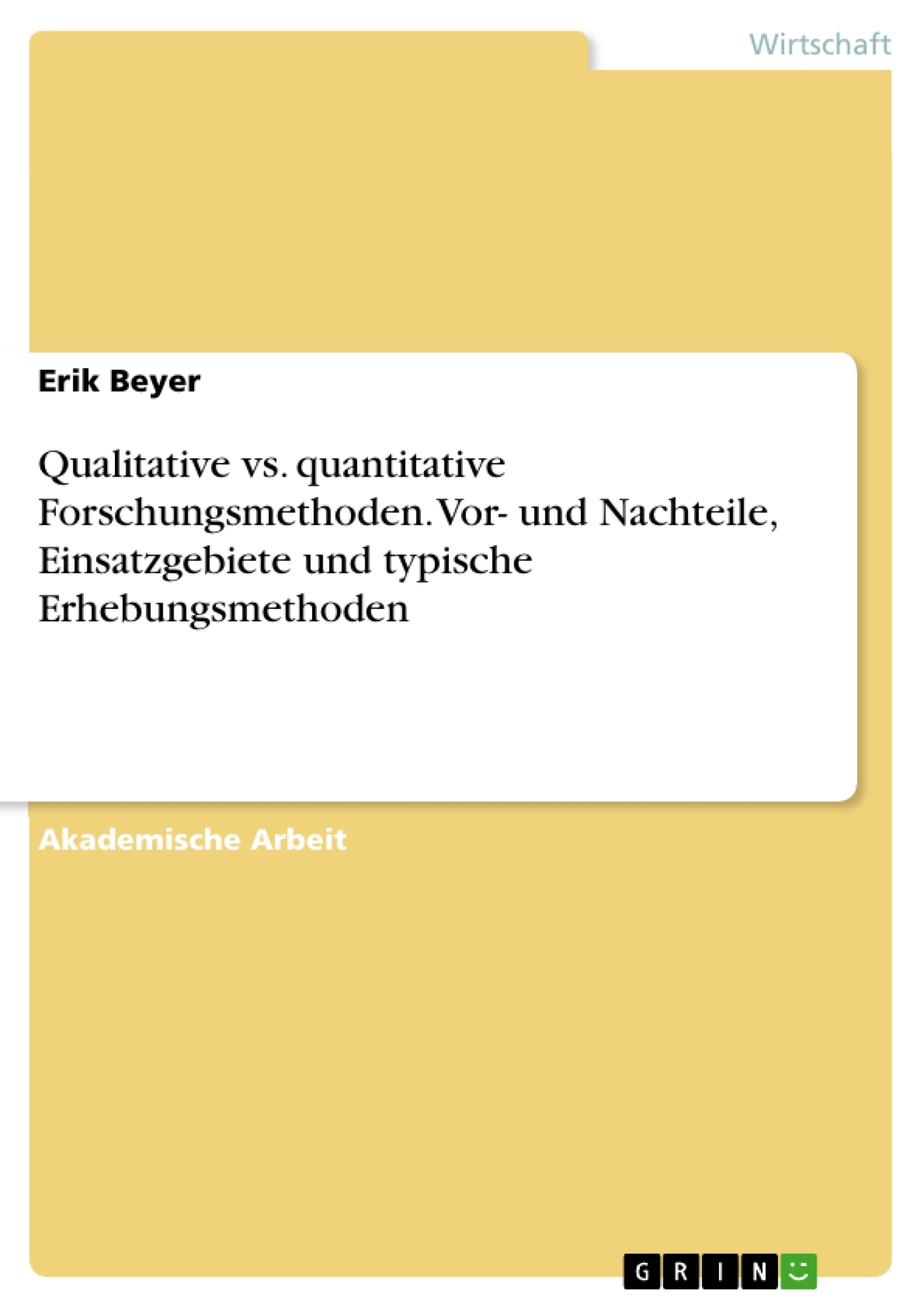Die beiden Konzepte der quantitativen und qualitativen Forschung stehen nach Wolf und Priebe nicht für „klar abgegrenzte wissenschaftstheoretische Programme“; viel mehr geben sie als eine Art Sammelbezeichnung breitgefächerte methodische Richtungsangaben vor.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, dem Leser einen kompakten Überblick über die Richtungsvorgaben, wie sie bei Wolf und Priebe genannt werden, bzw. die Merkmale der qualitativen und quantitativen Forschung zu geben, sowie deren Unterschiede, Stärken
und Schwächen aufzuzeigen. Hierzu soll zunächst eine grobe Gegenüberstellung der beiden Ansätze in das Thema einleiten, daraufhin soll auf die besonderen Kennzeichen der beiden Ansätze, sowie auf deren Kritik, Vor- und Nachteile und ihre jeweiligen
Einsatzgebiete und die typischen Erhebungsmethoden eingegangen werden.
Abschließend soll im zweiten Teil der Arbeit aufbauend auf den theoretischen Unterschieden aus den vorherigen Kapiteln anhand des Beispiels der Befragung aufgezeigt werden, inwiefern sich die Anwendung der Befragung als Erhebungsmethode im qualitativen und quantitativen Ansatz unterscheidet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung
2.1. Gegenüberstellung quantitativer und qualitativer Forschung
2.1.1. Kennzeichen quantitativer Forschung
2.1.2. Kennzeichen qualitativer Forschung
2.1.3. Vor- und Nachteile
2.1.3.1. Vorteile der quantitativen Methoden
2.1.3.2. Nachteile und Kritik der quantitativen Methoden
2.1.3.3. Vorteile der qualitativen Methoden
2.1.3.4. Nachteile und Kritik der qualitativen Methoden
2.2. Typische Einsatzgebiete und gängige Erhebungsmethoden
2.2.1. Anwendungsgebiete der quantitativen Vorgehensweise
2.2.2. Typische quantitative Erhebungsmethoden
2.2.3. Anwendungsgebiete der qualitativen Vorgehensweise
2.2.4. Typische qualitative Erhebungsmethoden
3. Unterschiede der quantitativen und qualitativen Befragung
3.1 Quantitative Befragung
3.2. Qualitative Befragung
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis