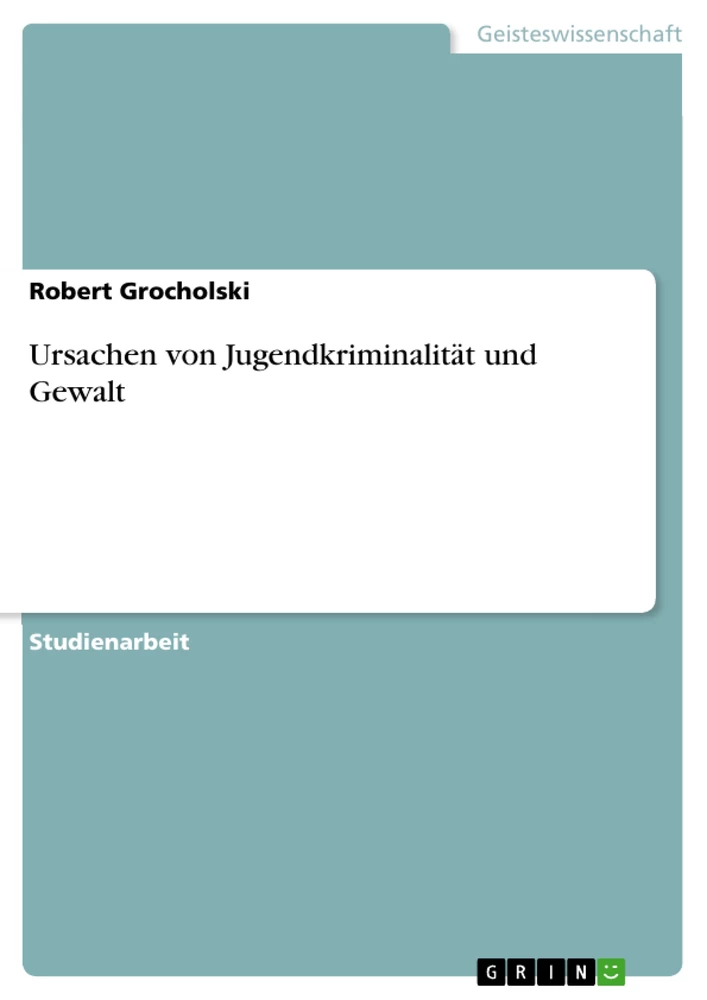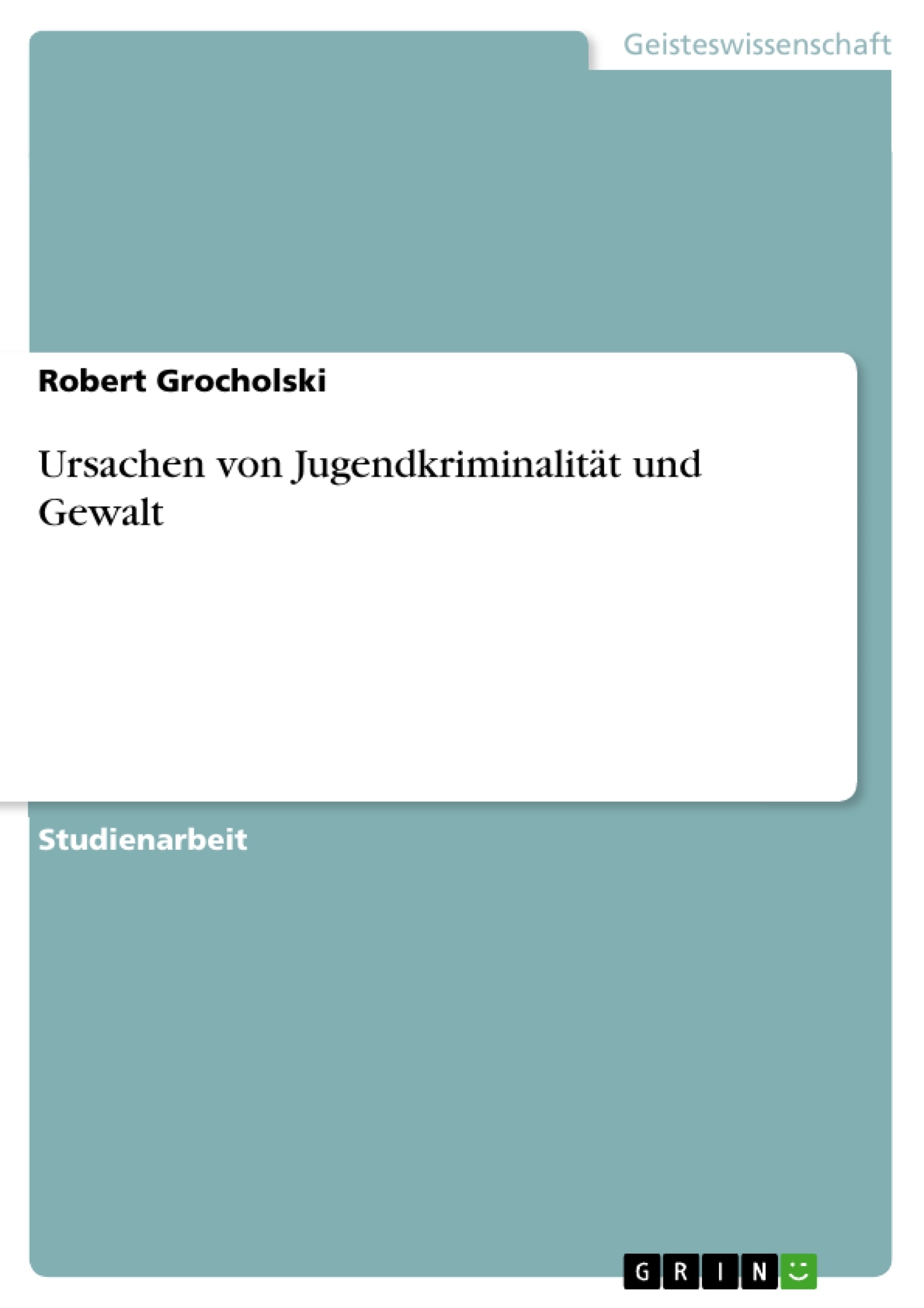Kriminelle Jugendliche sind ein ständiger Bestandteil verschiedenster Medien. Jugendgewalt und Jugendkriminalität sind in den letzten Jahren immer wieder kontrovers diskutiert worden und es kommt ständig die Frage auf, was die Gründe für ein derartiges Verhalten sind. Die Debatten reichen dabei vom Drogenkonsum, Diebstahl über Körperverletzung bis hin zu Amokläufen.
Die vorliegende Arbeit betrachtet sowohl die Ursachen jugendlicher Kriminalität als auch die Entstehung junger Mehrfach- und Intensivtäter. Im zweiten Teil der Arbeit sollen die Begriffe Kriminalität, Devianz und Delinquenz erläutert werden, um eine Definitionsgrundlage zu schaffen. Im dritten Teil soll auf die Formen von Kriminalität im Jugendalter eingegangen werden. Im vierten Teil sollen die Ursachen betrachtet werden. Der fünfte Teil stellt präventive Maßnahmen vor. Abschließend werden im Fazit die Wirkungen von Maßnahmen kritisch beleuchtet. Der Begriff „Jugendliche“ umfasst Personen von 14 bis unter 18-Jährige und bezieht sich im folgendem Verlauf der Arbeit nur auf diese Altersgruppe.
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
2 Begriffsdefinition
2.1 Kriminalität
2.2 Devianz
2.3 Delinquenz
3 Formen der Jugendkriminalität
3.1 Verhaltensauffällige
3.2 Mehrfach Intensivtäter
3.3 Gruppendelinquenz
4 Ursachen
4.1 Familie
4.2 Wohnort
4.3 Medien
5 Prävention
5.1 Schule
5.2 Jugendhilfe
5.3 Polizei
5.4 Soziale Kontrolle
5.5 Mehrfach- und Intensivtäter
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis