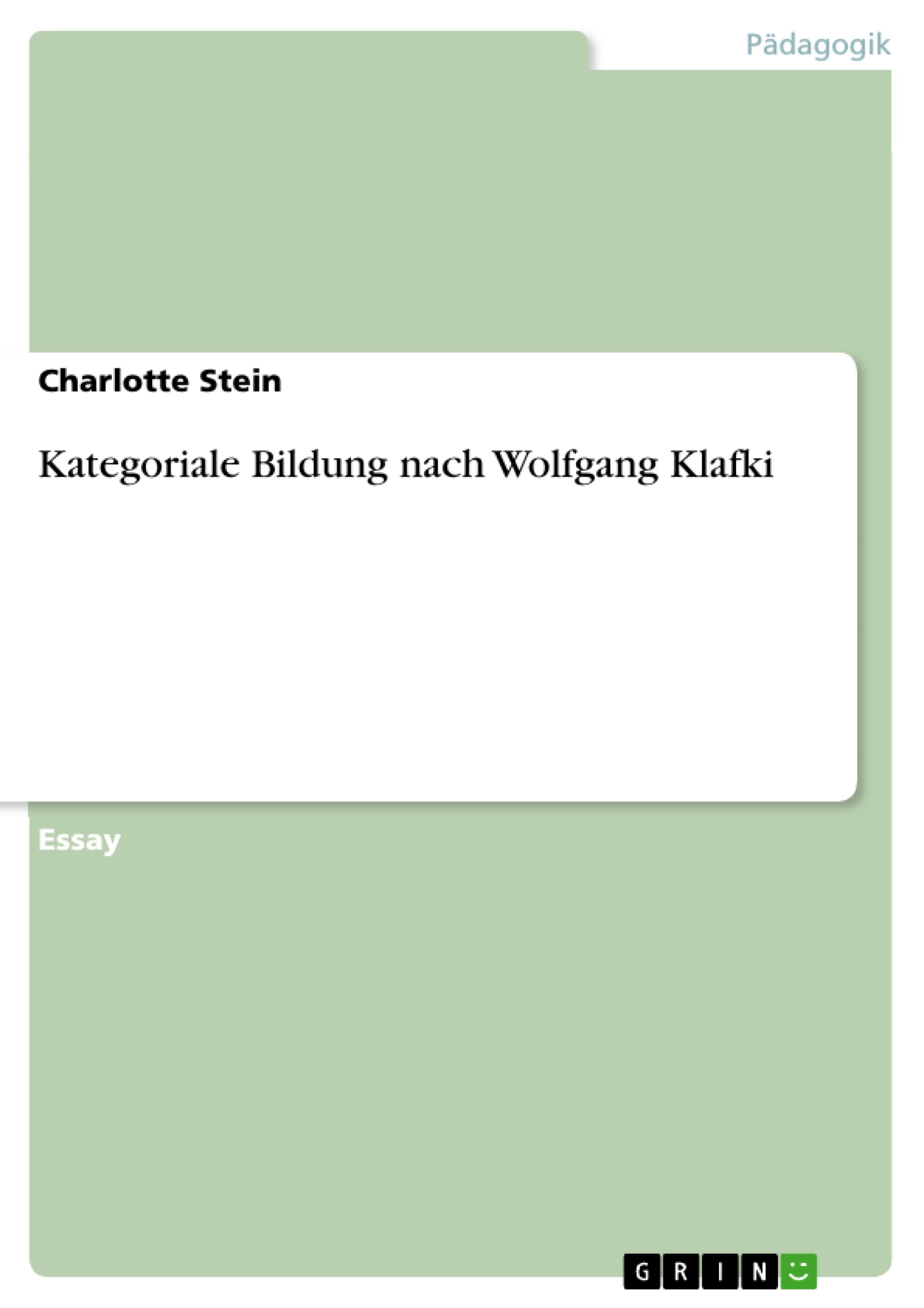Auch wenn Wolfgang Klafki vielen Lehramtsstudierenden primär durch seine Didaktische Analyse bekannt ist, geht sein Bildungskonzept weit über die Punkte der Didaktischen Analyse hinaus. Als Ergebnis seiner Studien fordert er, den Bildungsbegriff neu zu definieren. Bildung müsse auf die „Mitmenschlichkeit“, die „politische Existenz des Menschen“, konsequent auf einen späteren Beruf und das außerschulische Leben bezogen werden. Ferner solle sie helfen Probleme und Spannungen im Leben bewältigen und nicht bloß beschreiben zu können. Die Erziehung zu einem sittlich reifen demokratischen Menschen, der in einem Umfeld ohne ständische und soziale Schranken gebildet werde, steht für Klafki im Fokus. Dies sei unter anderem dadurch erreichbar, dass Bildung einen weltweiten Horizont vertrete, der nicht ausschließlich die Geschichte, Traditionen und Werte des eigenen Kulturkreises behandle.
Kategoriale Bildung nach Wolfgang Klafki
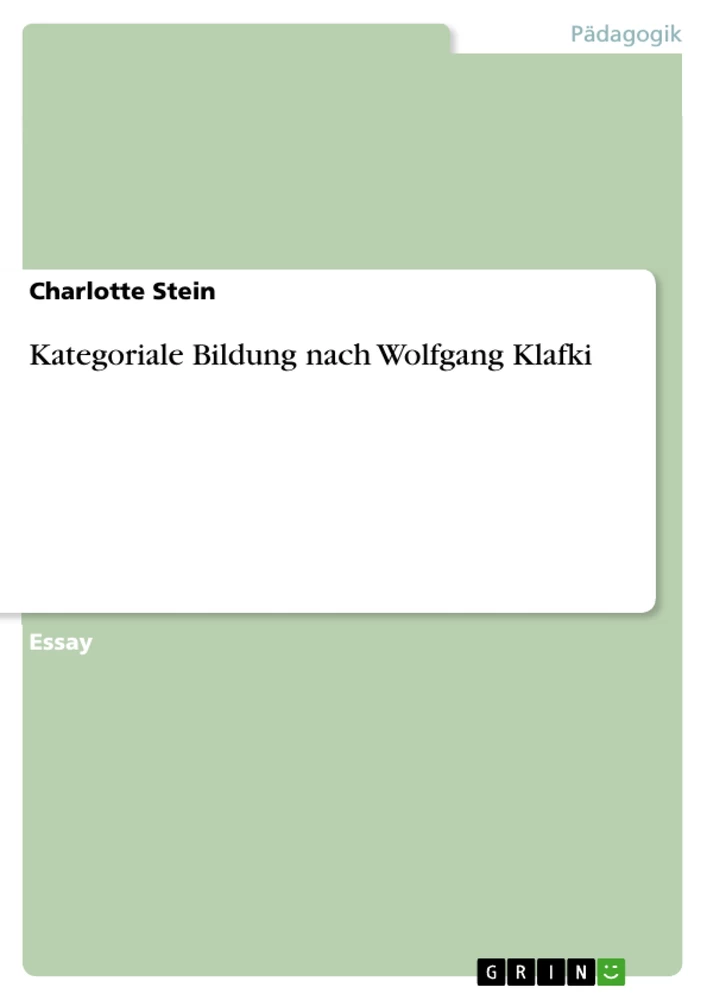
Essay , 2016 , 5 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Charlotte Stein (Autor:in)
Pädagogik - Wissenschaftstheorie, Anthropologie
Leseprobe & Details Blick ins Buch