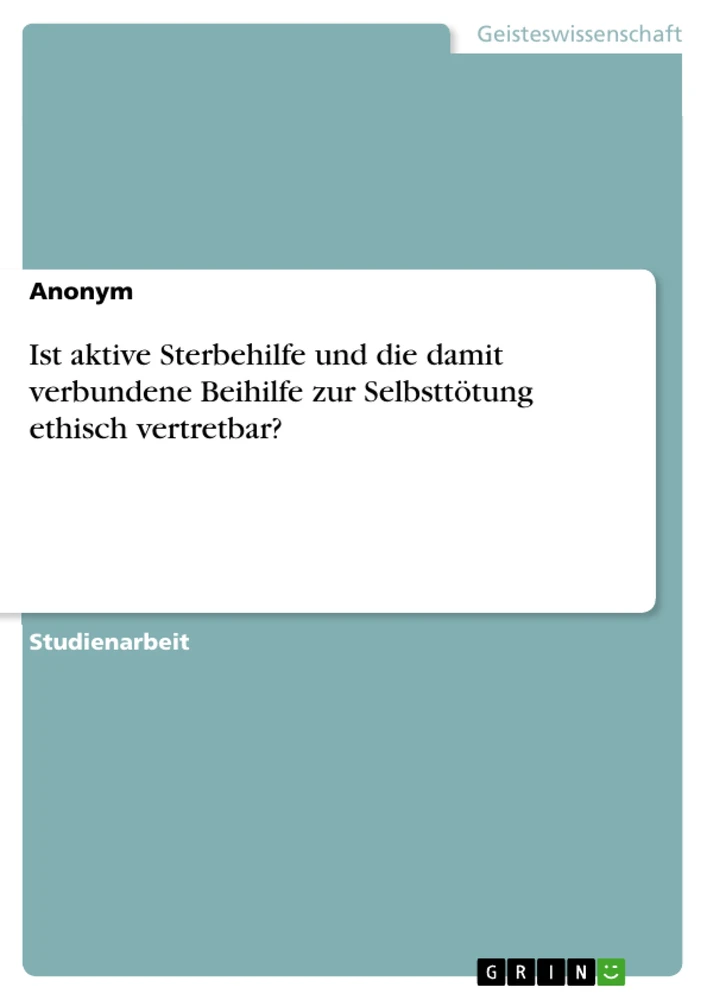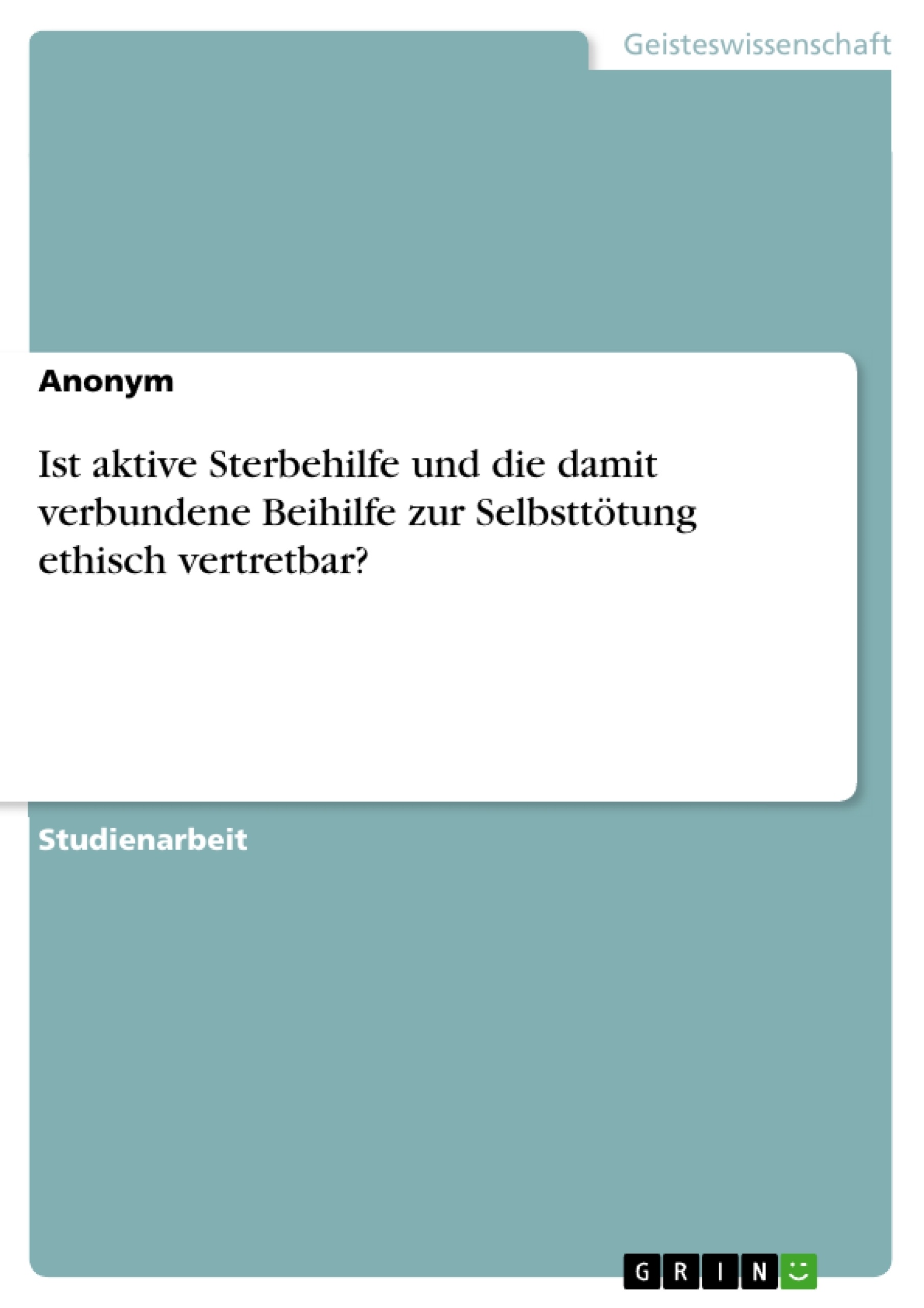Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die aktive Sterbehilfe in den Niederlanden und in Belgien legalisiert, in der Schweiz ist die Beihilfe zum Suizid keine Straftat mehr. Schwerkranken Menschen ist es dort möglich, auf eigenen und freien Willen hin von den Leiden und Qualen ihrer Krankheit befreit zu werden. Wir Deutschen werden schnell kleinlaut, wenn es um das Thema Tod geht. So auch, wenn über die Situation am Lebensende diskutiert wird. Vermutlich ist das auf unsere jüngste Geschichte zurückzuführen. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden über 100 000 Menschen mutwillig und geplant umgebracht. Ein Massenmord, von dem meist wehrlose Menschen, wie geistig und körperlich Behinderte, betroffen waren.
Obwohl das Thema Sterbehilfe in Deutschland vor einigen Jahren noch ein Tabuthema war, läuft jetzt die Debatte über die Einführung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids. Aufgrund eines gesellschaftlichen Wertewandels ist die Sterbehilfe nicht mehr derartig verrufen wie noch vor einigen Jahren. Der Drang nach einer persönlichen Selbstbestimmung ist ein wichtiger Faktor, der diese Debatte anheizt. Grund für die Diskussion ist aber der technische Fortschritt in der Medizin, welcher mittlerweile eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, schwere Krankheiten zu heilen oder zumindest das Leben um einige Monate oder sogar Jahre zu verlängern. Allerdings muss sich hierbei die Frage gestellt werden, bis zu welchem Gesundheits- beziehungsweise Krankheitsstatus ein würdiges Leben garantiert werden kann.
Im Folgenden soll ein Überblick über die deutsche Sterbehilfepolitik gegeben werden. Hierfür werden zuerst verschiedene Arten der Sterbehilfe aufgezeigt und ihre rechtlichen Grundlagen dargelegt. Anschließend folgt eine ethische Debatte über die Gründe, die für eine legale Sterbehilfe sprechen und die negativen Auswirkungen, welche dies zu Folge haben könnte. Für die Definitionen der Sterbehilfe und der Palliativmedizin und für die rechtlichen Grundlagen habe ich mich auf die Literaturrecherche bezogen, wohingegen die ethische Debatte meinen Argumenten zugrunde liegt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen
a. Aktive Sterbehilfe
b. Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid)
c. Passive Sterbehilfe
d. Indirekte Sterbehilfe
3. Rechtliche Grundlagen
4. Ethischer Diskurs
a. Gründe gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids
b. Gründe für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids
5. Palliativ Care als Alternative zum assistierten Suizid
a. Die Entwicklung von Palliativ Care
b. Zentrale Ziele
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die aktive Sterbehilfe in den Niederlanden und in Belgien legalisiert, in der Schweiz ist die Beihilfe zum Suizid keine Straftat mehr. Schwerkranken Menschen ist es dort möglich, auf eigenen und freien Willen hin von den Leiden und Qualen ihrer Krankheit befreit zu werden. Wir Deutschen werden schnell kleinlaut, wenn es um das Thema Tod geht. So auch, wenn über die Situation am Lebesende diskutiert wird. Vermutlich ist das auf unsere jüngste Geschichte zurückzuführen. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden über 100 000 Menschen mutwillig und geplant umgebracht. Ein Massenmord, von dem meist wehrlose Menschen, wie geistig und körperlich Behinderte, betroffen waren {Borasio 2012: 157–158}. Obwohl das Thema Sterbehilfe in Deutschland vor einigen Jahren noch ein Tabuthema war, läuft jetzt die Debatte über die Einführung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids. „Gemäß einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahr 2014 befürwortet eine klare Mehrheit die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe, der organisierten Beihilfe beim Freitod und der passiven Sterbehilfe, d. h. des Abbruchs lebensverlängernder Maßnahmen auf Wunsch des Patienten." {Preidel 2016: 1} Aufgrund eines gesellschaftlichen Wertewandels ist also die Sterbehilfe nicht mehr derartig verrufen, wie noch vor einigen Jahren. Der Drang nach einer persönlichen Selbstbestimmung ist ein wichtiger Faktor, der diese Debatte anheizt. Grund für die Diskussion ist aber der technische Fortschritt in der Medizin, welcher mittlerweile eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, schwere Krankheiten zu heilen oder zumindest das Leben um einige Monate oder sogar Jahre zu verlängern. Allerdings muss sich hierbei die Frage gestellt werden, bis zu welchem Gesundheits- beziehungsweise Krankheitsstatus ein würdiges Leben garantiert werden kann {Preidel 2016: 2}.
Im Folgenden soll ein Überblick über die deutsche Sterbehilfepolitik gegeben werden. Hierfür werden zuerst verschiedene Arten der Sterbehilfe aufgezeigt und ihre rechtlichen Grundlagen dargelegt. Anschließend folgt eine ethische Debatte über die Gründe, die für eine legale Sterbehilfe sprechen und die negativen Auswirkungen, welche dies zu Folge haben könnte. Für die Definitionen der Sterbehilfe und der Palliativmedizin und für die rechtlichen Grundlagen habe ich mich auf die Literaturrecherche bezogen, wohingegen die ethische Debatte meinen Argumenten zugrunde liegt.
2. Definitionen
Es ist zu unterscheiden zwischen der Sterbehilfe und der Sterbebegleitung. Die Sterbebegleitung ist die Hilfe beim Sterben. Die Betreuung der schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase, aber auch die Unterstützung ihrer Angehörigen. Den Betroffenen soll ein schöner Lebensabend beschert werden und ihr eigener Willen soll so weit wie möglich bis zum Lebensende erhalten bleiben und gehört werden. Dies wird in Palliativstationen und Hospizen umgesetzt, kann aber auch im Krankenhaus oder zu Hause stattfinden. „Die Sterbehilfe umschreibt Handlungen, welche eine Person tätigt, um eine sterbewillige Person darin zu unterstützen, den Todeswunsch umzusetzen.“ {Preidel 2016: 3} Davon gibt es verschiedene Arten der Durchführung und deren Bedeutungen. Folgend werden diese erläutert.
a. Aktive Sterbehilfe
Unter der aktiven Sterbehilfe versteht man „die direkte, aktive Beendigung des Lebens eines Menschen auf seinen expliziten Wunsch hin“ {Borasio 2012: 157} Die Sterbehelferin oder der Sterbehelfer führt hierbei aktiv die gewünschte Tötung durch, zum Beispiel durch Verabreichung eines Medikaments in tödlicher Dosierung. Dieser Vorgang wird auch „Tötung auf Verlangen“ genannt und ist nach dem deutschen Strafrecht §216 strafbar.
b. Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid)
Die Beihilfe zur Selbsttötung oder auch assistierter Suizid genannt, ist eine Form der aktiven Sterbehilfe, wobei es allerdings einen entscheidenden Unterschied gibt. Bei der aktiven Sterbehilfe führt ein Arzt und somit die Sterbehelfer*in aktiv die Tötung durch, bei der Beihilfe zur Selbsttötung stellt ein Dritter das Tötungsmittel bereit, die oder der Betroffene tötet sich aber durch die Einnahme des Medikamentes selbst. Man kann hier von einem Selbstmord sprechen, da der Tod selbständig zugeführt wird. Dadurch, dass das Tötungsmittel selbst zu sich genommen wird, hat der Sterbewillige bis zuletzt die alleinige Kontrolle über das Geschehen {Borasio 2012: 166}
c. Passive Sterbehilfe
Bei der passiven Sterbehilfe führt die Ärztin oder der Arzt die Tötung nicht aktiv durch, sondern lässt das Sterben zu, indem er Maßnahmen zu Lebensverlängerung, wie zum Beispiel die Ernährung durch eine Magensonde, beendet oder gar nicht erst durchführt. Dadurch wird der natürliche Sterbeprozess fortgeführt. Da durch das Einstellen der lebensverlängernden Maßnahmen der natürliche Sterbeprozess wieder einsetzt, wird die durchführende Ärztin oder der durchführende Arzt zum Sterbehelfer und leistet passive Sterbehilfe. Zwei Gründe führen zu diesem Handeln von Seiten der Behandelnden: zum einen die Ablehnung derartiger Maßnahmen durch die Patienten, zum anderen fehlende medizinische Indikatoren {Borasio 2012: 159–161}. „Damit ist die ärztliche Entscheidung über die Sinnhaftigkeit einer medizinischen Maßnahme gemeint, und zwar unabhängig vom Patientenwillen“ {Borasio 2012: 160} Um den Prozess der passiven Sterbehilfe und die damit verbundenen medizinischen Entscheidungen von Seiten der behandelnden Ärztinnen und Ärzte kontrollieren zu können, gibt es seit einigen Jahren eine sogenannte Patientenverfügung. Die Betroffenen können vorab schriftlich oder mündliche festhalten, wie sie bei Verlust ihres Bewusstseins behandelt werden möchten und wie ihr Lebensende im Falle einer unheilbaren Krankheit verlaufen soll. So wird auf der einen Seite der freie Wille der Patienten bewahrt, auf der anderen Seite sind die Ärztinnen und Ärzte bei passiver Sterbehilfe rechtlich abgesichert {Preidel 2016: 3}. Da auch aktive Handlungen, wie das Beenden der künstlichen Beatmung durch Ausschalten der Maschine, unter die passive Sterbehilfe fallen, ist dieser Begriff nicht unumstritten {Borasio 2012: 160}.
d. Indirekte Sterbehilfe
Die indirekte Sterbehilfe lehnt sich an „die Lehre des Doppeleffekts“ nach dem heiligen Thomas von Aquin. Diese besagt, dass eine Handlung ethisch vertretbar wäre, wenn damit ein guter Zweck verfolgt werden würde, auch wenn damit eine negative Nebenfolge eintritt, die allerdings nicht als Zweck der Handlung vorgesehen war {Borasio 2012: 163}. Um die Schmerzen und Leiden eines schwerkranken Menschen am Ende seines Lebens zu lindern, dürfen Schmerzmittel in hoher Dosis verabreicht werden. „Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich festgestellt, dass es erlaubt und sogar geboten ist, schmerzlindernde Medikamente auch in einer Dosis zu verabreichen, die als unbeabsichtigte Nebenwirkung die Sterbephase verkürzen könnte, wenn es keinen anderen Weg zur ausreichenden Schmerzlinderung gibt.“ {Borasio 2012: 163}
Da diese Begriffe in unserer Gesellschaft nicht gerne in den Mund genommen werden, stellt Borasio einige Verschönerungen dar, wobei er die aktive Sterbehilfe als Tötung auf Verlangen und die passive Sterbehilfe als ein Sterbenlassen oder ein Zulassen des Sterbens durch einen Behandlungsabbruch bezeichnet. Die indirekte Sterbehilfe ist für ihn eine "zulässige Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung" {Borasio 2012: 166}
3. Rechtliche Grundlagen
Strafgesetzbuch(StGB)
§ 216 Tötung auf Verlangen
(1) Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.
(2) Der Versuch ist strafbar.
[...]