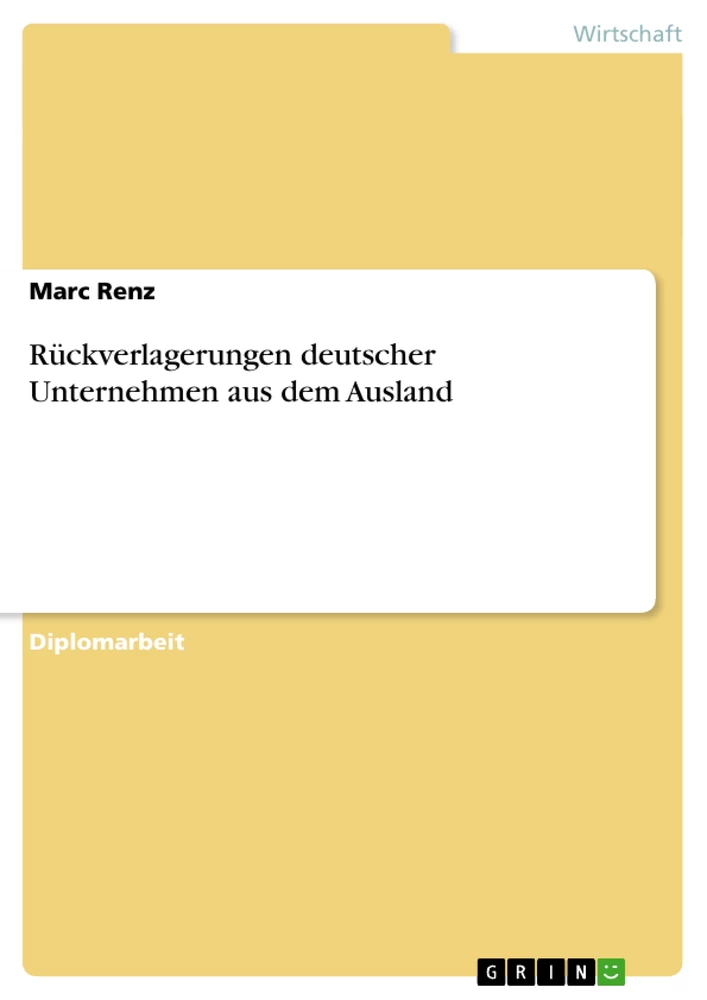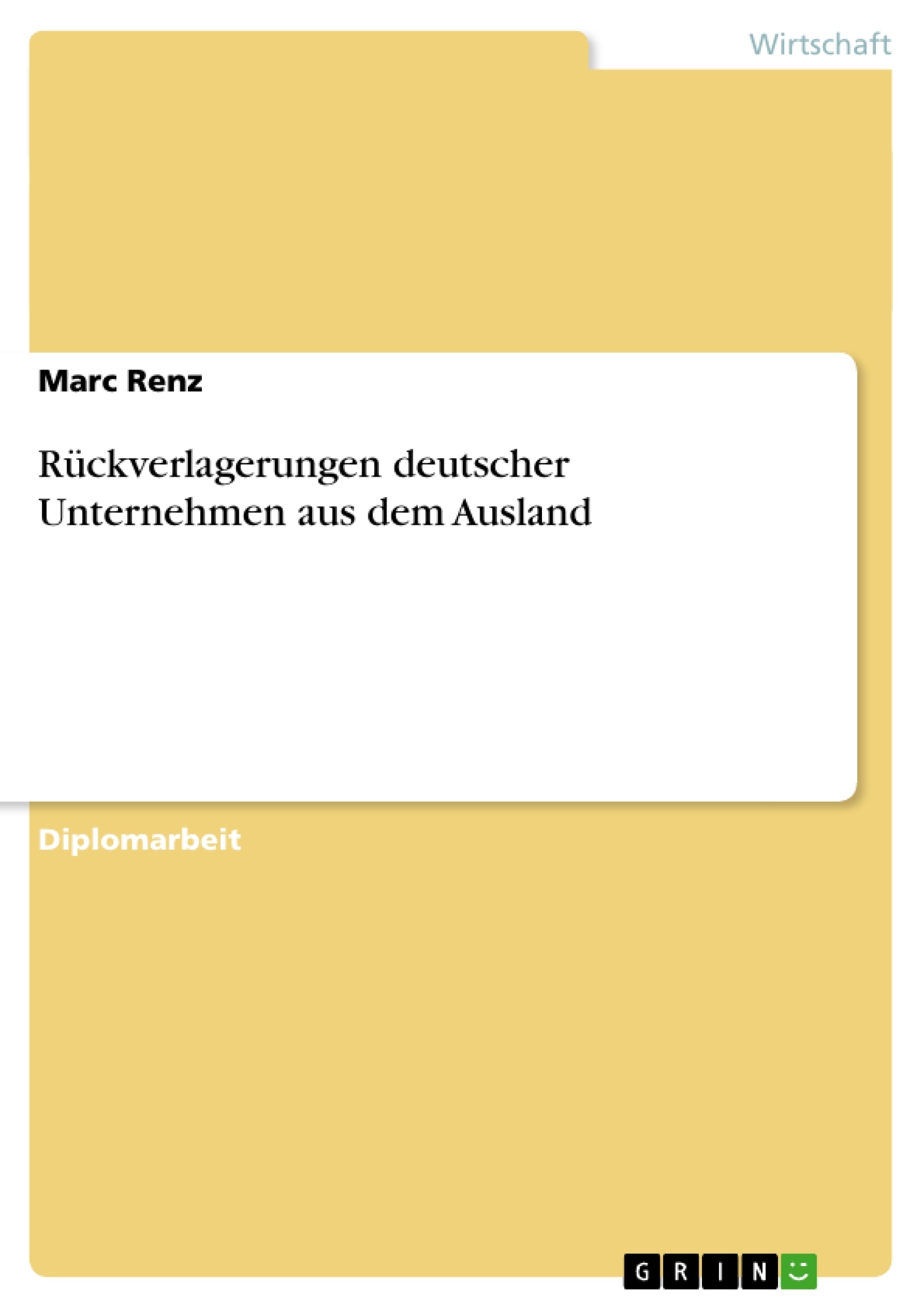Die Bedeutung der Internationalisierung von Unternehmen hat in den letzten Jahren verstärkt zugenommen. Im Zuge der Internationalisierung verlagern Unternehmen Funktionsbereiche ins Ausland. Sehr oft stehen bei diesen Verlagerungen Kostengründe im Vordergrund. Nicht nur von der Presseberichterstattung, sondern auch von der breiten Öffentlichkeit werden die Verlagerungen von Funktionsbereichen negativ bewertet. Besonders groß ist die Sorge, dass deutsche Arbeitsplätze durch die Aus-landsverlagerungen der Unternehmen abgebaut werden. Neuere Studien zeigen auch, dass die Verlagerungen von Funktionsbereichen von in Deutschland ansässigen Unternehmen ins Ausland in den nächsten Jahren weiter zunehmen werden (vgl. DIHK 2003: 1). Jedoch werden immer wieder Fälle von Unternehmen bekannt, die den umgekehrten Weg gehen und Funktionsbereiche aus dem Ausland wieder zurückverlagern. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welches die wesentlichen Gründe von deutschen Unternehmen sind, Rückverlagerungen aus dem Ausland vorzunehmen. Diese Frage ergibt sich zwangsweise, da diese Unternehmen offensichtlich gegen den Trend handeln. Statt einer Verlagerung ins Ausland wird der umgekehrte Weg eingeschlagen und eine Rückverlagerung nach Deutschland vorgenommen. Um der Frage nachzugehen, welches die wesentlichen Gründe für Rückverlagerungen deutscher Unternehmen aus dem Ausland darstellen, werden zuerst die Grundlagen der Rückverlagerung geklärt. Hierzu werden der Begriff, die Formen und die Phasen der Rückverlagerung dargestellt. Danach wird der Stand der Forschung und Presseberichterstattung zum Thema Rückverlagerung aufgezeigt. Im nächsten Kapitel werden Theorien vorgestellt, die eventuelle Erklärungen für Rückverlagerungen von Unternehmen liefern können. Diese theoretischen Modelle lassen sich zu den Theorien der internationalen Arbeitsteilung, Standortfaktorensystematiken, der Be-havioristische Theorie und den Direktinvestitionstheorien zuordnen. Nachdem diese Theorien vorgestellt und ihre möglichen Erklärungen, die sie für Rückverlagerung deutscher Unternehmen aus dem Ausland liefern, aufgezeigt wurden, werden aus diesen Erklärungen Hypothesen abgeleitet, die mögliche Begründungen für Rückverlagerungen darstellen. [...]
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Siglenverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen der Rückverlagerung
2.1 Begriff, Formen und Phasen der Rückverlagerung
2.2 Stand der Forschung und Presseberichterstattung
3. Ausgewählte theoretische Ansätze zur Erklärung von Rückverlagerungen
3.1 Theorien der internationalen Arbeitsteilung
3.2 Standortfaktorensystematiken
3.3 Behavioristische Theorie
3.4 Direktinvestitionstheorien
4 Ableitung von Hypothesen aus den theoretischen Ansätzen
5. Fallstudien von Rückverlagerungsfällen
5.1 Vorgehen und Datenerhebung
5.2 Produktionsrückverlagerung der Varta Microbattery GmbH
5.3 Produktionsrückverlagerung der Lemken GmbH & Co. KG
6. Hypothesenprüfung
6.1 Hypothesenprüfung anhand der Fallstudien
6.1.1 Hypothesenprüfung anhand von Varta Microbattery
6.1.2 Hypothesenprüfung anhand von Lemken
6.1.3 Kritische Beurteilung
6.2 Hypothesenprüfung anhand weiterer Untersuchungen
6.2.1 Entwicklung der Rückverlagerungsquote und Länderrisiken
6.2.2 Wissenschaftliche Studien über Rückverlagerungen
6.2.3 Presseberichterstattung
6.2.4 Betrachtung von in Deutschland produzierenden Unternehmen
6.2.5 Kritische Beurteilung
6.3 Zusammenfassung der Hypothesenprüfung
7. Schlussbetrachtung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Standortfaktorensystematik nach BESTAND
Abb.2: Überblick über die Hypothesenbildung
Abb.3: Verlagerungen und Rückverlagerungen im Zeitverlauf
Abb.4: Versteckte Kosten der Auslandsproduktion
Abb.5: Überblick über die Hypothesenprüfung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Siglenverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tab.1: Vorteile im Rahmen des OLI-Paradigmas
Tab.2: Angewande Theorien und ihre Erklärungen für Rückverlagerungen
Tab.3: EUROMONEY-Risikoindex (1994-2003)
Tab.4: Risikoindikatoren und Rückverlagerungen im Zeitverlauf
Tab.5: Beispiel für Rückverlagerungen
1. Einleitung
Die Bedeutung der Internationalisierung von Unternehmen hat in den letzten Jahren verstärkt zugenommen. Im Zuge der Internationalisierung verlagern Unternehmen Funktionsbereiche ins Ausland. Sehr oft stehen bei diesen Verlagerungen Kostengründe im Vordergrund. Nicht nur von der Presseberichterstattung, sondern auch von der breiten Öffentlichkeit werden die Verlagerungen von Funktionsbereichen negativ bewertet. Besonders groß ist die Sorge, dass deutsche Arbeitsplätze durch die Auslandsverlagerungen der Unternehmen abgebaut werden. Neuere Studien zeigen auch, dass die Verlagerungen von Funktionsbereichen von in Deutschland ansässigen Unternehmen ins Ausland in den nächsten Jahren weiter zunehmen werden (vgl. DIHK 2003: 1). Jedoch werden immer wieder Fälle von Unternehmen bekannt, die den umgekehrten Weg gehen und Funktionsbereiche aus dem Ausland wieder zurückverlagern. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welches die wesentlichen Gründe von deutschen Unternehmen sind, Rückverlagerungen aus dem Ausland vorzunehmen. Diese Frage ergibt sich zwangsweise, da diese Unternehmen offensichtlich gegen den Trend handeln. Statt einer Verlagerung ins Ausland wird der umgekehrte Weg eingeschlagen und eine Rückverlagerung nach Deutschland vorgenommen.
Um der Frage nachzugehen, welches die wesentlichen Gründe für Rückverlagerungen deutscher Unternehmen aus dem Ausland darstellen, werden zuerst die Grundlagen der Rückverlagerung geklärt. Hierzu werden der Begriff, die Formen und die Phasen der Rückverlagerung dargestellt. Danach wird der Stand der Forschung und Presseberichterstattung zum Thema Rückverlagerung aufgezeigt. Im nächsten Kapitel werden Theorien vorgestellt, die eventuelle Erklärungen für Rückverlagerungen von Unternehmen liefern können. Diese theoretischen Modelle lassen sich zu den Theorien der internationalen Arbeitsteilung, Standortfaktorensystematiken, der Behavioristische Theorie und den Direktinvestitionstheorien zuordnen. Nachdem diese Theorien vorgestellt und ihre möglichen Erklärungen, die sie für Rückverlagerung deutscher Unternehmen aus dem Ausland liefern, aufgezeigt wurden, werden aus diesen Erklärungen Hypothesen abgeleitet, die mögliche Begründungen für Rückverlagerungen darstellen. Im nächsten Kapitel werden die Erfahrungen, die die Unternehmen Varta Microbattery GmbH und Lemken GmbH & Co. KG mit einer Produktionsrückverlagerung in den Neunziger Jahren gesammelt haben, anhand von teilweise selbsterstellten Fallstudien aufgearbeitet. Bei den Fallstudien werden insbesondere die Verlagerungsphase ins Ausland, die Phase der Auslandsproduktion mit eventuellen Schwierigkeiten, die am ausländischen Standort auftraten, dargestellt. Des Weiteren werden die Gründe für die damalige Rückverlagerung nach Deutschland aufgezeigt. In einem nächsten Schritt wird eine Prüfung der zuvor getroffenen Hypothesen durchgeführt. Hierbei wird zunächst untersucht, welche Hypothesen die Produktionsrückverlagerungen von Varta Microbattery und Lemken unterstützen. Diese Untersuchung wird anschließend kritisch beurteilt. Daraufhin werden die getroffenen Hypothesen anhand weiterer Untersuchungen überprüft. Als erstes wird hierbei untersucht, ob sich Veränderungen der Standortqualität verschiedener Standorte auf das Ausmaß von Produktionsrückverlagerungen nach Deutschland auswirken. Um die Veränderung von Standortqualitäten von alternativen Standorten zu messen, wird der EUROMONEY-Länderrisikoindex herangezogen. Für die weitere Überprüfung der Hypothesen werden die Ergebnisse von weiteren wissenschaftlichen Studien und der Untersuchung von Presseberichten analysiert, die sich mit dem Thema Rückverlagerungen deutscher Unternehmen aus dem Ausland beschäftigen. Die Hypothesenprüfung wird mit der Betrachtung von Unternehmen betrachtet, die bewusst weiter in Deutschland produzieren, abgerundet. Diese liefern möglicherweise Hinweise, warum die Unternehmen Funktionsbereiche wieder nach Deutschland verlagern. Diese weiterführende Hypothesenprüfung wird anschließend kritisch beurteilt. Daraufhin werden die Ergebnisse der Hypothesenprüfung noch einmal zusammengefasst und ein Fazit aus der Hypothesenprüfung wird dargestellt. Die Arbeit wird abgerundet durch eine Schlussbetrachtung und ein Ausblick.
2. Grundlagen der Rückverlagerung
2.1 Begriff, Formen und Phasen der Rückverlagerung
Bei einer Rückverlagerung handelt es sich um eine Standortentscheidung eines Unternehmens. Dabei setzt sich diese Standortentscheidung aus zwei aufeinanderfolgenden Standortentscheidungen zusammen (vgl. Schulte 2002: 97).
Hierbei wird zu einem Zeitpunkt entschieden, einen Funktionsbereich an einen ausländischen Standort zu verlagern.
Nach einer Phase der Auslandsproduktion trifft das Unternehmen erneut eine Standortentscheidung. Es verlagert den Funktionsbereich ganz oder teilweise wieder zurück ins Heimatland (vgl. Schulte 2002: 97). Die erste Standortentscheidung wird durch die Rückverlagerung sozusagen wieder rückgängig gemacht (vgl. Lay et al. 2001: 182). Es findet wieder wenigstens zeitweise eine Konzentration am heimischen Standort statt (vgl. Schulte 2002: 97). Somit lässt sich als Definition für Rückverlagerungen folgende Formulierung heranziehen:
Bei einer Rückverlagerung handelt es sich um eine Standortentscheidung eines Unternehmens. Es wird einer oder mehre Funktionsbereiche eines Unternehmens zumindest zeitweise in das Land zurückverlagert, in dem das Unternehmen seinen Firmensitz hat. Der Rückverlagerung eines Funktionsbereichs sind eine Verlagerung dieses Funktionsbereichs ins Ausland und eine Phase der Auslandstätigkeit dieses Funktionsbereiches vorausgegangen.
Im Folgenden werden Produktionsrückverlagerungen als repräsentativ für Rückverlagerungen angesehen. Diese Einschränkung macht u.a. deshalb Sinn, da der Funktionsbereich Fertigung auch den größten Anteil an durchgeführten Rückverlagerungen einnimmt.[1] Eine Rückverlagerung wird aber bei diesem Begriff nicht so eng gefasst, dass ein Produktionsbereich, der aus dem Ausland zurückverlagert wird, wieder in die Produktion des Unternehmens am heimischen Standort eingegliedert werden muss. Ferner können bei einer Rückverlagerung auch die Produktionsbereiche, die aus dem Ausland verlagert werden auch an inländische Zulieferer ausgelagert werden.
Dies drückt sich auch darin aus, dass in der Literatur zwischen direkter und indirekter Rückverlagerung unterschieden wird. Bei einer direkten Rückverlagerung wird der Teil, der ausgelagert wurde, wieder in die eigene Produktion eingegliedert. Unter einer indirekten Rückverlagerung wird der verlagerte Teil teilweise oder ganz am heimischen Standort konzentriert, wie es zum Beispiel bei einer Auslagerung auf heimische Zulieferer der Fall ist. Jungnickel fasst den Begriff der Rückverlagerung noch weiter. Für ihn ist eine Rückverlagerung jede Substituierung von Importen durch die Produktion in Deutschland (vgl. Jungnickel 1990: 25). So weit soll der Rückverlagerungsbegriff in dieser Arbeit aber nicht gefasst werden.
Es gibt verschiedene Formen von Rückverlagerungen. Dabei lassen sich Rückverlagerungen vor allem anhand zwei Kriterien unterschieden. Zum einen anhand der Funktionsbereiche, die rückverlagert werden, zum anderen anhand des Rückverlagerungsumfangs. Eine Rückverlagerung kann alle, früher einmal ins Ausland verlagerte Funktionsbereiche, betreffen. Zu nennen wären hier z.B. die Produktion, die Forschung und Entwicklung und die Administration. Wie bereits oben erwähnt, werden im Folgenden Produktionsrückverlagerungen als repräsentativ angesehen.
Nach dem Umfang lässt sich eine Teil- bzw. Komplettrückverlagerung unterscheiden. Wobei bei der Teilverlagerung nur eine Modifikation der damaligen Verlagerungsentscheidung betrieben wird, aber am ausländischen Standort weiterhin festgehalten wird (vgl. Schulte 2002: 101f.).
Während in den traditionellen Standorttheorien einperiodige Verlagerungsentscheidungen betrachtet werden, muss bei einer Betrachtung von Rückverlagerungen die Standortentscheidung des Unternehmens über einen gewissen Zeitraum beobachtet und untersucht werden. Hierbei lässt sich dieser Zeitraum in drei Phasen der Rückverlagerung unterteilen. Diese Phasen sind die Verlagerungsphase ins Ausland, die Phase der Auslandsproduktion und die Rückverlagerungsphase. Durch die Einteilung in Phasen lässt sich das Phänomen Rückverlagerung einfacher untersuchen (vgl. Schulte 2002: 97f.). Um die Gründe für die Rückverlagerung deutscher Unternehmen aus dem Ausland untersuchen zu können, ist es nötig, jede einzelne Phase zu untersuchen und aus der Untersuchung Rückschlüsse auf die erfolgte Rückverlagerungsentscheidung eines Unternehmens zu ziehen.
In der Verlagerungsphase wird die erste Standortentscheidung getroffen. Betroffen können hier sämtliche Funktionsbereiche einer Unternehmung sein (vgl. Schulte 2002: 98f.).[2] Oftmals werden hierbei Verlagerungen in Niedriglohnländer vorgenommen.
Auf die Verlagerungsphase folgt die Phase der Auslandsproduktion. Die Auslandsproduktionsphase endet damit, dass die in der ersten Phase getroffene Verlagerungsentscheidung noch einmal überdacht wird und anschließend revidiert bzw. modifiziert wird. Die dritte und letzte Phase stellt die Rückverlagerungsphase dar. In dieser Phase wird eine neue internationale Standortentscheidung zugunsten des heimischen Standortes getroffen. Kapazitäten werden in dieser Phase wieder an den heimischen Standort verlagert (Vgl. Schulte 2002: 101f.).
2.2 Stand der Forschung und Presseberichterstattung
In den Neunziger Jahren erschienen erste Presseberichte, die sich mit dem Thema Rückverlagerung auseinandersetzen. In diesen Artikeln werden zumeist Fallbeispiele von Unternehmen dargestellt, die aus dem Ausland rückverlagert haben.
Hierbei erhalten rückverlagernde Unternehmen Attribute wie „Reumütige Rückkehrer“ (Müller 1996: 258). In den Presseberichten werden meist exemplarisch größere Unternehmen aufgezählt, die eine Rückverlagerung aus dem Ausland vorgenommen haben. Dabei wird zumeist nur ein Augenmerk auf das Versagen des Managements und dem darausfolgenden Scheitern der Internationalisierungsstrategie gelegt (vgl. Schulte 2002: 105). Borgmann/Klostermeyer/Lüdicke (2000) stellen eine Übersicht von Rückverlagerungsfällen aus der Presseberichterstattung mit den jeweiligen Rückverlagerungsgründen dar. Des Weiteren lassen sich immer wieder in der betriebswirtschaftlichen Literatur Fallbeispiele von rückverlagernden Unternehmen finden.[3]
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Rückverlagerung wurden zum ersten Mal in den Achtziger Jahren angestellt. Hierbei wurde von einer sogenannten „Rückverlagerungsthese“ ausgegangen. Es wurde davon ausgegangen, dass es aufgrund der Veränderung in der Mikroelektronik zu einer Modifizierung in der Kostenrechnung kommen würde und es somit verstärkt zu Produktionsrückverlagerungen aus Niedriglohnländer kommen würde (vgl. Olle 1985: 17). Durch den Fortschritt in der Mikroelektronik und der daraus resultierenden Verbesserung vorhandener und der Entwicklung neuer Produkte sollte es zu Produktivitätssteigerungen kommen. Diese Produktivitätssteigerungen sollten zusätzlich zu einer verstärkten Zahl von Rückverlagerungen aus den Entwicklungsländern führen (vgl. Jungnickel 1990: 15f.). Als weitere Gründe für die Rückverlagerung vor allem die Instabilität in Entwicklungsländern, des Weiteren der Protektionismus von den Industrieländern und schließlich den abnehmenden Einfluss, den Gewerkschaften in Industrieländern ausüben, aufgeführt (vgl. Junne 1985: 149). Diese Rückverlagerungsthese wurde daraufhin in mehreren Untersuchungen überprüft. Keine der Studien konnte aber einen Rückverlagerungstrend aus Billiglohnländer bestätigen (vgl. Jungnickel 1990; vgl. Lücke 1992).
[...]
[1] Aus einer Studie der Transfer Centrum GmbH& Co. KG für Produktions-Logistik und Technologiemanagement geht hervor, dass in den Jahren 2000-2004 folgende Funktionsbereiche zu folgenden Anteilen rückverlagert wurden: Produktion: 62,5 % (Montage: 25 %, Fertigung: 32,5 %), Administration: 12,5 %, Forschung und Entwicklung: 12,5 % und Sonstiges: 12,5 %. Befragt wurden hierbei vor allem Unternehmen aus der Automobilindustrie, Blech- und Metallverarbeitung, Kunst und Naturstoffbearbeitung, Chemieindustrie, dem Anlagen- und Maschinenbau, der Elektroindustrie, dem Dienstleistung und Handel und der Luftfahrt- und Flugzeugindustrie (vgl. TCW 2004: 16).
[2] In der Untersuchung der Transfer Centrum sind dies in den Jahren 2000-2004: Produktion: 63 % (Montage: 24 %, Fertigung: 39 %), Service: 11 %, Einkauf: 9 %, Forschung und Entwicklung: 7 %, Vertrieb: 5 %, Administration: 4 % und Sonstige: 1 %.
[3] U.a. stellen Lay et al. (2000: 167ff.) die Rückverlagerung von dem Hersteller von Gummihandschuhen KCL dar. Auch Stamm/Lensen/Beutler (2000: 76f.) berichtet von einem Rückverlagerungsfall eines Trauerkartenherstellers.