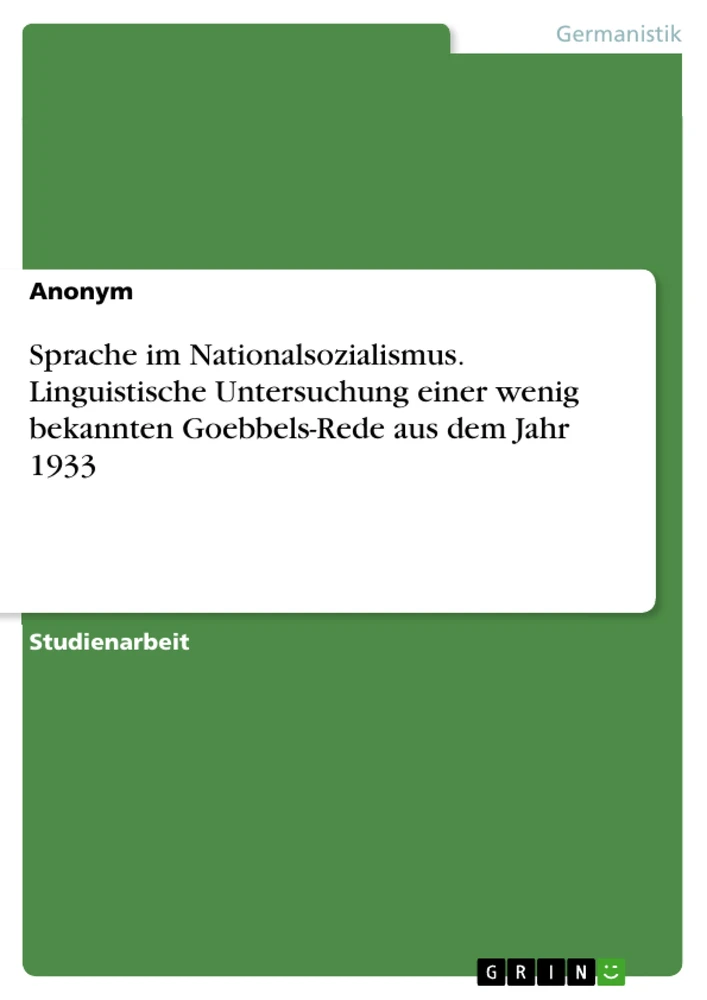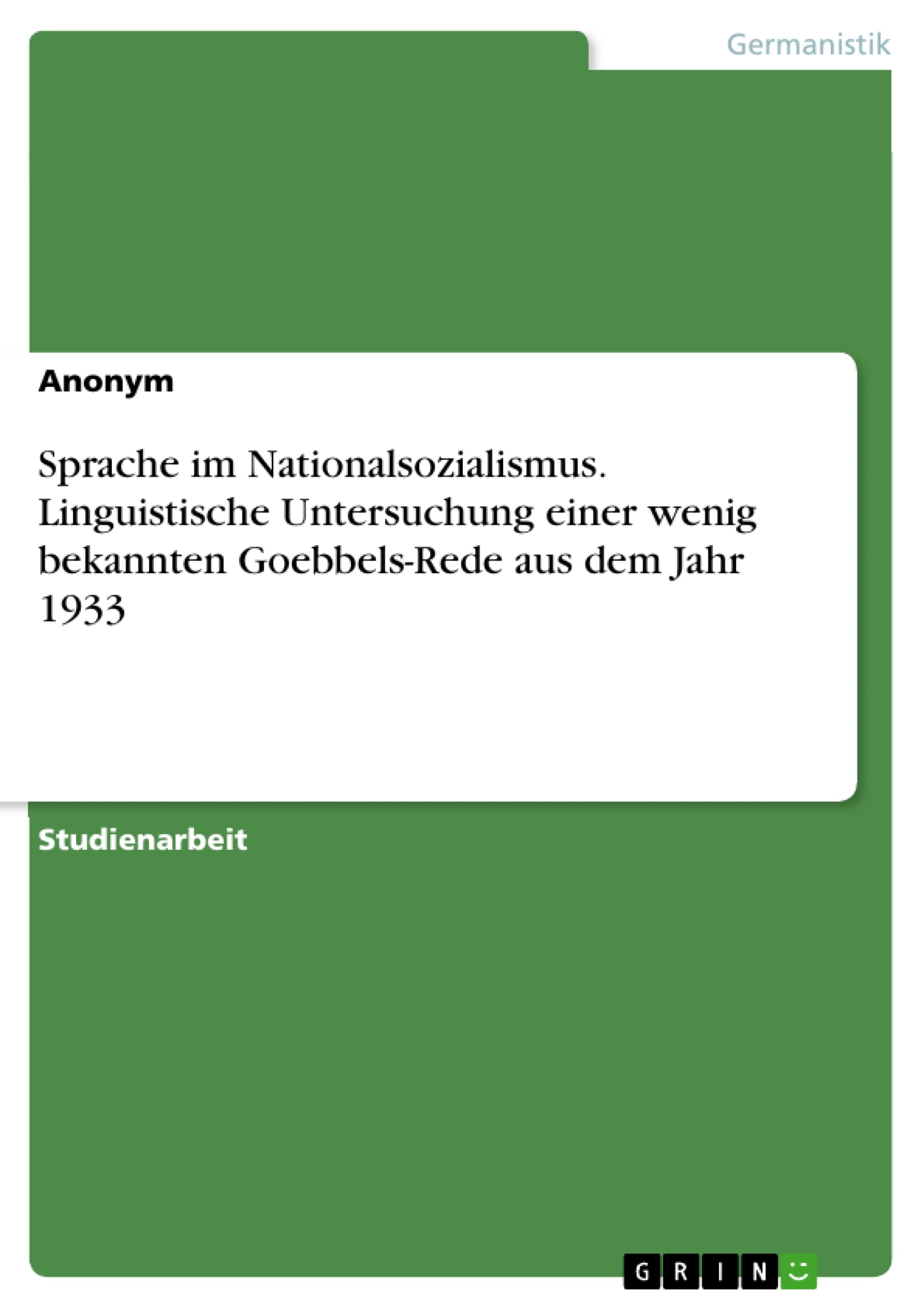Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass sich in der hier zu analysierenden Rede von Joseph Goebbels vom 01. April 1933 ein nationalsozialistischer Stil ausfindig machen lässt, der durch sprachliche Mittel dazu beiträgt, die politischen Ziele der NSDAP innerhalb des deutschen Volkes umzusetzen.
Die Arbeit beginnt mit der Nachzeichnung des aktuellen Forschungstandes, um auf aktuelle Debatten einzugehen und diese, falls dies sich anbietet, für die Analyse der Rede brauchbar zu machen. Um der These nachzugehen, dass nationalsozialistischer Sprachstil stets auch ideologische Kommunikation darstellt und zumeist eine Appelfunktion zukommt, wird in einem ersten Schritt zunächst der politische Zusammenhang der Rede vom 01. April 1933 erörtert. Dies ist notwendig, da eine sprachliche Untersuchung stets „im Kontext der konkreten historisch-politischen Situation bewertet [werden muss] (Girnth 2002: 3). Hierzu gehört auch, die nähere Betrachtung des Propagandaministers Joseph Goebbels, der die Rede im Sinne der nationalsozialistischen Regierung verfasste, und in Berlin vor mehreren tausend Zuhörern vortrug.
Die sprachliche Analyse konzentriert sich anschließend auf die Ziele, die mithilfe der Rede erreicht werden sollen und wie diese sprachlich umgesetzt werden. Im Vordergrund steht hierbei die Untersuchung des Perlukutionspotentials und der ideologischen Manipulation.
Ob sich die formulierten Thesen durch die Analyse bestätigen lassen, wird im Schlussteil unter Hinzunahme der einzelnen Kapitel, kritisch reflektiert.
Inhalt
1. Einleitung
2. Forschungsstand
3. Kontext und Kriterien für die Auswahl
3.1. Die Person Joseph Goebbels
3.2. Aufführungscharakter nationalsozialistischer Reden und deren Wirkung
4. Die Ziele der Rede vom 01. April 1933
5. Sprachliche Analyse
5.1. Volk und Regierung als ideologisierte Gemeinschaft
5.2. Volk und Regierung im Kampf gegen die Gegner
5.2.1. Lüge und Wahrheit und die Bedeutung der Greuelpropaganda im Bezug zur Volksbildung und der Herausbildung einer Gegnerschaft
5.3. Sprachliche Stilistika: dienen als Unterstützung der nationalsozialistischen Ziele
6. Schlussbetrachtung
7. Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Sekundärliteratur
Internetquellen
8. Anhang
8.1. Rede in Berlin am 01. April 1933 (Goebbels 1933: 155-161)
8.2. Tabelle 1: Feindbilder und deren Kontrastierung durch Volksformation
8.3. Tabelle 2: Weitere Merkmale des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs
1. Einleitung
Jede Sprache, die sich frei betätigen darf, dient allen menschlichen Bedürfnissen, sie dient der Vernunft wie dem Gefühl, sie ist Mitteilung und Gespräch, Selbstgespräch und Gebet, Bitte, Befehl und Beschwörung. Die LTI dient einzig der Beschwörung. In welches private oder öffentliche Gebiet auch immer das Thema gehört-nein, das ist falsch, die LTI kennt sowenig ein privates Gebiet im Unterschied vom öffentlichen, wie sie geschriebene und gesprochene Sprache unterscheidet-, alles ist Rede, und alles ist Öffentlichkeit. »Du bist nichts, dein Volk ist alles« (Klemperer 199616: 36)
Anhand dieser Aussage Victor Klemperers wird deutlich, welche Funktion und Macht die Sprache im Dritten Reich tatsächlich eingenommen hat. Der Philologe hat als Zeitzeuge die Wirkung der Sprache im Nationalsozialismus am eigenen Leib erfahren können und seine Beobachtungen in eindrucksvoller Weise in seinem Werk LTI (Lingua Tertii Imperii), Notizbuch eines Philologen geschildert. Selbstverständlich beruht eine diktatorische Herrschaft vornehmlich auf psychischer Gewalt, die gegen jedermann eingesetzt wird, der diese Herrschaft gefährdet oder auch nur geringfügig bedroht. In Deutschland ist die NS-Diktatur der Beweis dieser politischen Definition. Damit eine Diktatur zustande kommt müssen sich zunächst Minderheiten durchsetzen und eine Arena für ihr Vorhaben finden. Dazu gehört der Aspekt des Überzeugens einer breiten Öffentlichkeit.
Damit sich die Gewaltherrschaft dauerhaft an der Macht hält, muss eine völlige Übereinkunft mit dem Volk erzeugt werden. Hierzu reicht aber eine rein physische Gewalt1 alleine nicht aus, um die Bevölkerung dauerhaft an die Diktatur zu binden.
Deshalb ist es unabdinglich sprachliche Mittel einzusetzen, da „Sprache […] unweigerlich die Wahrnehmung, kurz das Denken des Menschen [beeinflusse] und […]daher manipulatorischen Charakter [besäße]“ (Braun 2007: 1).2 Hier muss zudem mitgedacht werden, dass nicht nur die Sprache als solche manipulativ sein kann sondern auch die „Sprachlosigkeit“ (Bauer 1988, Titel).3 Die Macht des freien Wortes, als einzige Waffe der Opposition verliert ihre Gültigkeit, sobald diese wie in Diktaturen üblich, unterbunden wird (vgl. Schlosser 2013: 9).4 Demnach ist nicht nur das Gesagte von Relevanz sondern auch das nicht Gesagte.
Zweifelsohne wirkt Sprache nicht ausnahmslos durch die Wahl der richtigen Worte. Anhand der Werbung wird dies immer wieder deutlich: Bilder, Töne, Personen etc. haben einen entscheidenden Anteil an der Form des Sprachtransportes. Aber betrachtet man lediglich die Sprache als solches im Nationalsozialismus, dann wird deutlich, dass sie sich verschiedener Mittel bedient, welche einen manipulierenden Charakter aufweisen. Die Manipulation der Sprache hat auch heutzutage trotz der mittlerweile bewussten Vergangenheit ihre Arenen. Sei dies im politischen Kontext, zu erwähnen sei hier der Einzug der rechtspopulistischen AFD5, in drei Landesparlamente (vgl. www.n-tv.de), die Manipulation Jugendlicher durch den IS6 (vgl. www.zeit.de), die je nach Kontext unterschiedliche Wahrnehmung und Bezeichnung der „Flüchtlingsproblematik“7 (vgl. gfds.de) und vielerlei Beispiele mehr. Es scheint fast so, dass Manipulation eines der entscheidenden Merkmale der Sprache konstituiert.
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit von einem dialektischen Zusammenhang zwischen Sprache, Ideologie und Propaganda ausgegangen. Die Verbreitung der Ideologie, das Werben für die solche und auch die Festigung dieser vollzog sich primär durch Sprache, die mit Arnold als „ideologische Kommunikation“ (Arnold 2003: Titel) verstanden werden soll. Auch Bernhard Pörksen zeichnet dieses Bild indem er die Ideologie einer Gruppe als „sprachbestimmend“ ansieht, welche den „faktoriellen Rahmen der Sprachbeeinflussung“ bildet und als Instrument der Ideologie verstanden werden kann (Pörksen 2000: 35).
Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass sich in der hier zu analysierenden Rede von Joseph Goebbels vom 01. April 1933, also vier Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten8, ein nationalsozialistischer Stil ausfindig machen lässt, der durch sprachliche Mittel dazu beiträgt, die politischen Ziele der NSDAP innerhalb des deutschen Volkes umzusetzen.
Die Arbeit beginnt mit der Nachzeichnung des aktuellen Forschungstandes, um auf aktuelle Debatten einzugehen und diese, falls dies sich anbietet, für die Analyse der Rede brauchbar zu machen. Um der These nachzugehen, dass nationalsozialistischer Sprachstil stets auch ideologische Kommunikation darstellt und zumeist eine Appelfunktion zukommt, wird in einem ersten Schritt zunächst der politische Zusammenhang der Rede vom 01. April 19339 erörtert. Dies ist notwendig, da eine sprachliche Untersuchung stets „im Kontext der konkreten historisch-politischen Situation bewertet [werden muss] (Girnth 2002: 3). Hierzu gehört auch, die nähere Betrachtung des Propagandaministers Joseph Goebbels, der die Rede im Sinne der nationalsozialistischen Regierung verfasste, und in Berlin vor mehreren tausend Zuhörern vortrug.
Die sprachliche Analyse konzentriert sich anschließend auf die Ziele, die mithilfe der Rede erreicht werden sollen und wie diese sprachlich umgesetzt werden. Im Vordergrund steht hierbei die Untersuchung des Perlukutionspotentials10 und der ideologischen Manipulation.
Ob sich die formulierten Thesen durch die Analyse bestätigen lassen, wird im Schlussteil unter Hinzunahme der einzelnen Kapitel, kritisch reflektiert.
2. Forschungsstand
Seit Kriegsende ist über den nationalsozialistischen Sprachgebrauch viel diskutiert und hinsichtlich der Thematik auch vielerlei erschienen, was wiederum zu Kontroversen anregte. Trotz der langjährigen Forschungsgeschichte ist man sich jedoch noch immer uneinig darüber welchen Ertrag die Forschung liefern konnte.11 Vor ca. 30 Jahren kam es dann zu einer Neuorientierung von einer „Sprache des Nationalsozialismus“ hin zu einer „Sprache im Nationalsozialismus“. Den Ausgangspunkt bildeten hierbei Auseinandersetzungen um die Annahme einer „Eigenständigkeit der Sprache des Dritten Reichs“ (vgl. Braun 2007: 2). Diese wurden beispielweise auch durch Klemperer gefördert, der mithilfe des Titels LTI nachfolgende Forschungen dahingehend beeinflusste, von einer eigenen nationalsozialistischen Sprache auszugehen, die etwas Neuartiges konstruiert. Deshalb wurde angenommen, dass damit das „Kontinuum der Sprache“ durchbrochen oder aufgebrochen wurde. Je genauer die Untersuchungen aber ausfielen desto mehr konnte gezeigt werden, dass diese „vermeintliche Originalität“ sich eher „als Tradierung und Amalgamierung bestimmter Strömungen, die das ausgehende 19. Und 20. Jahrhundert hervorgebracht hatten“ handelte (ebd.). Deshalb lehnen einige Sprachwissenschaftler die Bezeichnung: „Sprache des Nationalsozialismus“12 vehement ab, während sich andere der Diskussion gänzlich entziehen (vgl. Nill 1991: 119f.).
Aus diesem Grund existieren bis heute konkurrierende Begrifflichkeiten nebeneinander fort (vgl. Maas 1989: 162). Peter von Polenz schlägt in seiner aktualisierten Ausgabe der Sprachgeschichte folgende Einteilung vor: es sei zu unterscheiden zwischen der „Sprache des Nationalsozialismus“, womit der eigenständige Sprachgebrauch der NSDAP seit 1920 bezeichnet wird und „Sprache im Nationalsozialismus“, womit die Sprache der NSDAP zuzüglich der verschiedenen Traditionen von politischer Sprache benannt wird. Von Polenz ordnet die letztere Definition den Jahren zwischen 1933 und 1945 zu. Als ein weiteres Unterscheidungsmerkmal definiert er die „Sprache zum Nationalsozialismus hin“ wodurch sich erklären lassen soll, warum und durch welche Art von Sprache insgesamt die Nationalsozialisten ihre Erfolge und Unterstützung im Volk erreichen konnten (vgl. Von Polenz 1999: 547). Ein Kritikpunkt nach Braun stellt hierbei die strikte zeitliche Einteilung dar; weshalb nicht berücksichtigt wird, dass die Grenzen der Einteilung „…fließend sind und verschiedene Einflüsse und Wechselwirkungen sich nicht oder kaum trennen lassen“ (Braun 2007: 3). Deshalb kann „inhaltlichen Unschärfen“ und „methodischen Defiziten“ nur auf der Basis einer pragmatisch und textlinguistisch orientierten Stilistik angemessen begegnet werden (vgl. Braun 2007: 3).
3. Kontext und Kriterien für die Auswahl
In der vorliegenden Arbeit wurde bewusst eine Rede kurz nach den „Kampfjahren der NS-Bewegung“ (Bauer 1988: 52) zurückgegriffen, da in dieser Zeit die Durchsetzung der Partei und ihrer Ideologie noch in einem großen Maße durchgeführt werden musste. So betont auch Goebbels selbst immer wieder, dass ihm die Mehrheit der Bevölkerung13 nicht ausreicht, er will alle für seine Ideologie gewinnen mithilfe seiner Propaganda14, die „ unermüdliche[r] Arbeit bedarf“ um die „ Gleichschaltung zwischen der revolutionären Regierung und dem Volke (Goebbels 1933: 139) herbei zu führen:
„Wenn wir in der 14jährigen Arbeit, die hinter uns liegt, und gerade auch in den letzten Wochen beispiellose Erfolge errungen haben, so ist das zum großen Teil der Tatsache zuzuschreiben, daß wir als junge revolutionäre Bewegung alle Arten der modernen Massenbeeinflussung virtuos beherrschten, daß wir nicht Propaganda vom grünen Teich aus betrieben, sondern als wirkliche Volksführer aus dem Volke hervorgegangen sind und in keiner Zeit jemals den Kontakt mit dem Volke verloren haben.“ (Goebbels 1933: 137, Rede vor der Presse, Berlin, 16. März 1933)
Nach der Machtübernahme und auch darüber hinaus, soll gezeigt werden, dass verschiedene Personen als exemplarische Modelle gelten können, deren Sprachgebrauch auf die Herausbildung eines nationalsozialistischen Stils einen prägenden Einfluss ausübte und eine breitgefächerte mediale Verbreitung erfuhr (vgl. Braun 2007: 7). Einzelne Personen waren hierbei maßgeblich an der Herausbildung eines nationalsozialistischen Sprachgebrauchs (welchen eine Vorbildfunktion beigemäßen und als omnipräsent empfunden wurde) beteiligt (vgl. Klemperer 199616: 35). Einer dieser Vorbildideologen war Joseph Goebbels und seine Position als Reichspropagandaminister. Das Datum der Rede befindet sich an der Grenze der Kampfjahre zu den Jahren der Konstituierung der nationalsozialistischen Regierung.15 Weshalb sich innerhalb der Rede ausreichend Untersuchungsmaterial hinsichtlich der ideologischen Beeinflussung finden lassen müsste. Für die Kenntlichmachung einer Appelfunktion des Textes ist der Umstand der Rede von zentraler Bedeutung:
Nach der Machtübernahme der NSDAP am 30. Januar 1933 und dem Reichstagsbrand flohen eine Reihe der politischen Gegner ins Ausland und versuchten von dort aus anhand ihrer Schriften gegen das NS-Regime zu rebellieren. Einstein brachte zu dieser Zeit das ,Braunbuch ̓ heraus, dass als Unterstützung für die allgemeine „Lügenhetze“ diente. Deutschland antworte auf die „Greuelhetze“ mit einem Boykott der jüdischen Geschäfte. (vgl. Schmitz-Berning 2007: 284). Der Boykott fand am selben Tag statt an dem die Rede von Joseph Goebbels öffentlich in Berlin gehalten wurde. Die Aktion wurde bereits im März durch die NS-Führung geplant und wurde im NS Blatt „der Stürmer“ angekündigt. Hiernach kritisierte die internationale Presse den Boykott auch hinsichtlich der schwierigen wirtschaftlichen Situation in der sich Deutschland befand.16 Am 01. April brach die NS-Führung den Boykott ab und ließ ihn auch aufgrund der Passivität der Bevölkerung nicht weiter fortsetzen, sondern erklärte ihn am 04. April für beendet.17 Zu diesem Boykott versucht Goebbels in der hier zu untersuchenden Rede das deutsche Volk aufzurufen. Es handelt sich demnach um eine Face-to-face-Kommunikation mit appellativer Funktion (im Original als Rede gehalten)(Brinker 20056: 147). Zusätzlich determiniert die Zuordnung des Textes zur Textsorte der Rede, die stilistischen Entfaltungsmöglichkeiten und erscheint deshalb als ergiebig für die Analyse.
Aufgrund der Parteiposition des „Reichspropagandaministers“ ist Joseph Goebbels als die entscheidende Person dieses Sprachapparates zu klassifizieren. Horst Dieter Schlosser bezeichnet ihn sogar als den „rhetorischen Katalysator der Parteidoktrin“ (Schlosser 2013: 47), dem die Rolle eines Vermittlers zwischen der Parteidoktrin und der breiten Masse zukommt. Das NS-Regime schuf für die staatliche Sprachzensur und Sprachmanipulation selbst den Begriff der „Sprachregelung“. Dieser folgend wurden nach internen Anweisungen von Joseph Goebbels der Presse durch Zensurmaßnahmen nicht nur Themen vorgegeben sondern auch der Sprachgebrauch.18
3.1. Die Person Joseph Goebbels
Nach Ernest Bramsted muss man „um den Propagandisten Goebbels zu kennen, […] auch den Menschen Goebbels verstehen“ (Bramsted 1975: 47). Um dieser Forderung nachzukommen, wird in dieser Arbeit ein Bild von Joseph Goebbels nachgezeichnet, welches sich für die Untersuchung der Rede als brauchbar erweist. Von einer Vollständigkeit muss hier jedoch abgesehen werden. Zugleich ist man sich in der Forschung auch einig darüber, dass der Sprachgebrauch einzelner Personen wie Goebbels „maßgeblich zur Genese eines nationalsozialistischen Stils beigetragen“ (Braun 2007: 8) hat, da ihr Sprachgebrauch nicht nur als omnipräsent geschildert wird, sondern auch eine Vorbildfunktion beigemessen wurde. Victor Klemperer hebt ebenfalls die Bedeutung der Person Joseph Goebbels für den nationalsozialistischen Sprachstil hervor und betont, dass es zwischen den Aufsätzen und Reden dessolchen kaum Unterschiede gab:
„So waren es nur ganz wenige einzelne, die der Gesamtheit das alleingültige Sprachmodell lieferten. Ja im letzten war es vielleicht der einzige Goebbels, der die erlaubte Sprache bestimmte, denn er hatte vor Hitler nicht nur die Klarheit voraus, sondern auch die Regelmäßigkeit der Äußerung. […] Zwischen den Reden und den Aufsätzen des Propagandaministers gab es keinerlei stilistischen Unterschied, weswegen sich denn auch seine Aufsätze so bequem deklamieren ließen.“ (Klemperer 199616: 35).
Aus diesem Grund bietet sich auch die Analyse einer Rede von Joseph Goebbels an, da sie sich dessen mündliche und schriftliche Formulierungen scheinbar nicht unterscheiden.19 Um eine Erklärung für sein Handeln zu finden sind drei Merkmale seiner Jugend von großer Bedeutung. Als Kind bekam er Kinderlähmung weshalb sein linkes Bein gelähmt war und zudem zehn Zentimeter verkürzt. Der kleine dunkelhäutige und hinkende Goebbels stellte demnach alles andere dar als den Typ des nordischen Herrenmenschen, welcher seine Verherrlichung in den nationalsozialistischen Schriften feierte. Rivalen und Feinde innerhalb der NSDAP machten sich gerne über den „nachgedunkelten Schrumpfgermanen“ (Bramsted 1975: 47) lustig. Von Max Ammann erhielt Goebbels den bezeichnenden Spitznamen „Mephistopheles“, was aber sein vielseitiges rednerisches Talent wenig beeinflusste. Als ein weiteres Merkmal ist seine Abstammung aus kleinbürgerlichen Kreisen einer kleinen rheinländischen Industriestadt zu nennen, welche ihn dazu veranlasste sich in höheren Kreisen in die er sich durch sein Studium begab dennoch immer als Außenseiter zu fühlen:
„Ich befand mich nun zwar als Sohn der Alma Mater in einer gehobenen Gesellschaftsschicht, aber ich war doch in der Paria, ein Verfremdeter, ein nur Geduldeter, nicht etwa, weil ich weniger leistete oder weniger klug war als die anderen, sondern allein, weil mir das Geld fehlte, das den anderen aus den Taschen ihrer Väter so überreichlich zufloß.“ (zitiert nach Bramsted 1975: 49).
Obwohl Goebbels inspiriert durch die Teilnahme an einem Jesuiten-Seminar in den Niederlanden Priester werden wollte, nahm er dennoch ein Studium der Literatur und Philosophie auf. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass deutsche Studenten an mehreren Universitäten zur selben Zeit studierten, Goebbels jedoch erschien fast rastlos, da er an acht verschiedenen deutschen Universitäten wie München, Frankfurt, Berlin etc. studierte und dann letztendlich in Heidelberg im Jahr 1921 bei dem jüdischen Professor Max Freiherr von Waldberg promovierte. Dass sich im Jahr 1933 auch die deutsche Germanistik dem Nationalsozialismus verschrieben hat, ist allgemein bekannt und wird hier der Vollständigkeit halber erwähnt (vgl. Vondung 1997: 37). Nach seiner Promotion bemühte sich das spätere Mitglied der NS-Führung vergeblich um eine Anstellung als Journalist und Dramaturg. Auch die Veröffentlichung eigener Werke konnte ihm nicht so recht gelingen.
Infolge der nationalsozialistischen Machtübernahme im Januar 1933 wurde Goebbels durch die Anordnung Adolf Hitlers zum Leiter des „Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda“, weshalb ihm von diesem Zeitpunkt an Literatur, Presse (über den Reichspresseleiter), Bildende Kunst, Film, Theater, Rundfunk unterstanden (vgl. Bramsted 1971: 104f),20 dieser Verantwortung war sich Goebbels durchaus bewusst:
„ In dem neueingerichteten Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda sehe ich die Verbindung zwischen Regierung und Volk[…][deshalb] ist [es] die erste Aufgabe des neuen Ministeriums[…]eine Gleichschaltung zwischen der Regierung und dem ganzen Volk herzustellen.“ (Goebbels 1933: 135, Rede vor der Presse, Berlin 16.März 1933).21
Anhand dieses Zitates kann nachvollzogen werden, warum Joseph Goebbels sich fortwährend der Propagandamaschinerie des Nationalsozialismus verschrieb. Unermüdlich erwähnt der Germanist die Erfolge die mit diesem Konzept in Verbindung stehen und schreibt diese der Tatsache zu, dass die Nationalsozialisten „als junge revolutionäre Bewegung alle Arten der modernen Massenbeeinflussung virtuos beherrschten“ (Goebbels 1933: 137). Auch Victor Klemperrer verweist auf die herausragende Stellung des Propagandaministers:
„So waren es nur ganz wenige einzelne, die der Gesamtheit das alleingültige Sprachmodell lieferten. Ja im letzten war es vielleicht der einzige Goebbels, der die erlaubte Sprache bestimmte, denn er hatte vor Hitler nicht nur die Klarheit voraus, sondern auch die Regelmäßigkeit der Äußerung. […] Zwischen den Reden und den Aufsätzen des Propagandaministers gab es keinerlei stilistischen Unterschied, weswegen sich denn auch seine Aufsätze so bequem deklamieren ließen.“ (Klemperer 199616: 35).
Joseph Goebbels verfolgte demnach ein Konzept, dass in einem besonderen Maße auch in schriftlicher Form seinen Reden die Funktion einer Aufführung eines „Staatsaktes“ in Anlehnung an das Theater, den Karneval oder Sportveranstaltungen geben sollten. Ebenso wie Hitler und alle an der Parteiführung beteiligten Personen war Goebbels davon überzeugt, dass der Aufstieg und auch die Herrschaft der NSDAP zu einem maßgeblichen Teil durch ihre Propaganda entschieden werde (vgl. Michels 1992: 18).22
3.2. Aufführungscharakter nationalsozialistischer Reden und deren Wirkung
Nach Johannes Pankau vollzieht sich in der aufgeführten Rede nicht nur bei Goebbels sondern auch in den Reden Hitlers „ein Ritual, dessen Funktion in einer schwer zu fassenden Gemeinschaftsbildung besteht, in der Auflösung fester Affektgrenzen, zugleich in der Herstellung einer Empfänglichkeit für die Angebote der ›Führer‹“ herstellt“ (Pankau 1997: IX). Deshalb gehe es in diesen Redesituationen um die kurzweilige Fusion von Redner und Masse, „um Formen kollektiver Bewußtlosigkeit, um den Prozeß affektiv wirkender Massenbeeinflussung“ (ebd.). Dies wird durch die häufig gestellten rhetorischen Fragen noch unterstützt, wenn die Massen die Antworten gemeinsam schreien, weil es alle anderen auch tun (vgl. Klemperer 199616: 55).23 Hein Schlecht, welcher die einleitenden Zeitbilder zu den Reden Goebbels verfasste, veranschaulichte den elementaren Zweck des Aufführungscharakters indem er diesen verschriftlicht nachempfand:
„ Man wird gefesselt! Ein packender Satz, treffend auf Denken und Fühlen des einzelnen
zugeschnitten, lößt tosenden Beifall aus.
Die Menge versteht ihn!
Der Kontakt mit zwanzigtausend Menschen ist geschaffen!
Auf der Rednertribüne steht ein Meister des Wortes, der dem
Volk die schwierigsten und verworrensten Probleme der Zeit in
genialer Vereinfachung klarlegt.
[…] es ist jetzt alles sonneklar, der Redner hat tausendmal recht!
(Goebbels 1933: 36 einleitendes Zeitbild von Hein Schlecht, die Absätze sind vom Original übernommen um den Wirkungscharakter (der damit erzielt werden sollte) detailgetreu nachbilden zu können.)
[...]
1 Johannes Volmert bezeichnet die politische Sprache der Nationalsozialisten als „sprachliche Gewalt, die mit den Instrumenten faschistischer Rhetorik ausgeübt worden ist“ (Volmert 1989: 137) und veranschaulicht damit neben der physischen auch die psychische Gewalt, die von diktatorischen Herrschaften ausgehen kann.
2 Braun zieht zu dieser Definition Parallelen zu Girnth 2002:5f, Klemperer 199616 und zu Sternberger et al. 1968.
3 Gerhard Bauer hat für den Titel seines Werkes „Sprache und Sprachlosigkeit im »Dritten Reich« diesen Aspekt in den Vordergrund gestellt.
4 Auch Gerhard Bauer weist darauf hin, dass Ansätze eine oppositionell organisierte Volksfront aufzubauen an den „erstickenden Kommunikationsbedingungen für die Oppositionellen im Reich“ scheitern mussten (vgl. Bauer 1988: 102).
5 Eine Untersuchung hinsichtlich des Parteiprogramms der AFD würde sich mit großer Wahrscheinlichkeit in mehreren Fällen mit dem Sprachgebrauch der Nationalsozialisten decken, der Beitrag von Bernhard Pörksen(2000) wäre hier als Folie mit Sicherheit brauchbar. Justizminister Heiko Maas (SPD): Die AfD – das sind Brüder im Geiste von Wladimir Putin, Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan: nationalistisch, autoritär und frauenfeindlich", auf die Auseinandersetzung mit der Partei angesprochen entgegnet Maas: Allerdings sei es nicht einfach, "mit Menschen zu diskutieren, die Fakten ignorieren, überall 'Elitenbetrug' oder 'Lügenpresse' wittern und ihre Realität aus den Verschwörungszirkeln des Internets zusammenklauben" (vgl. www.welt.de).
6 Vgl. den Artikel der Zeit vom September 2014: „Dschihad-Propaganda und islamistische Agitatoren sind in
manchen Wiener Gebetsräumen allgegenwärtig.“ (www.zeit.de).
7 „GfdS wählt »Flüchtling« zum Wort des Jahres 2015“ (www.gfds.de). Und stellt das Wort in einen negativen Zusammenhang. Alternativ wird das Wort „Geflüchtete“ vorgeschlagen. Nicht nur das Wort „Flüchtling“ sollte hier an Beachtung beigemessen werden, sondern auch die vielerlei in der Öffentlichkeit kursierenden Komposita, welche mit Flüchtling gebildet werden und oftmals auch die politische Gesinnung zum Thema offen legen. Beispiele hierzu sind: Flüchtlingsstrom, Flüchtlingskrise, Flüchtlingsproblematik, Kriegsflüchtling etc. (vgl. hierzu auch den Beitrag der Zeit vom 11.Dezember 2014: „Warum „Asylant“ ein Killwort ist. Sprache wird als Mittel der Ausgrenzung missbraucht beim Thema Migration zeigt sich ihre demagogische Macht. Asylant sagt zwar kaum noch einer, doch andere Unwörter haben Konjunktur.“ (www.sueddeutsche.de)
8 Die nach eigenen Aussagen 14 Jahre Zeit hatten um sich auf die Tage nach der Machtübernahme vorzubereiten in denen dann „ Joseph Goebbels […] seinen gigantischen Kampf um die Seele der Nation“ (vgl. Goebbels 1933: 21) führen konnte.
9 Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Zitate, die aus der Rede vom 01. April 1933 stammen stets kursiv gesetzt und nach ihrer Segmenteinteilung im Anhang mit Ziffern wiedergegeben. Dieses Schema wurde verwendet um die Überprüfbarkeit mit dem Originaltext zu gewährleisten. Zudem sind auch alle Zitate, die aus dem Primärtext „Dr. Joseph Goebbels 1933: Revolution der Deutschen“ stammen durch die kursive Schreibweise hervor gehoben, um eine Abgrenzung zur Forschungsliteratur aufzuzeigen.
10 Nach Braun bemisst sich das Perlokutionspotential eines Textes danach, ob Stilfunktion und Textfunktion kongruent sind (vgl. Braun 2007: 25).
11 Nach Ehlich ist es „, diffus was es mit der Sprache im Faschismus auf sich hatte“ (Ehlich 1998: 278). Damit meint dieser vornehmlich die Methoden der linguistischen Untersuchungsmethoden, die zu Beginn der Forschungsrichtung nur in einem nicht ausreichenden Umfang zur Verfügung standen.
12 Dieckmann 1975: 108; 114; 133ff. Sauer 1978b; neuerdings Beck 2001: 29
13 „ Ich glaube nicht, daß wir unser Ziel mit einer 52prozentigen parlamentarischen Mehrheit erreicht haben würden[…] [die Regierung] muß vielmehr alle propagandistischen Vorbereitungen treffen, um das ganze Volk auf ihre Seite zu ziehen.“ (vgl. Goebbels 1933: 136) Hier wird die Totalität (vgl. Bauer 1988: 186) deutlich, die auf allen Gebieten von den Nationalsozialisten beansprucht wird. Vgl. hierzu auch: Rede vor der Presse in Berlin 16. März 1933, [7], [10].
14 Goebbels definiert das „ Wesen der Propaganda [als] Einfachheit, Wucht und Konzentration“ (vgl. Goebbels 1933: 148). Demnach muss „ Der Propagandist […] der beste Seelenkenner sein. […] der es schafft auf „ der Harfe seiner [des Menschen] Seele die Saite anzuschlagen, die zum Klingen gebracht werden muß.“ (Goebbels 1933: 137f.) Das Wort Propaganda wird in seiner semantischen Extension eingeschränkt und erhält dadurch eine Bedeutungsverengung. (vgl. zum häufigen Gebrauch von „Töne im Saitenspiel“ (Klemperer 199616 : 77).
15 Vgl. hierzu auch die zeitliche Einteilung von Polenz und die Kritik Bauers an dessen Einteilung in dieser Arbeit (Kapitel 2, Forschungsstand).
16 Mit dem Boykott jüdischer Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notarkanzleien nahm die Regierung Bezug zu dem seit 1920 existierenden 25-Punkte Programm der NSDAP, welches die Verdrängung der Juden aus dem Wirtschaftsleben vorsieht. Besonders hervorzuheben sind hier die Punkte 7. und 16. Zur Behandlung der „Lügenpresse“ äußert sich Punkt 23 (vgl. Tjiok 1997: 241f.).
17 Dass ursprüngliche Ziel eine „ Boykottpause eintreten zu lassen“ [33] wurde demnach nicht realisiert.
18 Der Sprachgebrauch des Vokabulars war gezielt auf Nicht-Nationalsozialisten ausgerichtet, Nicht-Mitglieder sollten ebenfalls überzeugt werden.
19 Dies stellt jedoch nur eine Annahme dar, die sich auf die Aussage Klemperers stützt. Um Gewissheit zu erlangen, wäre es gewinnbringend zu untersuchen inwieweit sich verschriftlichte Reden (oder im Original aufgezeichnete) von programmatischen Schriften und Aufsätzen, die allesamt von Joseph Goebbels stammen, unterscheiden. Dieser Untersuchung kann aber hinsichtlich der Thematik in dieser Arbeit nicht nachgegangen werden.
20 Bramsted bezeichnet dies als „Organisierte Indoktrinierung: […]Dieses System der Indoktrinierung und der Geisteskontrolle“ befasste sich mit allen Themen der Parteiführung und des öffentlichen und kulturellen Lebens (vgl. Bramsted 1971: 104ff.)
21 Vgl. hierzu auch die weiteren Aussagen Goebbels, die das Ministerium für Volksaufklärung und dessen fünf Abteilungen sowie deren Funktionen genauer erläutern. Im Vordergrund steht bei allen Abteilungen abermals „ alle Möglichkeiten und Methoden der Massenbeeinflussung“ als Diktatur auszunutzen (vgl. Goebbels 1933: 142).
22 Interessanterweise wurde diese Haltung auch von Gegnern und Kritikern des NS-Regimes geteilt (vgl. Michels 1992: 18).
23 Klemperer beschreibt die „gut einstudierten Zwischenrufe“ und deren Wirkung in seinem Tagebucheintrag vom 10. November und vergleicht die Propaganda mit religiösen Riten und der Christuslegende (vgl. Klemperer 199616: 55).