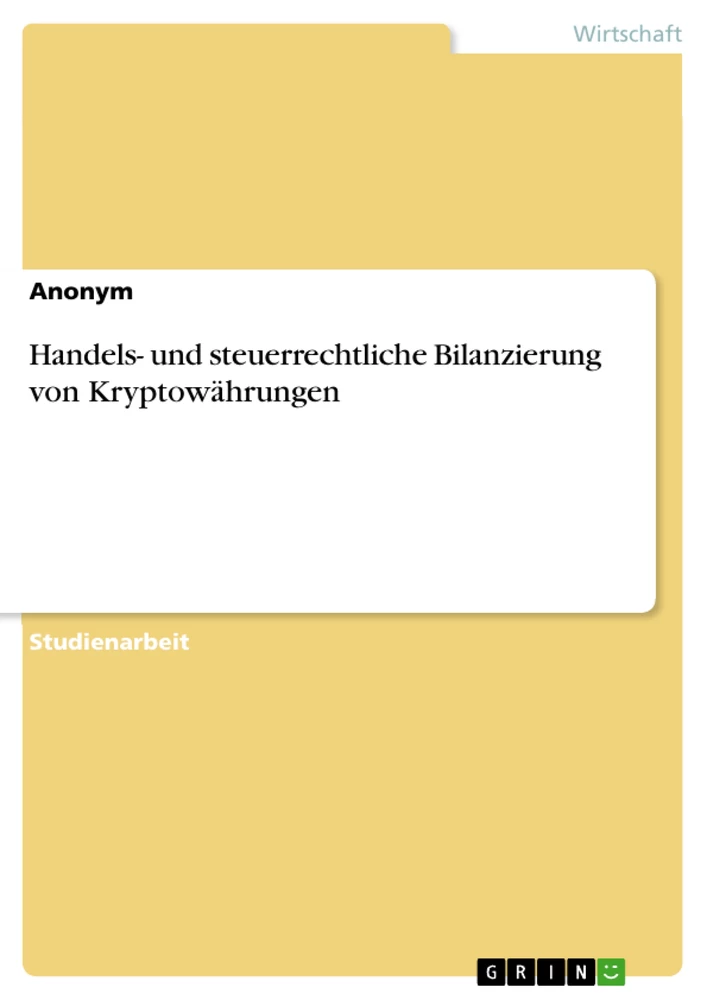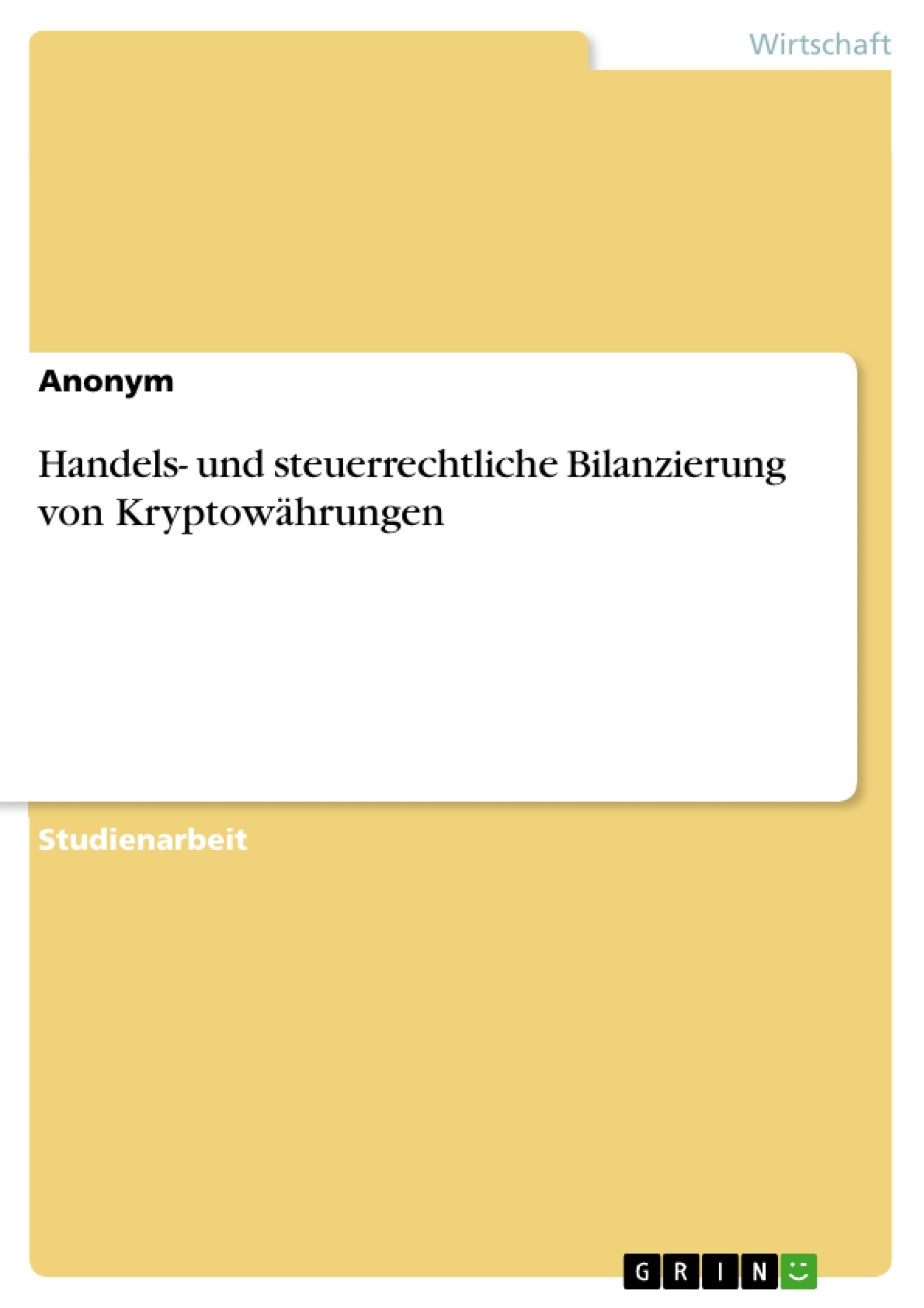Diese Arbeit wurde im Rahmen des Hauptseminars (M.Sc Univ.) am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre geschrieben. Kryptowährungen erfreuen sich seit geraumer Zeit einer wachsenden Medienpräsenz. Seltener verschafft die Berichterstattung dem Leser allerdings ein neutrales Bild über diese Instrumente. Dadurch ist nicht klar, ob sich eine mühsame Einarbeitung in den Themenkomplex lohnt.
Für die Wissenschaft eröffnet sich zweifelsfrei ein facettenreiches Paradies mit Kryptowährungen als Untersuchungsobjekt. Nicht nur bilanz- und steuerrechtliche Fragestellungen können hierbei zuhauf behandelt werden. Auch stellt sich zum Beispiel die Frage nach einer fundierten Bewertungsmethode von Kryptowährungen. Wie bewertet man letztlich das zugrundeliegende verteilte Netzwerk (Stichwort Metcalfesches Gesetz)?
Hinsichtlich der Bilanzierung bestehen im Schrifttum zum aktuellen Zeitpunkt lediglich Beiträge über den sogenannten Bitcoin. Dieser ist jedoch nur eine von sehr vielen Kryptowährungen und die (wenigen) Aufsätze weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse nicht unmittelbar auf andere Kryptowährungen übertragen werden können.
Dieses Vakuum wird einerseits durch den vorliegenden Beitrag geschlossen. Andererseits werden interessante Fragen aufgeworfen, welche auf die technologischen Besonderheiten zurückzuführen sind und schwierig mit geltendem Recht beantwortet werden können. Mithilfe der eigens entwickelten Kategorisierung von Kryptowährungen können zudem künftige Forschungsfragen bearbeitet werden.
Diese Arbeit enthält 5 Kapitel. Kapitel 2 legt die Grundlagen über die technologische Funktionsweise von Kryptowährungen. Die dort entwickelte Kategorisierung soll bei rechtlichen Fragestellungen dienlich sein. Kapitel 3 behandelt juristisch-deduktiv die bilanzrechtliche Einordnung in der Handels- und Steuerbilanz hinsichtlich Ansatz, Ausweis und Bewertung. Kapitel 4 fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusammen, diskutiert sie und zeigt Lösungsvorschläge auf. Kapitel 5 enthält eine Fallstudie, in der die thematisierten Aspekte anhand eines anschaulichen Sachverhalts dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis iv
1. Ziel und Aufbau der Arbeit
2. Konzept von Kryptowährungen
2.1 Logik der Blockchain-Technologie
2.2 Blockchain-Plattformen und Kryptowährungen
3. Bilanzieller Charakter von Kryptowährungen
3.1 Aktivierungsfähigkeit
3.2 Ausweis
3.3 Bewertung
4. Schlussbetrachtung
5. Fallstudie
Anhang
Literaturverzeichnis
Rechtsquellenverzeichnis
Sonstige Quellen