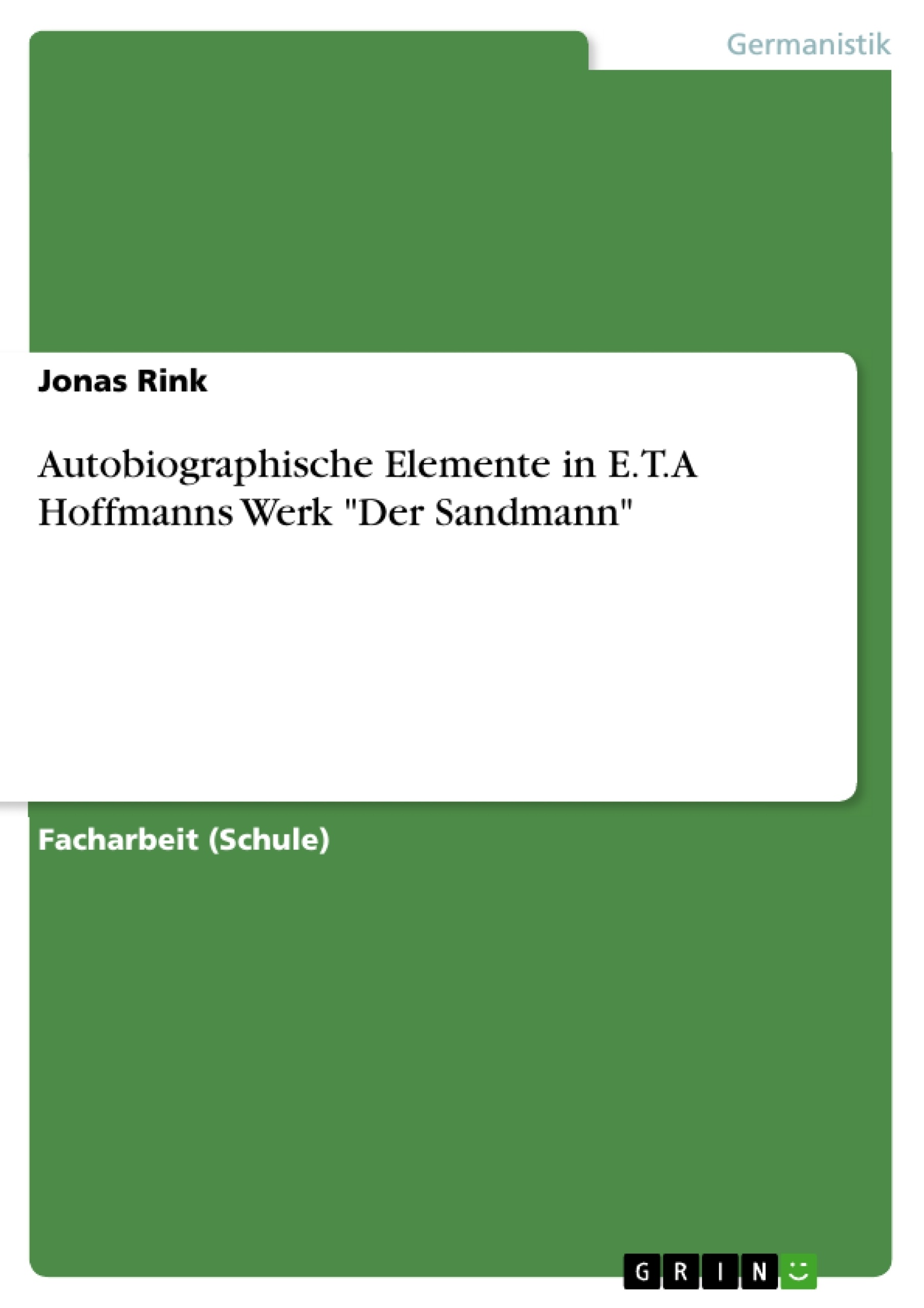Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk von E.T.A. Hoffmann und der Fragestellung, inwiefern sich das Leben des Künstlers in seinen Werken wiederspiegelt. Im Fokus der Arbeit steht das romantische Werk „Der Sandmann“, das 1816 erstmals veröffentlicht wurde.
Das Werk ist das erste von acht so genannten Nachtstücken. Es gehört der schwarzen Romantik oder Schauerliteratur an. Diese Bezeichnung erhält der Sandmann, weil die Begegnungen mit den unheimlichen und düsteren Gestalten Coppelius und Coppola meist nachts stattfinden. Zudem ist der Begriff „Nachtstück“ eine Metapher, die die psychischen Vorgänge im Unterbewusstsein des Protagonisten Nathanael veranschaulicht.
In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, inwiefern die Hauptfigur in dem Werk „Der Sandmann“ biografische Elemente des Autors aufweist.
Autobiographische Elemente in E.T.A Hoffmanns Werk "Der Sandmann"
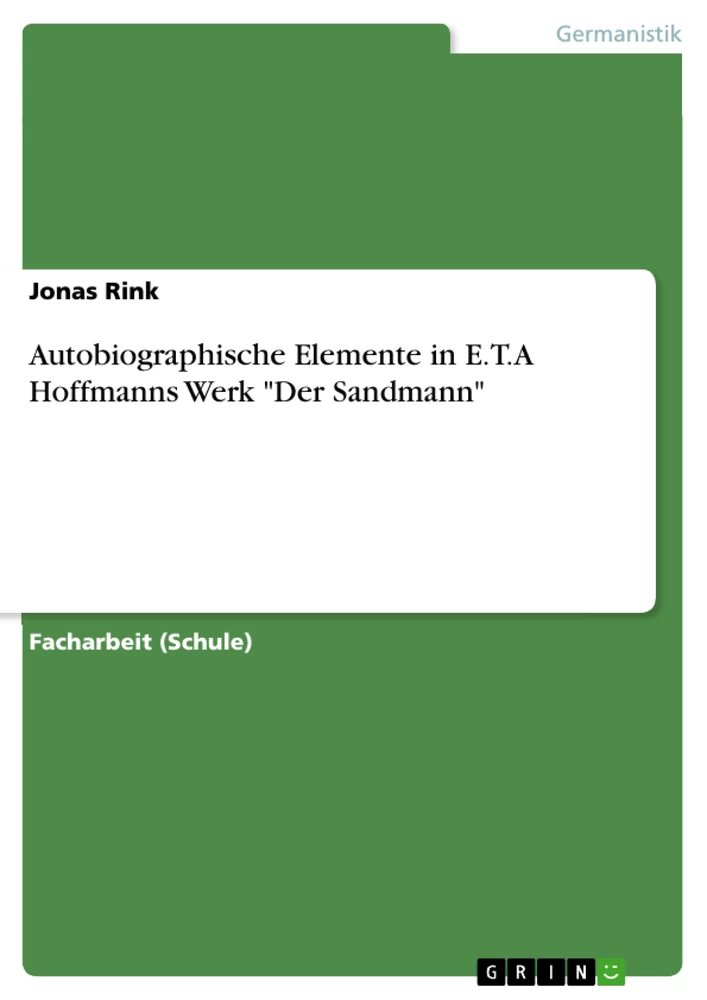
Facharbeit (Schule) , 2017 , 8 Seiten , Note: 1-
Autor:in: Jonas Rink (Autor:in)
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur
Leseprobe & Details Blick ins Buch