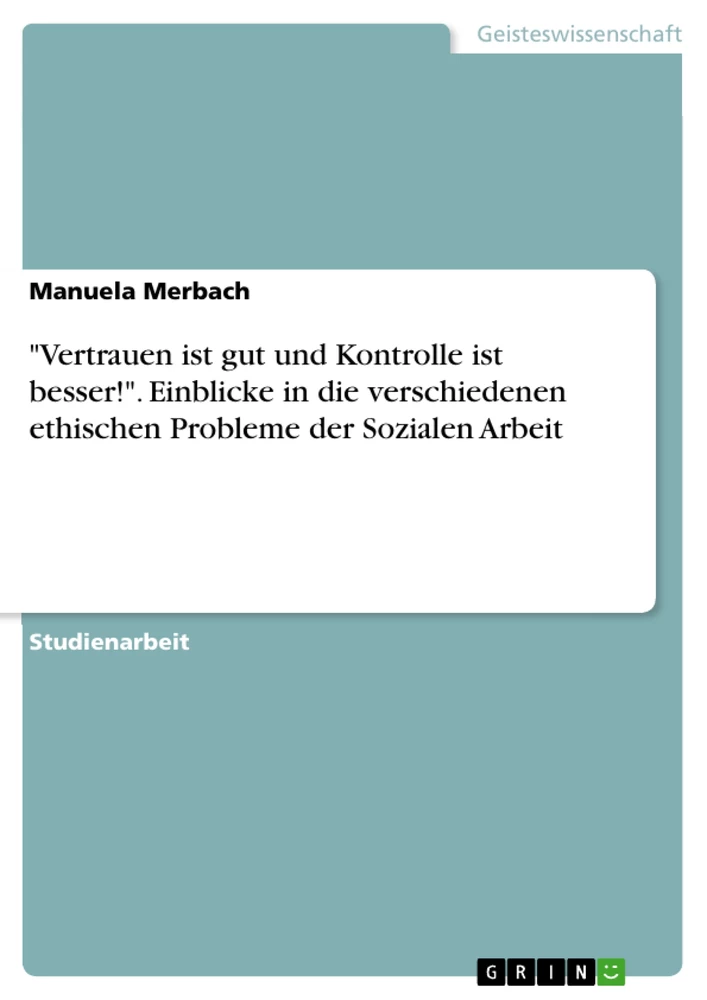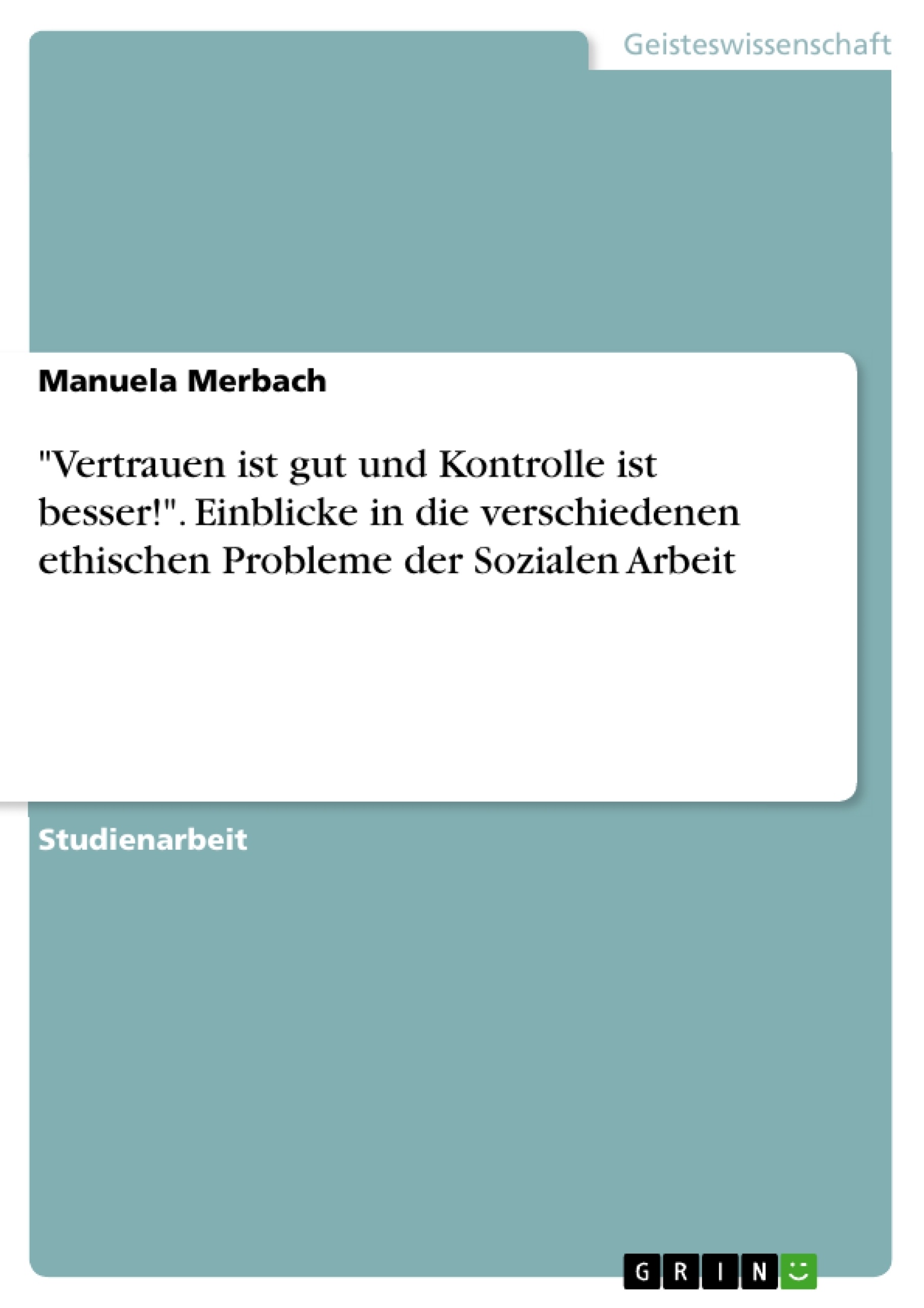Die unterschiedlichsten ethische Fragen beschäftigen uns immer wieder im Laufe unseres Lebens. Unsere Eltern lehren uns, welche Handlungen richtig und welche falsch sind. In der Grundschule beschäftigen wir uns meistens das erste Mal intensiver und theoretisch fundierter mit dem Thema Ethik. Und auch währende des Berufslebens sollten ethische Aspekte bei unseren Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Ein Bereich, wo ethische Fragestellungen besonders häufig an der Tagesordnung stehen, ist die Soziale Arbeit.
Die Berater in der Schwangerschaftskonfliktberatung stehen vor einigen Schwierigkeiten, denn zum einen soll, dem Strafgesetzbuch entsprechend, das eigenständige Lebensrecht des Ungeborenen und der Unrechtscharakter des Abbruchs unterstrichen und die Schwangere zur Fortsetzung der Schwangerschaft ermutig werden, zum anderen dem Schwangerschaftskonfliktgesetz entsprechend, die Frau ergebnisoffen, nicht bevormundend oder belehrend in einer von ihr selbst zu verantwortenden Entscheidung unterstützt werden.
Das letzte Beispiel für ethische Fragestellungen in der Sozialen Arbeit ist die Straffälligenhilfe. Es gibt unzählige Paradoxien in diesem Arbeitsbereich und somit auch vielfältige ethische Dilemmata, wie folgender Textauszug zeigt: „Für die Straffälligenhilfe stellen vor allem folgende widersprüchliche Anforderungen Dauerthemen des beruflichen Alltags dar: Die Anforderung, fachlich begründete Balancen zu finden zwischen Hilfe und Kontrolle, Nähe und Distanz, Zuwarten (zur Förderung der Selbsthilfe) und Intervenieren (wenn Adressaten überfordert sind), Sicherheitsgesichtspunkten und Freiheitserfahrungen.“
Um diese Problematiken besser zu verstehen, soll zu Beginn geklärt werden, was Soziale Arbeit ausmacht. Im vierten Kapitel werden die ethischen Probleme im Berufsalltag der Sozialarbeiter dargestellt und welche Wege es gibt, um mit ihnen umzugehen. Wobei sich hier die Frag stellt: Ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, um mit ethischen Problemen besser bzw. professioneller umgehen zu können und wie diese Optionen dann aussehen?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen der Soziale Arbeit
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Vielfalt der Sozialen Arbeit
3. Ausgewählte Bereiche der Sozialen Arbeit
3.1 Der Allgemeine Soziale Dienst
3.2 Die Schwangerschaftskonfliktberatung
3.3 Die Straffälligenhilfe
4. Ethische Fragestellungen und Problematiken
4.1 Allgemein
4.2 Kindeswohl vs. Elternrecht
4.3 Schutz des ungeborenen Lebens vs. Förderung der Selbstbestimmung
4.4 Hilfe vs. Kontrolle
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis