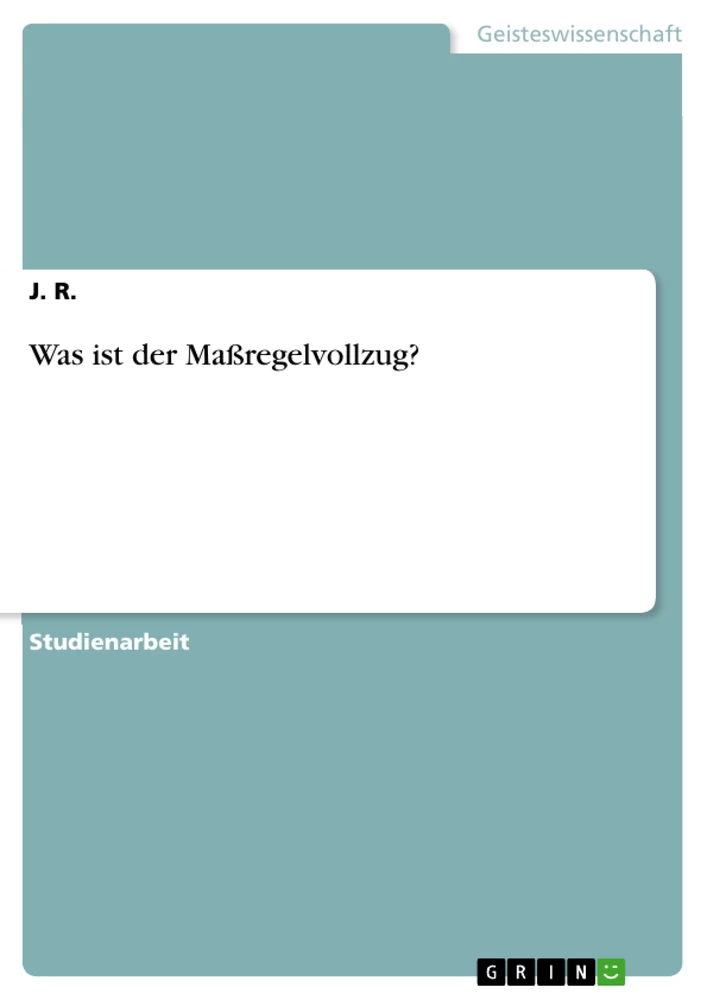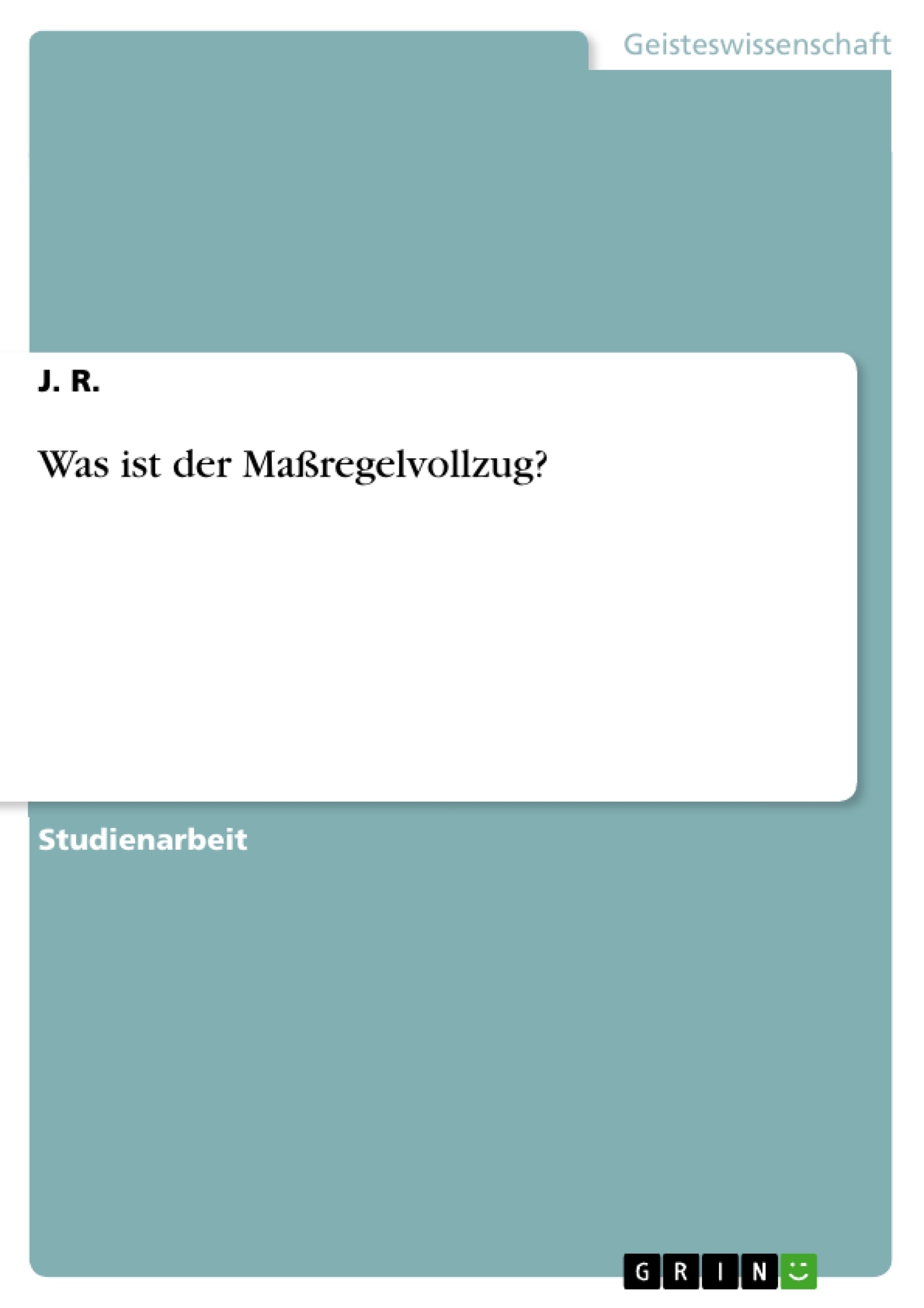In Deutschland wurden im März 2014 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt ca. 8000 Personen in psychiatrischen Krankenhäusern gemäß § 63 StGB gezählt.
In den Medien und in der Gesellschaft steht der Maßregelvollzug oft in der Kritik. Die im Maßregelvollzug untergebrachten Menschen haben oftmals sehr schwere und tragende Delikte begangen. Außenstehende empfinden Furcht und Misstrauen gegenüber den Einrichtungen und Patienten und verstehen nicht, wieso diese Menschen nicht in eine Justizvollzugsanstalt eingesperrt werden. Um diesen Vorurteilen zu begegnen, sollen in der vorliegenden Arbeit die Aufgaben und Ziele des Maßregelvollzugs beschrieben werden.
Welche Funktion hat der Maßregelvollzug gemäß § 63 StGB? Wie sieht die rechtliche Grundlage aus? Wer genau wird in den forensischen Kliniken untergebracht? Erfolgen therapeutische Maßnahmen während der Unterbringung? Wann wird die Maßnahme beendet?
Diese und weitere Fragen sollen im Laufe dieser Hausarbeit geklärt werden. Dazu werden im ersten Kapitel zunächst die wichtigsten Eckdaten des Maßregelvollzugs genannt. Dazu zählen unter anderem eine kurze Beschreibung, die Ziele und relevante Straftaten und Störungsbilder. Im zweiten Kapitel sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt werden. Der dritte Teil beschäftigt sich mit den Aufgaben und im vierten Kapitel geht es um die Beendigung der Maßnahme. Der Fokus wird in der gesamten Hausarbeit auf den Maßregelvollzug nach § 63 StGB gelegt. Abschließend folgt ein kurzer Schlussteil.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Kurze Einführung
1.1.Beschreibung
1.2.Ziele des Maßregelvollzugs
1.3.Straftaten und relevante Störungsbilder
2. Rechtliche Rahmenbedingungen
3. Aufgaben
3.1. Sicherung
3.2. Therapieangebote/Besserung
3.3. Vollzugslockerung
4. Beendigung der Maßnahme
5. Schlussbemerkung
6. Literaturverzeichnis