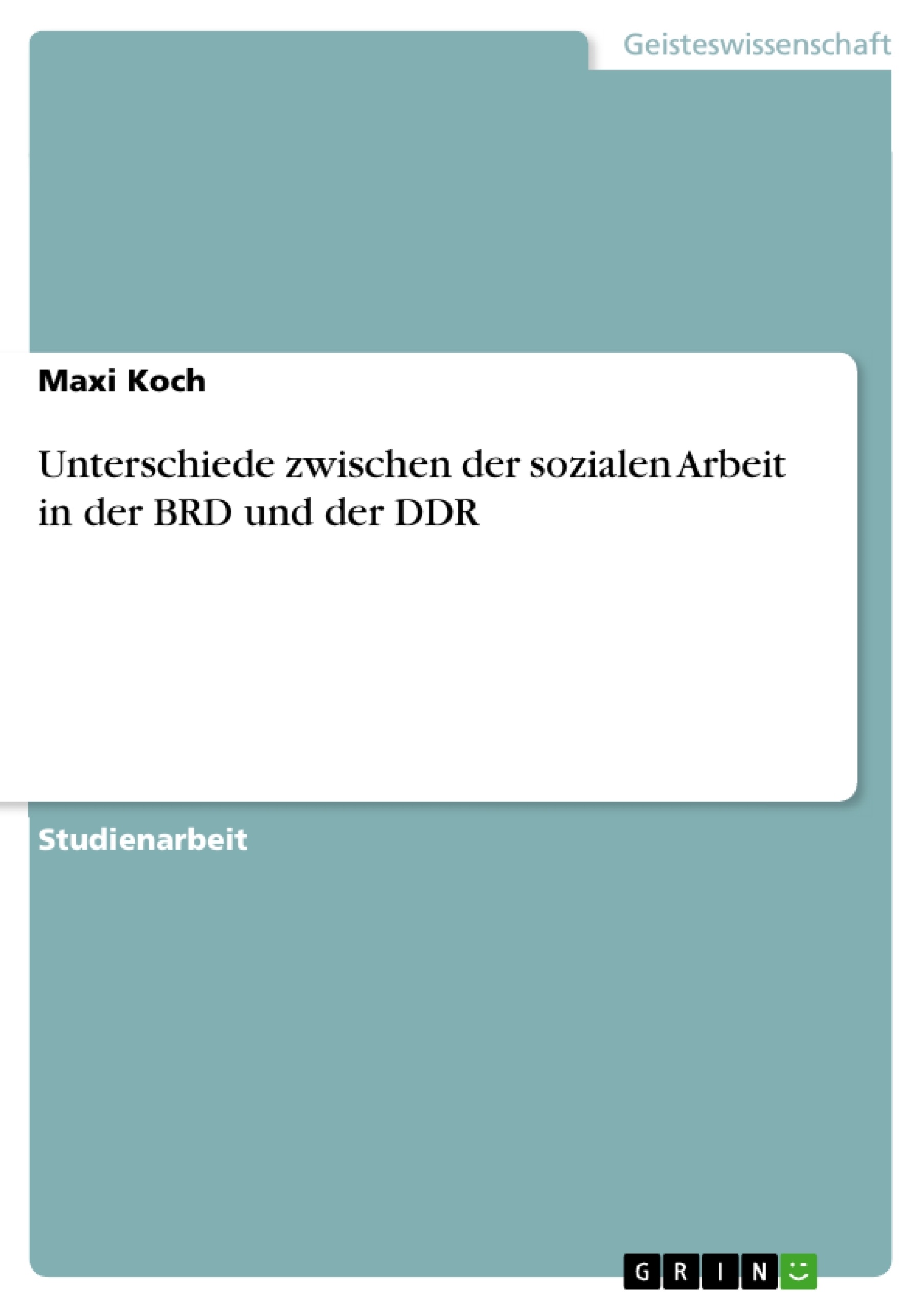Die Hausarbeit behandelt die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit in der BRD und der DDR.
Das Verständnis von Sozialer Arbeit, ihrer Träger und Institutionen kennzeichnet eine historische Entwicklung. Der von Carola Kuhlmann verfasste Text „Soziale Arbeit in BRD und DDR (1945-1969)“ aus ihrem Fachbuch „Geschichte Sozialer Arbeit 1“ wurde 2014 (4. Auflage) veröffentlicht und handelt von der unterschiedlichen Entwicklung der Sozialen Arbeit in Ost- und Westdeutschland. Inwiefern das Geschehen in der Zeit von 1945 bis 1969 darauf Einfluss nahm, wird in der folgenden Hausarbeit zusammenfassend erläutert.
Unterschiede zwischen der sozialen Arbeit in der BRD und der DDR
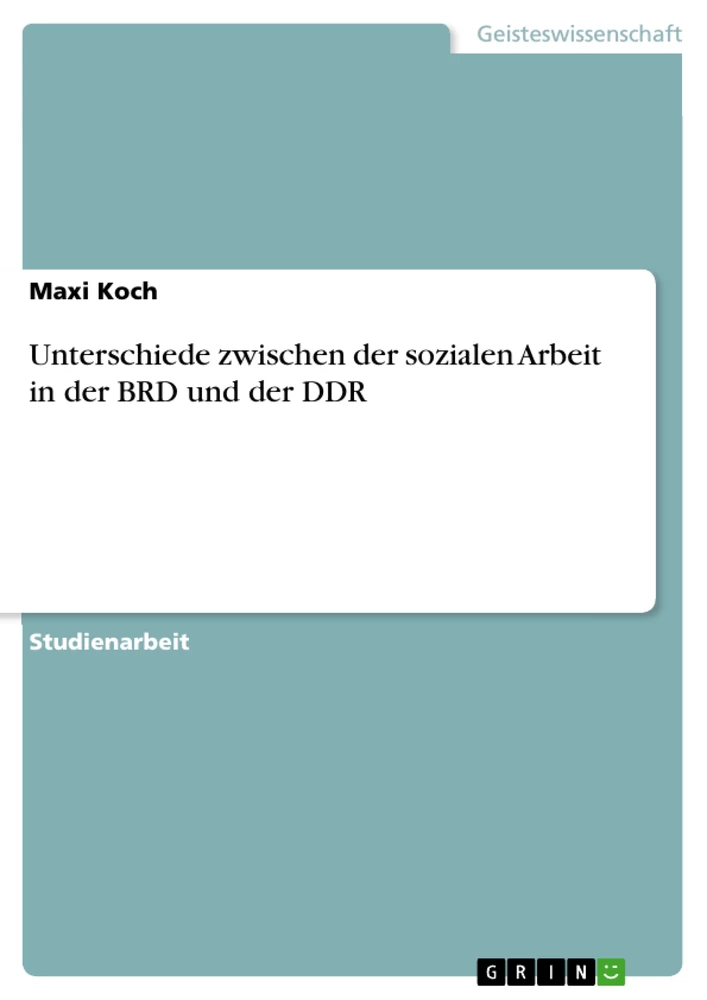
Hausarbeit , 2017 , 8 Seiten , Note: 1,7
Autor:in: Maxi Koch (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch