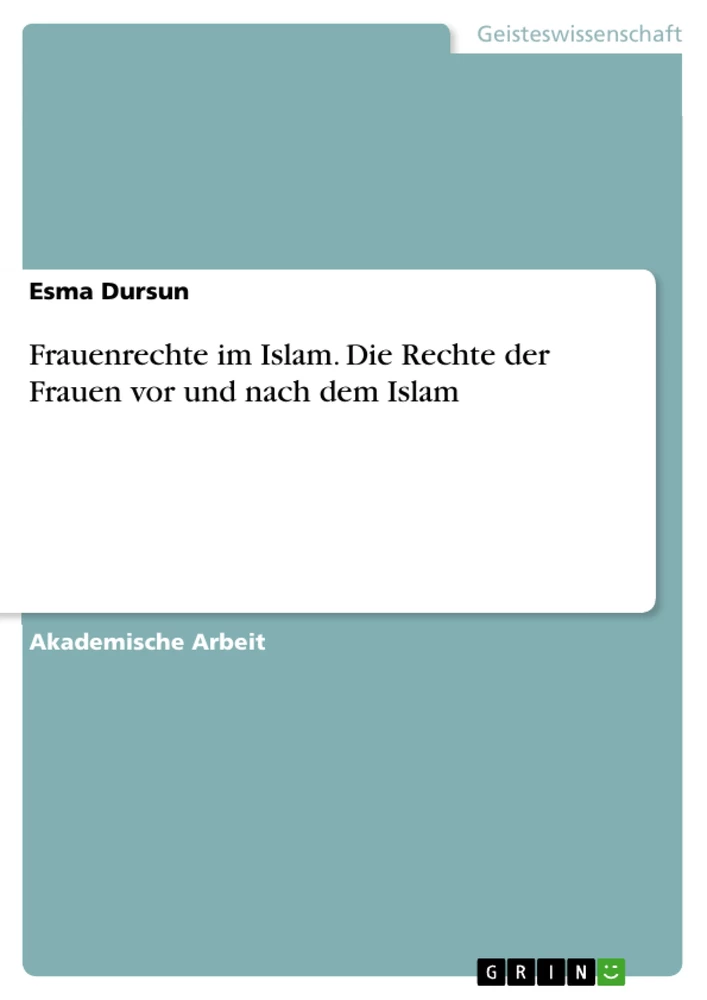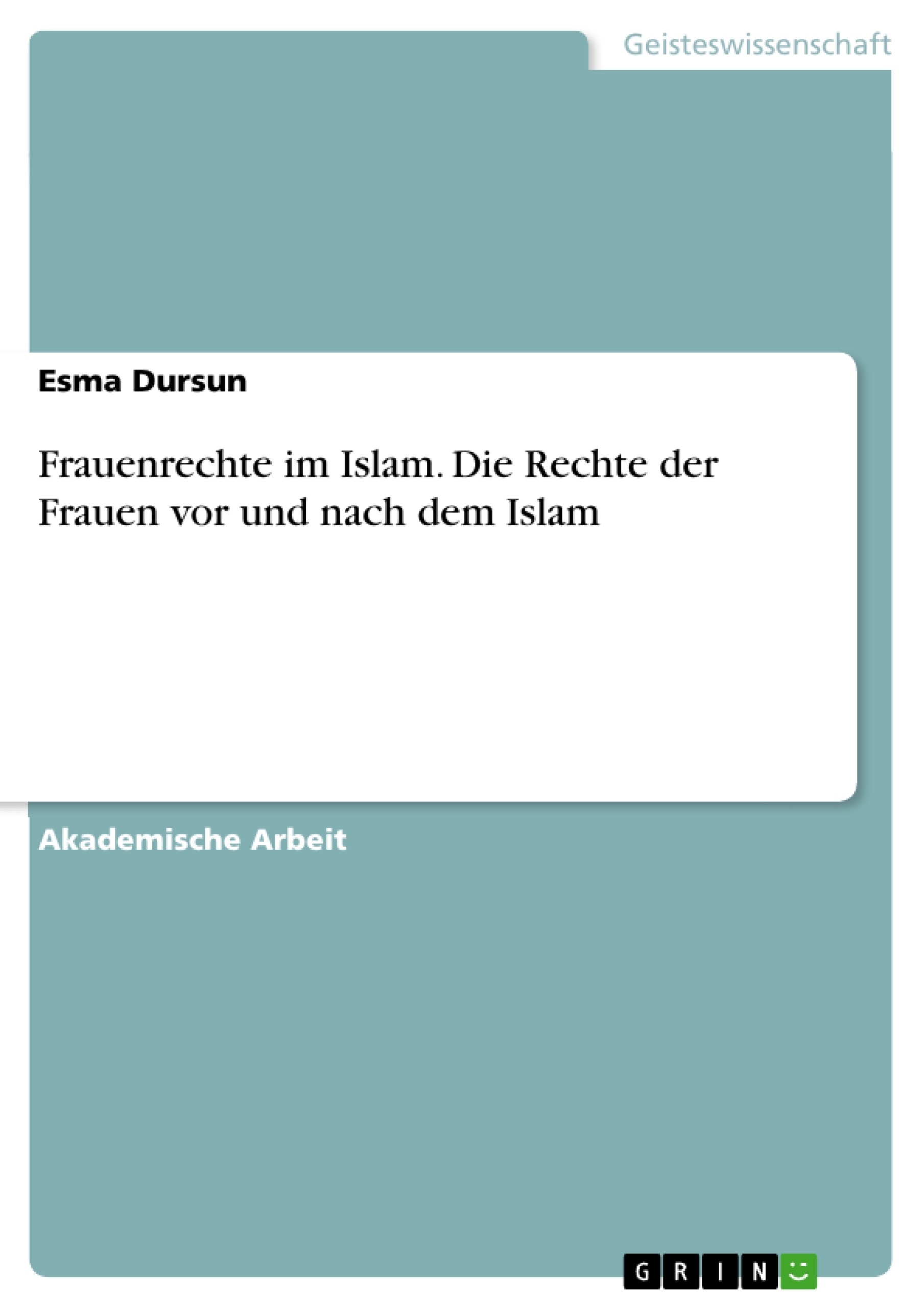Im Folgenden möchte ich mich mit den Fragen beschäftigen: Wie war die Stellung der Frau vor dem Islam? Was ist die Basis für die Unterdrückung von Frauen? Ist es der Islam, der die Frauen unterdrückt? Gibt es die Unterdrückung von Frauen in anderen Kulturen/Religionen?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung,
2 Definitionen
3 Die Stellung der Frau vor dem Islam
4 Die Rechte der Frauen nach dem Islam
4.1 Das Entscheidungsrecht bei der Heirat
4.2 Das Recht auf Brautgabe
4.3 Das Recht auf Scheidung
4.4 Das Recht auf Erbe und Eigentum
4.5 Das Recht auf Bildung
4.6 Das Recht auf Berufsausübung
4.7 Das Recht auf Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
4.8 Das Wahlrecht
4.9 Das Recht auf ein gewaltfreies Leben
5 Das Leben der Frau in der Gesellschaft
6 Fazit
7 Quellenverzeichnis