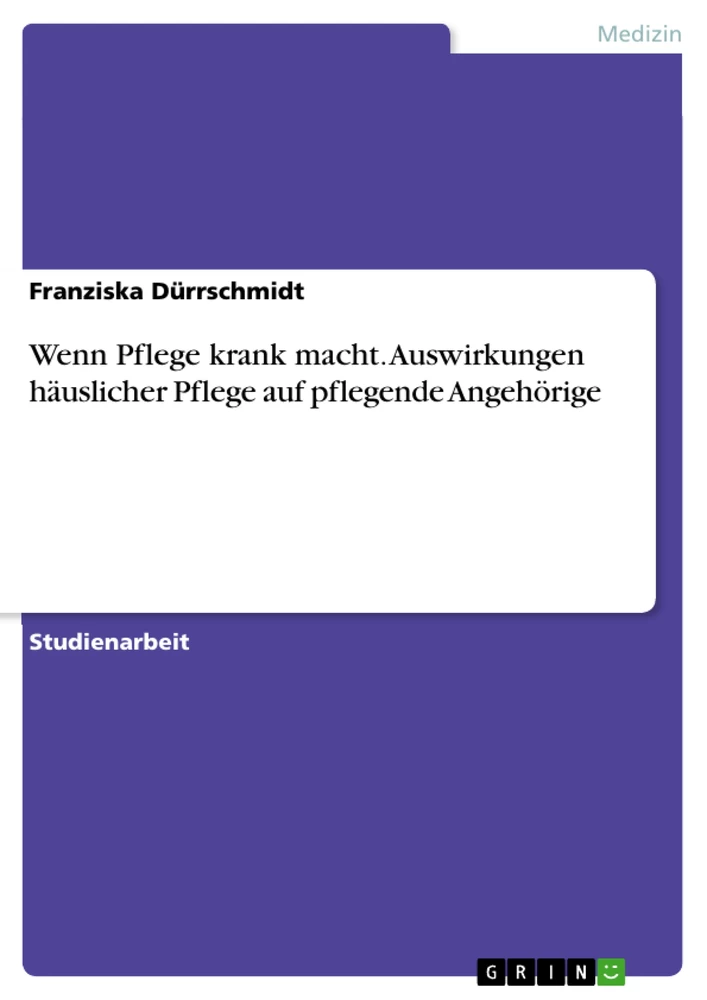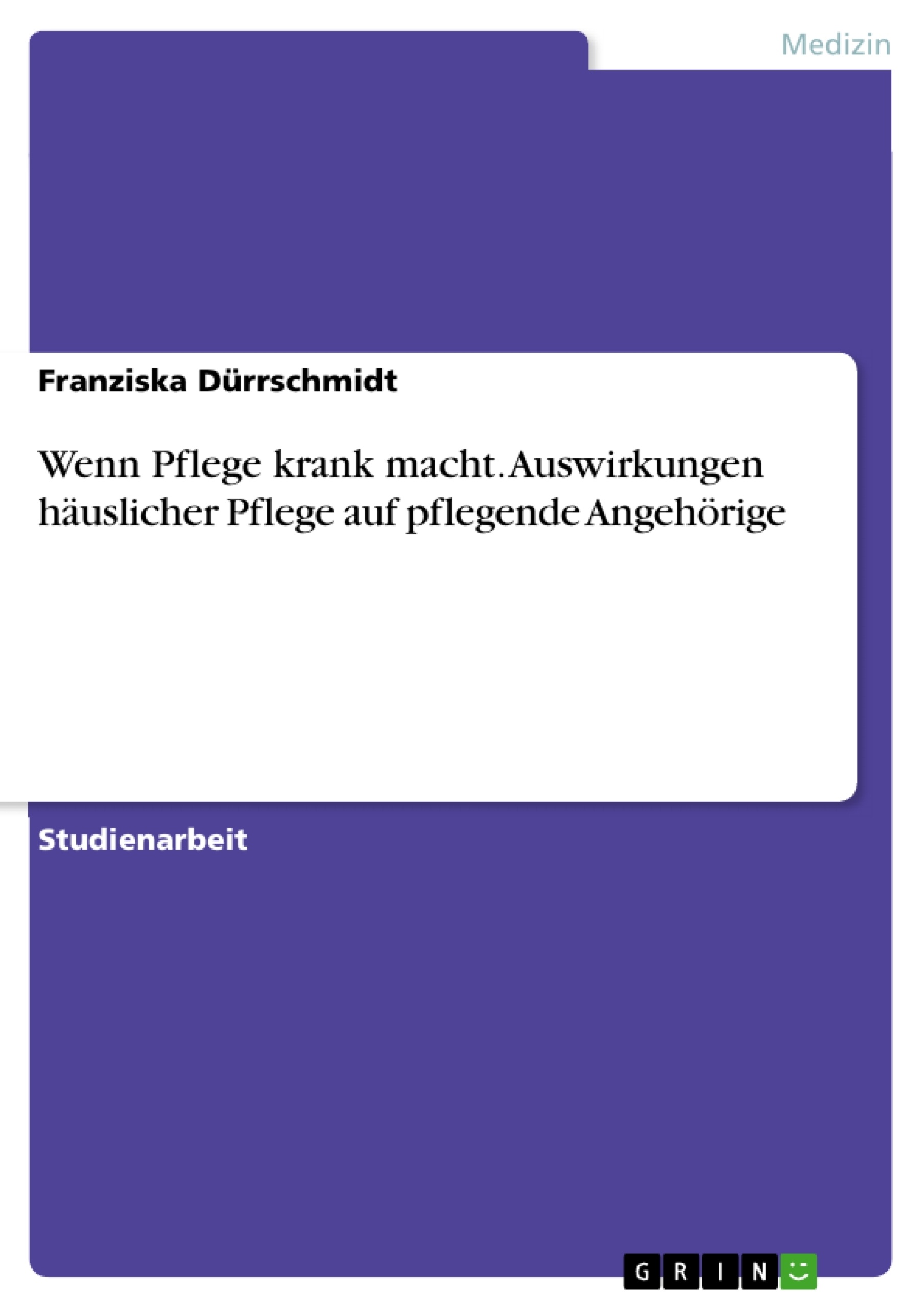Mehr als 2,8 Millionen Menschen waren 2015 in Deutschland pflegebedürftig - Tendenz steigend. Den Hauptgrund für diesen Anstieg liefert der demografische Wandel, im Zuge dessen die Menschen immer älter werden. Künftig wird pflegenden Angehörigen damit eine noch größere Bedeutung in der Pflege zuteil als heute, denn bereits 2015 wurden 71% der pflegebedürftigen Menschen zuhause versorgt.
Mit der immensen Verantwortung als größter informeller Pflege- und Betreuungsdienst der Gesellschaft gehen bei den pflegenden Angehörigen auch hohe Belastungen einher. Beginnend mit der Diagnose einer chronischen Krankheit können sowohl die Bewältigung des Alltags als auch physische Beanspruchungen, das Ausmaß der Pflege, die Erkrankungsdauer sowie die zeitliche Beanspruchung ebenso Stressoren für die Angehörigen darstellen wie die emotionale Belastung, die veränderte Beziehung zu den Pflegebedürftigen, Schuldgefühle, Einsamkeit und Isolation. Aufgrund dieser vielfältigen gesundheitlichen Auswirkungen häuslicher Pflege begeben sich pflegende Angehörige in Gefahr, selbst zu Patienten zu werden. Sie werden daher auch als „hidden patients“ oder „second victims“ bezeichnet.
Aufgrund der starken aktuellen Relevanz der Thematik soll es das Ziel dieser Arbeit sein, konkrete Belastungsfaktoren sowie deren wissenschaftlich belegte Auswirkungen auf pflegende Angehörige zusammenfassend und übersichtlich darzustellen. Hierfür werden zunächst die Tätigkeitsbereiche informell Pflegender skizziert. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden dann sowohl psychische als auch physische Auswirkungen der täglichen Belastungssituation pflegender Angehöriger dargestellt. Nachfolgend wird auf weitere Auswirkungen der Pflegeübernahme eingegangen. Im Rahmen dessen wird geklärt, ob aus der zeitlichen Einbindung pflegender Angehöriger berufliche Einschränkungen und/oder finanzielle Einbußen resultieren. Abschließend wird die Geschlechterverteilung pflegender Angehöriger dargestellt. Hierbei wird auch auf geschlechterspezifische Unterschiede bei der Belastungsempfindung sowie den Auswirkungen der Belastung eingegangen. Dies erfolgt, da es für die im Fazit dargestellten möglichen, zukünftigen Implikationen von Bedeutung ist.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
1 Herausforderungen des Pflegealltags
2 Psychische Auswirkungen der häuslichen Pflege auf pflegende Angehörige
3 Physische Auswirkungen der häuslichen Pflege auf pflegende Angehörige
4 Weitere Auswirkungen der Pflege auf pflegende Angehörige
4.1 Der Faktor Zeit
4.2 Auswirkungen auf das Berufsleben pflegender Angehöriger
4.3 Finanzielle Belastung pflegender Angehöriger
5 Geschlechterspezifische Unterschiede
Fazit
Literaturverzeichnis