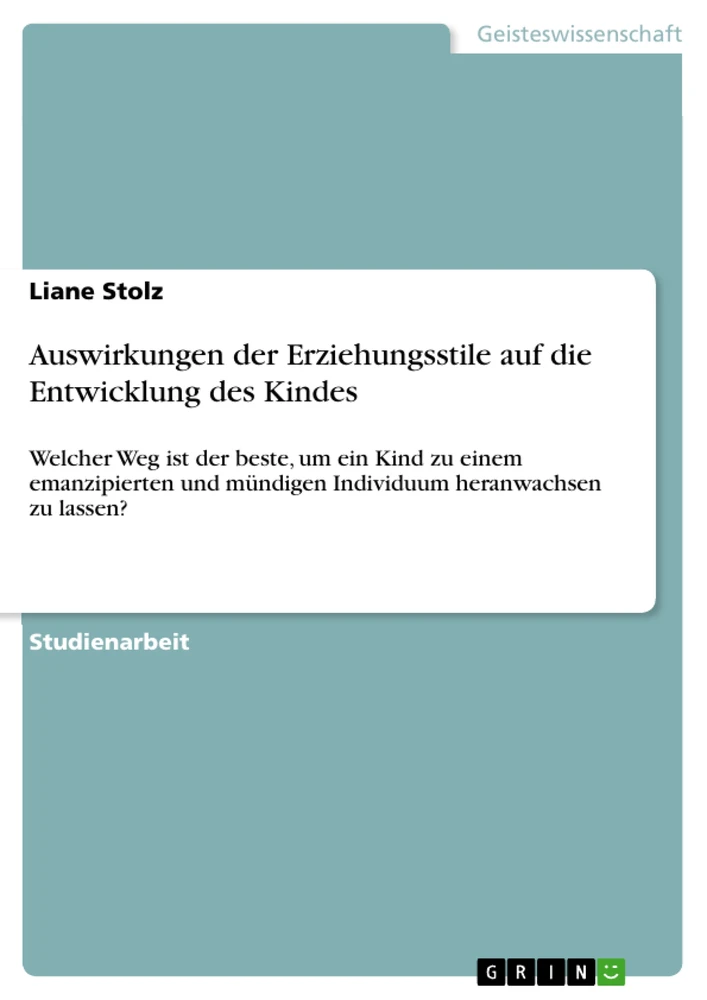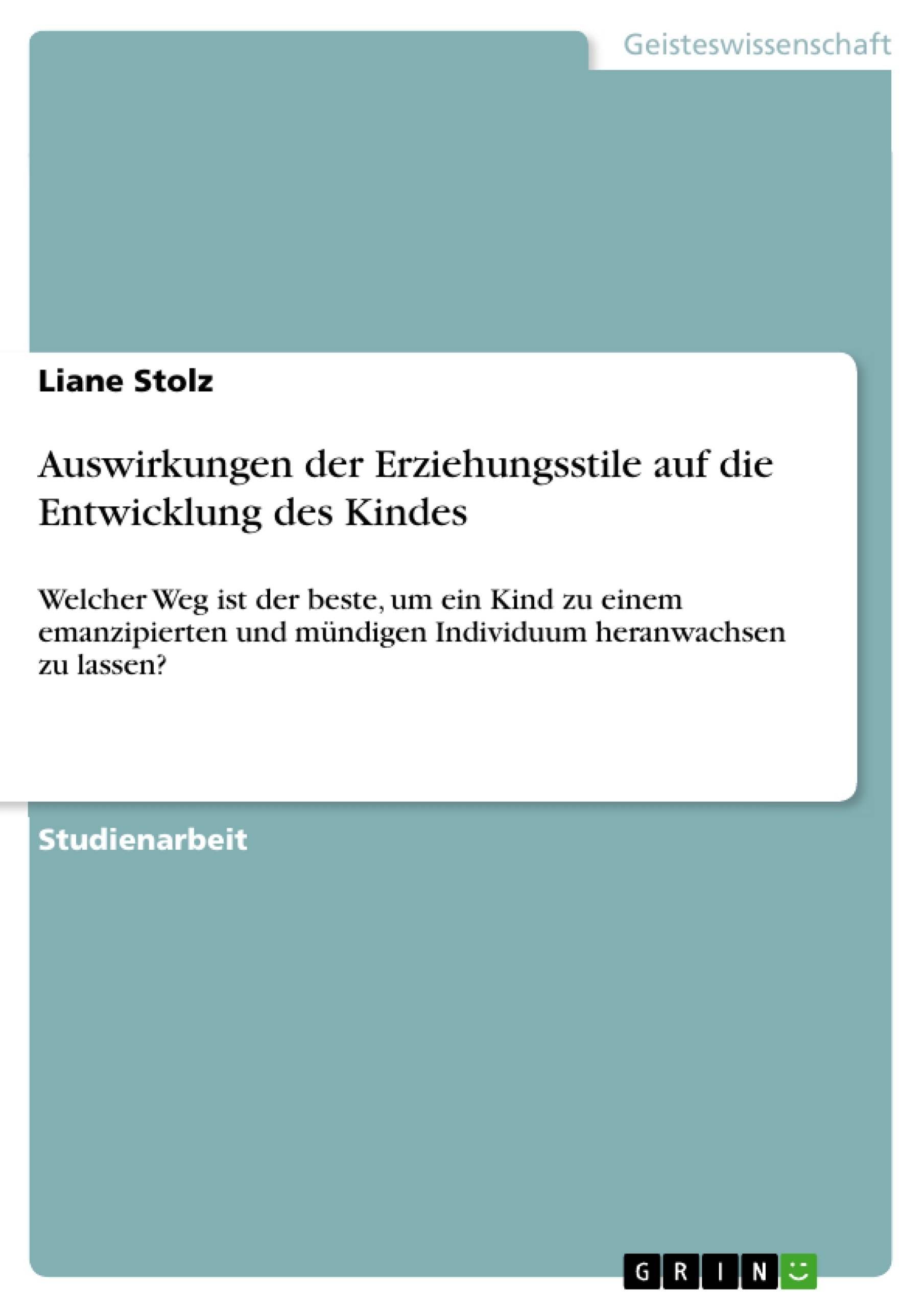Der Familie wird eine wichtige und bedeutungsvolle Aufgabe übertragen. Sie ist die Sozialisationsinstanz für den heranwachsenden Menschen – dem Kind. Die Familie ist der zentrale Ort für die Kindererziehung. Dort wachsen die Kinder auf und erlernen grundlegende Dinge, materiellen, aber auch nicht-materiellen Wertes. Sie ist der Ort der Persönlichkeitsentwicklung und verfolgt das Ziel, die Kinder zu selbstbewussten, glücklichen und verantwortungsvollen Individuen heranwachsen zu lassen. Doch es gibt verschiedene Wege und Methoden diese Ziele der Erziehung zu erreichen. Kinder brauchen zum einen klare Grenzen und Strukturen, um den Alltag bewältigen zu können. Im Gegensatz dazu steht das Prinzip der freien Entfaltung der Persönlichkeit.
Eine wichtige Rolle spielen bei der Entwicklung der individuellen Persönlichkeit die Erziehungsstile der Eltern. Es stellt sich dabei immer wieder die Frage bei vielen Eltern, wie viele Grenzen man dem Kind setzten sollte, ohne die kindlichen Bedürfnisse zu sehr einzuschränken oder gar außer Acht zu lassen. Das Ziel der meisten Eltern ist es, das Kind zu einem belastbaren, entscheidungsfähigen, selbstständigen, disziplinierten und lebensfähigen Menschen zu erziehen, der sich seiner Grenzen bewusst ist.
Dabei ist fraglich, welchen Weg man wählen sollte, um dieses Ziel erreichen zu können. Im Laufe der Zeit hat sich der Erziehungsstil verändert. Während anfangs der autoritäre Erziehungsstil sehr gefragt war, der sich durch Strenge und Disziplin auszeichnete, tendieren heutzutage die Eltern eher zu einem Stil, der weniger Grenzen setzt und seinen Fokus auf die Selbstentfaltung und die Bedürfnisse der Kinder richtet – das Demokratieprinzip hat sich im Laufe der Zeit auch auf die Erziehung ausgeweitet.
Welcher Erziehungsstil führt zu welchen Folgen und welcher Stil fördert die primären Erziehungsziele: Emanzipation und Mündigkeit?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
1.2 Problemstellung und Untersuchungsziele der Arbeit
1.3 Vorgehensweise
2 Begriffliche und theoretische Grundlagen
2.1 Erziehung
2.2 Erziehungsstil
2.3 Klassifikation Erziehungsstil
2.4 Erziehungsziele
2.4.1 Emanzipation
2.4.2 Mündigkeit
3 Erziehungsstile und ihre Auswirkungen
3.1 Autoritärer Erziehungsstil
3.1.1 Auswirkung
3.2 Permissiv-verwöhnender Erziehungsstil
3.2.1 Auswirkung
3.3 Vernachlässigender Erziehungsstil
3.3.1 Auswirkung
4 Merkmale eines entwicklungsfördernden Verhaltens
4.1 Fünf Säulen einer guten Erziehung
4.1.1 Liebe und emotionale Wärme vs. emotionale Kälte bzw. Überhitzung
4.1.2 Achtung und Respekt vs. Missachtung
4.1.3 Kooperation vs. Dirigismus
4.1.4 Struktur, Verbindlichkeit und Grenzsetzung vs. Chaos und Beliebigkeit
4.1.5 Allseitige Förderung vs. einseitige (Über-) Förderung
4.2 Der autoritativ-partizipative Erziehungsstil
4.2.1 Auswirkung
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema
Der Familie wird eine wichtige und bedeutungsvolle Aufgabe übertragen. Sie ist die Sozialisationsinstanz für den heranwachsenden Menschen – dem Kind. Die Familie ist der zentrale Ort für die Kindererziehung. Dort wachsen die Kinder auf und erlernen grundlegende Dinge, materiellen, aber auch nicht-materiellen Wertes. Sie ist der Ort der Persönlichkeitsentwicklung und verfolgt das Ziel, die Kinder zu selbstbewussten, glücklichen und verantwortungsvollen Individuen heranwachsen zu lassen. Doch es gibt verschiedene Wege und Methoden diese Ziele der Erziehung zu erreichen. Kinder brauchen zum einen klare Grenzen und Strukturen, um den Alltag bewältigen zu können. Im Gegensatz dazu steht das Prinzip der freien Entfaltung der Persönlichkeit.
Eine wichtige Rolle spielen bei der Entwicklung der individuellen Persönlichkeit die Erziehungsstile der Eltern. Es stellt sich dabei immer wieder die Frage bei vielen Eltern, wie viele Grenzen man dem Kind setzten sollte, ohne die kindlichen Bedürfnisse zu sehr einzuschränken oder gar außer Acht zu lassen. Das Ziel der meisten Eltern ist es, das Kind zu einem belastbaren, entscheidungsfähigen, selbstständigen, disziplinierten und lebensfähigen Menschen zu erziehen, der sich seiner Grenzen bewusst ist. Dabei ist fraglich, welchen Weg man wählen sollte, um dieses Ziel erreichen zu können. Im Laufe der Zeit hat sich der Erziehungsstil verändert. Während anfangs der autoritäre Erziehungsstil sehr gefragt war, der sich durch Strenge und Disziplin auszeichnete, tendieren heutzutage die Eltern eher zu einem Stil, der weniger Grenzen setzt und seinen Fokus auf die Selbstentfaltung und die Bedürfnisse der Kinder richtet – das Demokratieprinzip hat sich im Laufe der Zeit auch auf die Erziehung ausgeweitet.
Welcher Erziehungsstil führt zu welchen Folgen und welcher Stil fördert die primären Erziehungsziele: Emanzipation und Mündigkeit?
1.2 Problemstellung und Untersuchungsziele der Arbeit
Diese wissenschaftlich begründete Seminararbeit soll nun die Auswirkungen der Erziehungsstile auf die Entwicklung des Kindes aufzeigen. Es wird unter anderem auf die Problemstellung eingegangen, inwieweit eine geringe Intervention seitens der Eltern in der Erziehung zu mehr Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein führe oder um dieses Ziel erreichen zu können, ein führendes Vorbild von Nöten sei.
Ziel ist es herauszufinden, welcher Erziehungsstil am ehesten zu einem emanzipierten und mündigen Menschen führt.
1.3 Vorgehensweise
Zur Klärung dieser Fragestellung werden zunächst Erläuterungen zur Erziehung und zu den Erziehungsstilen im Allgemeinen gegeben. Zudem werden die primären Erziehungsziele – Emanzipation und Mündigkeit – determiniert. Im Anschluss werden die einzelnen Erziehungsstile definiert und deren Folgen dargelegt.
Aufgrund der Weitläufigkeit des Themas der verschiedenen Erziehungsstile, wird beschränkend auf den Ansatz von Baumrind[1] und dessen Erweiterung durch Maccob und Martin[2] eingegangen. Abschließend werden die Fünf Säulen einer guten Erziehung von Tschöpe-Scheffler[3] vorgestellt und Bezug auf Hurrelmanns[4] autoritativ-partizipativen Erziehungsstil genommen, welcher auch unter dem Terminus der sozialintegrativen Erziehung bekannt ist und die goldene Mitte unter den Erziehungsstilen deskribiert.
2 Begriffliche und theoretische Grundlagen
2.1 Erziehung
Erziehung wird als eine soziale Interaktionsform und als Lernprozess verstanden. Die Erziehung verfolgt den Zweck der Sozialisation, der Personalisation und der Enkulturation, bei der zwingend menschliche Lernhilfe erforderlich ist.[5] Brezinka definiert die Erziehung als soziale Handlungen, „durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Disposition anderer Menschen dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten oder die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht beurteilt werden, zu verhüten.“[6] Demnach differenziert Brezinka zwischen dem Erzieher und dem Zu-Erziehenden. Dem Erzieher kommt die Aufgabe zu teil, mittels sozialen Handlungen auf das zu erziehende Objekt – das Kind – einzuwirken und dieses dauerhaft positiv zu verändern.[7] Da die Erziehung Bestandteil mehrerer Instanzen ist, wird im Weiteren einschränkend auf die elterliche Erziehung der Kinder eingegangen.
2.2 Erziehungsstil
„«Erziehungsstil» bezeichnet eine Klasse theoretischer Konstruktionen, mit der interindividuell variable, aber intraindividuell vergleichsweise stabile Tendenzen von Eltern beschrieben werden, in erziehungsthematischen Situationen mit spezifischen kindbezogenen Verhaltensweisen zu reagieren. Mit dem Begriff «Stil» werden also keine Erziehungseinstellungen, Erziehungsziele oder instrumentelle Überzeugungen, sondern Verhaltenstendenzen bezeichnet.“[8]
Für J. Dolch ist ein Erziehungsstil „der gemeinsame, charakteristische Grundzug, die besondere Ausprägung des erzieherischen Verhaltens und Handelns eines Einzelerziehers oder einer Gesinnungs- oder Altersgruppe von Erziehern.“[9] Die Stile beschreiben die Art und Weise, wie sich Eltern gegenüber ihrem Kind verhalten. Eine aktuellere Definition von Köck und Ott bezeichnet den Erziehungsstil als „die dominante Form konkreten erzieherischen Verhaltens in der Interaktion mit Kindern.“[10]
Die Erziehungsstile entwickeln sich durch zwei Erziehungsdimensionen. Dabei steht auf der einen Seite das Ausmaß an elterlicher Wärme und Vertrauen und auf der anderen Seite die elterliche Kontrolle und Strenge. Je nachdem wie eine Grundeinstellung zum Kind ausgeprägt ist, ergibt sich ein Erziehungsstil. Das heißt, dass der Stil durch den Grad der Zuwendung und Unterstützung der Eltern für ihr Kind und gleichzeitig durch ihre Anforderung und Überwachung, sowie strenge gebildet wird und zu verschiedenen Erziehungsstilen zuordbar ist.[11] Jeder Erziehungsstil beeinflusst die Persönlichkeit des Kindes auf unterschiedliche Art und Weise.[12]
2.3 Klassifikation Erziehungsstil
Im Jahre 1953 entwickelte Kurt Lewin die Erziehungsstile nach der Klassifikation von Führungsstilen. Er kreierte drei Laborsituationen, in denen Jungen einem Gruppenleiter zugeordnet wurden. Jeder Gruppenleiter unterschied sich im Führungsverhalten. Dabei entstand der autokratische, demokratische und der laissez-faire Stil.[13]
Diana Baumrind führte 1971 Untersuchungen durch, die auf den Beobachtungen von Eltern-Kind-Interaktionen basierten. Dabei unterschied sie, ähnlich wie Kurt Lewin, drei elterliche Erziehungsstile und nannte diese den autoritären, den permissiven und den autoritativen Stil. Der autoritative Stil unterscheidet sich vom demokratischen Erziehungsstil nach Kurt Lewin insoweit, dass Grenzen und Regeln eine größere Bedeutung zugeschrieben wird als die Freiheit des Kindes. Eltern, die ihr Verhalten diesem Stil zuordnen, üben eine stärkere Kontrolle auf das Kind aus. Der permissive Stil beschreibt eine vernachlässigende Erziehung und kann daher nicht von der eigentlichen Herkunft des Wortes ‚permit‘ als erlaubend abgeleitet werden.[14]
1983 erweiterten schließlich Maccoby und Martin die Differenzierung von Daumrind und splitteten den permissiven Erziehungsstil in den permissiv-verwöhnenden und den zurückweisend-vernachlässigenden Stil.[15]
2.4 Erziehungsziele
Die „Erziehungsziele entsprechen den wünschens- und erstrebenswerten Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Einstellungen und Persönlichkeitseigenschaften, die […] als wertvoll angesehen werden.“[16] In der heutigen Zeit werden besonders die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen, wie auch die Ehrlichkeit, das Verantwortungsbewusstsein, die Hilfsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit priorisiert.[17] Diese Ziele lassen sich mit den Oberbegriffen der Emanzipation und der Mündigkeit zusammenfassen.
2.4.1 Emanzipation
Emanzipation ist, wie auch die Mündigkeit, ein ursprünglicher Rechtsbegriff. Emanzipation bezeichnet den Rechtsakt, der zum Erwerb des Rechtsstatus der Mündigkeit führt.[18] Die Loslösung aus einem Zustand der Abhängigkeit ist das Ziel der Emanzipation.[19] Demnach ist unter dem Begriff der Emanzipation der „Abbau von Fremdbestimmung mit dem Ziel positiver Selbstverwirklichung von Einzelnen, Gruppen und Gesellschaften“[20] zu verstehen. Es gibt zwei verschiede Ausrichtungen der Emanzipation aus der pädagogischen Sicht. Einerseits steht Emanzipation pädagogisch-statisch gesehen für den „erreichte[n] Zustand der Selbstverwirklichung von Einzelnen oder Gruppen“[21], wodurch die Mündigkeit erreicht wird. Andererseits beschreibt die pädagogisch-dynamische Emanzipation den Prozess, bei dem sich ein Individuum selbstverwirklicht.[22] Beide Ausrichtungen zielen darauf ab, dass sich das Subjekt von zunächst notwendigen Beschränkungen befreit und das Vertrauen in sich stärkt. Zudem beinhaltet der Emanzipationsbegriff in der Pädagogik die individuelle und gesellschaftliche Selbstbestimmung.[23]
2.4.2 Mündigkeit
„Mündigkeit ist die rechtliche Befugnis, seine eigenen Interessen selbst wahrzunehmen, verbindliche Rechtsgeschäfte abzuschließen und politische Bürgerrechte im Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung als Gleicher unter Gleichen auszuüben.“[24] Sie ist das „Ergebnis des Emanzipations- oder Selbstverwirklichungsprozesses“[25], die auf drei Ebenen stattfindet. Die erste Dimension ist die Selbstfähigkeit, worunter man die „Fähigkeit zur Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und sachgerechte[n] Entscheidung“[26] versteht. Die Dufähigkeit befähigt „zur partnerschaftlichen Begegnung mit anderen Menschen, zur produktiven Teilnahme an Gruppenprozessen und zur aktiven Auseinandersetzung mit den Hintergründen und aktuellen Erscheinungen der gesellschaftlichen Entwicklung.“[27] Die letzte erreichbare Fähigkeit ist die Weltfähigkeit. Sie beinhaltet die Befähigung „in Ausbildung, Beruf, öffentlichem und privatem Bereich die Sachgüterwelt kooperativ und verantwortlich so zu gebrauchen oder zu verändern, dass sie der gesamten Menschheit nutzbar gemacht und zugleich ihrer eigenen Struktur nicht beraubt wird.“[28] Mündigkeit stellt somit eine Befähigung und Bereitschaft dar, mit Vernunft, Einsicht und kritischen Urteil sein Leben selbstständig zu führen und auch die Tragweite von Konsequenzen selbstständiger Entscheidungen zu überblicken und tragen zu können. Die Emanzipation ist ein dynamischer Prozess und nicht endgültig erreichbar.[29]
3 Erziehungsstile und ihre Auswirkungen
3.1 Autoritärer Erziehungsstil
Maßgeblich für den autoritären Erziehungsstil ist die Strenge, ein hohes Maß an Regeln, hohe Erwartungen und die Bestrafung. Aufgrund der strengen Regeln und Befehle ist es den Kindern kaum möglich, sich zu entfalten und ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Die Eltern schränken die freie Meinungsäußerung ihrer Kinder stark ein und gehen nur geringfügig auf ihre Bedürfnisse und Wünsche ein. Zudem stellen autoritäre Eltern hohe Anforderungen an ihre Kinder, welche meist nicht realisierbar sind. Ihr Verhältnis zum Kind ist kalt und kaum feinfühlig, wodurch sie der Individualität und Selbstständigkeit des Kindes entgegenwirken. Auf der Hausordnung stehen die Einhaltung vieler Regeln, Verbote und strikter Gehorsam. Ein Widersprechen wird nicht geduldet und bei Nichteinhaltung der Regeln droht meist körperliche Züchtigung (massive, harte Strafen). Bestrafende Disziplinierungsnahmen bestimmen den autoritären Erziehungsstil, wodurch die Einhaltung der Regeln erreicht werden soll. Die Eltern bilden eine natürliche Autorität, dem sich das Kind wie in einer Hierarchie unterordnen muss. Es befindet sich in einer psychologischen Kontrolle, in der es entsprechend den elterlichen Vorstellungen, in seinem Verhalten und Denken gelenkt wird.[30] Ziel ist es, den Kindern Orientierung und Wertevorstellungen zu vermitteln und sie auf die gesellschaftlichen Anforderungen vorzubereiten. Mittel zum Zweck ist das gezielte Eingreifen in die Persönlichkeitsentwicklung.[31]
3.1.1 Auswirkung
Kinder, die autoritär erzogen wurden, besitzen im Allgemeinen wenig Selbstsicherheit und Selbstständigkeit, sowie die Unfähigkeit Entscheidungen selbst zu treffen, da in der Vergangenheit alle Entscheidungen von den Eltern abgenommen wurden. Sie erleiden eine Einschränkung der Kreativität und Spontanität, da Aktivitäten nie selbst bestimmt wurden. Des Weiteren wird dem Kind kein Freiraum geschaffen, um sich entfalten zu können und um ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln zu können. Der Duktus der Eltern wird übernommen und es entwickelt sich ein egozentrisches Sprachverhalten, bei denen Ich, Mein, Mich und Mir überwiegen. Gegenüber Schwächeren neigen autoritär erzogene Kinder zu aggressivem Verhalten, um eine Machtposition auszuleben, die sie im Elternhaus nie besessen haben. Zudem wird ein aggressives Verhalten genutzt, um Aufmerksamkeit für ihre missachteten Bedürfnisse zu provozieren. Solche Kinder zeigen ein geringes Selbstvertrauen, sowie eine geringe soziale Kompetenz. Sie sind häufig ängstlich und fühlen sich unter Druck gesetzt.[32]
3.2 Permissiv-verwöhnender Erziehungsstil
Der permissiv-verwöhnende Erziehungsstil bildet die Kehrseite des autoritären Stils. Bei dieser Form spielen Kontrolle, Lenkung, Bestrafung und hohe Anforderungen an das Kind kaum eine Rolle. Dieser Stil zeichnet sich dadurch aus, dass die Eltern dem Kind die Freiheit geben, die es benötigt, um eigenständig zu handeln und eigene Entscheidungen treffen zu können.[33] Es werden weitestgehend Eingriffe in die Persönlichkeitsentwicklung vermieden, um den Willen des Kindes nicht zu unterdrücken. Maßgeblich ist die Unterstützung für das Kind, die liebevollen Zuwendungen und das Berücksichtigen der Bedürfnisse ebenso die Wünsche der Kinder. Die Eltern sind nachgiebig, tolerant, warmherzig und dem Kind zugewandt.[34]
[...]
[1] vgl. Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. In: Develop mental Psychology Monograph, Band 4, Heft 1, S. 1-103.
[2] vgl. Maccoby, E. E./ Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of family. Parentchild interaction. In: P. H. Mussen/ E. M. Hetherington (Hrsg.), Handbook of Child Psychology, Socialization, Personality and Social Development (4. Aufl.). New York: Wiley, S. 1-101.
[3] vgl. Tschöpe-Scheffler, S. (2003). Fünf Säulen der Erziehung. In: Psychologie heute 6, S. 44-47.
[4] vgl. Hurrelmann, K. (2006). Einführung in die Sozialisationstheorie. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S. 158f.
[5] vgl. Loch, W., 1968, S. 163f., 165ff., zitiert nach Weber, E. (1973). Erziehungsstile (4. Aufl.). Donauwörth: Verlag Ludwig Auer, S. 24.
[6] Brezinka, zitiert nach Raithel, J./ Dollinger, B./ Hörmann, G. (2009). Einführung Pädagogik. Begriffe, Strömungen, Klassiker, Fachrichtungen (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 22.
[7] vgl. Gudjons, H. (1995). Pädagogisches Grundwissen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 186.
[8] Krohne, H. W. (1988). Erziehungsstilforschung. Neuere theoretische Ansätze und empiri-sche Befunde. In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, Heft 3, S. 158.
[9] Dolch, J., 1960, S. 58f., zitiert nach Weber, E. (1973). Erziehungsstile (4. Aufl.). Donauwörth: Verlag Ludwig Auer, S. 24.
[10] Köck, P./ Ott, H. (1994). Wörterbuch für Erziehung und Unterricht. Donauwörth: Auer Verlag, S. 193.
[11] vgl. Krohne, H. W. (1988). Erziehungsstilforschung. Neuere theoretische Ansätze und empirische Befunde. In: Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, Heft 3, S. 161f.
[12] vgl. Hurrelmann, K. (2006). Einführung in die Sozialisationstheorie (9. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S. 156. (künftig zitiert: Hurrelmann, 2006)
[13] vgl. Liebenwein, S. (2008). Erziehung und Soziale Milieus. Elterliche Erziehungsstile in milieuspezifischer Differenzierung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 32.
[14] vgl. Liebenwein, S. (2008). Erziehung und Soziale Milieus. Elterliche Erziehungsstile in milieuspezifischer Differenzierung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 32.
[15] vgl. ebd., S. 32.
[16] Hurrelmann, 2006, S. 156.
[17] vgl. ebd., S. 156f.
[18] vgl. Lang, H./ Nugel, M./ Rapold, M. (2011). Einführung in die Erziehungswissenschaft I. Normen und Ziele der Erziehung und Bildung. Pädagogische Anthropologie. Mündigkeit und Emanzipation als Symbolik oder Ziel- und Leerformeln im Generationsverhältnis. Unv. Diss., Universität Bamberg, S. 1.
[19] vgl. Duden (o.J.). „Emanzipation“. Zugriff am 24.03.2018. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Emanzipation.
[20] Hörmann, G. (2011). Einführung in die Erziehungswissenschaft I. Normen und Ziele der Erziehung und Bildung. Pädagogische Anthropologie. Unv. Diss., Universität Bamberg, S. 3.
[21] ebd., S. 3.
[22] vgl. ebd., S. 3.
[23] vgl. Lingenbach, K. Ch. (1971). Methodische Probleme. In: W. Klafki et al (Hrsg.). Erziehungswissenschaft, Band 3. Frankfurt: Fischer, S. 162.
[24] Lang, H./ Nugel, M./ Rapold, M. (2011). Einführung in die Erziehungswissenschaft I. Normen und Ziele der Erziehung und Bildung. Pädagogische Anthropologie. Mündigkeit und Emanzipation als Symbolik oder Ziel- und Leerformeln im Generationsverhältnis. Unv. Diss., Universität Bamberg, S. 1.
[25] Hörmann, G. (2011). Einführung in die Erziehungswissenschaft I. Normen und Ziele der Erziehung und Bildung. Pädagogische Anthropologie. Unv. Diss., Universität Bamberg, S. 3.
[26] ebd., S. 3.
[27] ebd., S. 3.
[28] ebd., S. 3.
[29] vgl. Lang, H./ Nugel, M./ Rapold, M. (2011). Einführung in die Erziehungswissenschaft I. Normen und Ziele der Erziehung und Bildung. Pädagogische Anthropologie. Mündigkeit und Emanzipation als Symbolik oder Ziel- und Leerformeln im Generationsverhältnis. Unv. Diss., Universität Bamberg, S. 5.
[30] vgl. Klemm, I. (2010). Der Erziehungsberater. Wie erziehe ich mein Kind richtig? Norderstedt: Books an Demand, S. 17-20.
[31] vgl. Hurrelmann, 2006, S. 158f.
[32] vgl. Klemm, I. (2010). Der Erziehungsberater. Wie erziehe ich mein Kind richtig? Norderstedt: Books an Demand, S. 17-20. (künftig zitiert: Klemm, 2010)
[33] vgl. Hurrelmann, 2006, S. 158f.
[34] vgl. Liebenwein, S. (2008). Erziehung und Soziale Milieus. Elterliche Erziehungsstile in milieuspezifischer Differenzierung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 34.