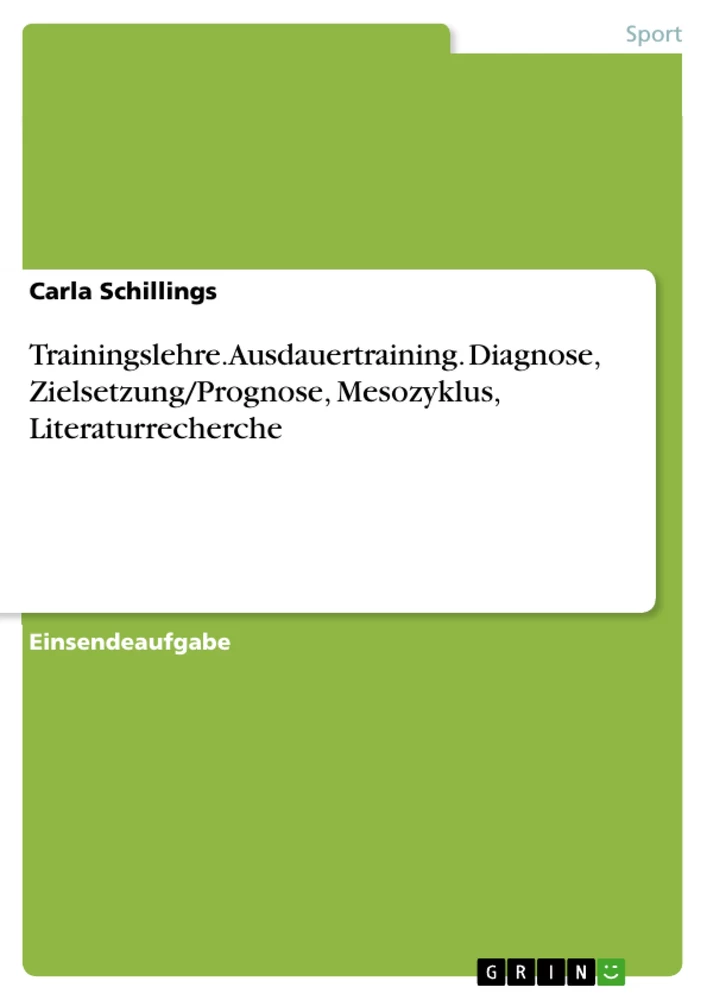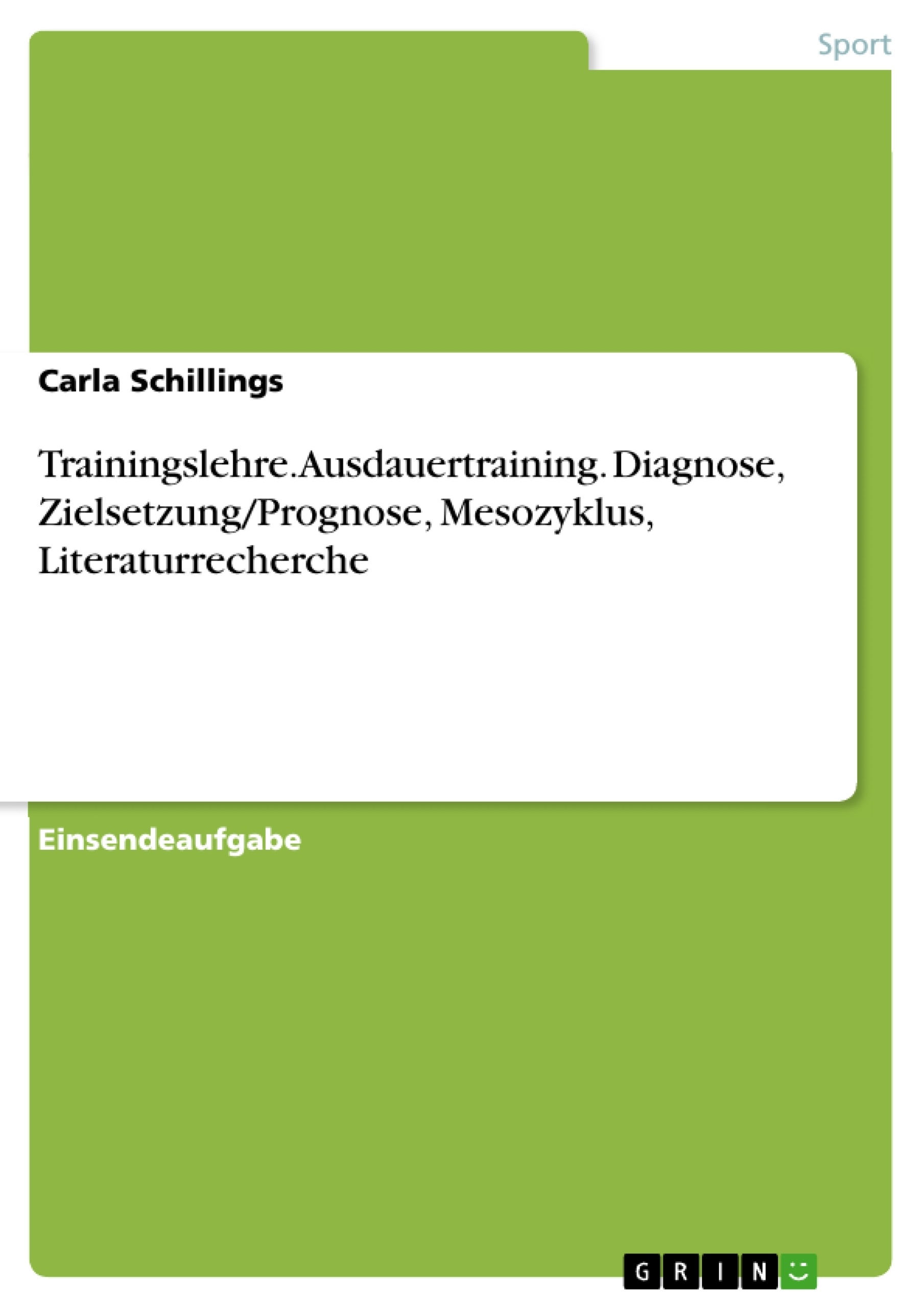Diese Einsendeaufgabe aus dem Modul "Trainingslehre 2" umfasst das Thema: Ausdauertraining.
Aus dem Inhalt:
- Diagnose: Allgemeine & biometrische Daten, Leistungsdiagnostik/Ausdauertest, Gesundheits- und Leistungsstatus;
- Zielsetzung/Prognose;
- Trainingsplanung Mesozyklus: Grobplanung, Detailplanung, Begründung;
- Literaturrecherche
Inhaltsverzeichnis
1 TEILAUFGABE 1 - DIAGNOSE
1.1 Allgemeine und biometrische Daten
1.2 Leistungsdiagnostik/Ausdauertest
1.3 Gesundheits- und Leistungsstatus der Person
2 TEILAUFGABE 2 - ZIELSETZUNG/PROGNOSE
3 TEILAUFGABE 3 - TRAININGSPLANUNG MESOZYKLUS
3.1 Grobplanung Mesozyklus
3.2 Detailplanung Mesozyklus
3.3 Begründung Mesozyklus
4 TEILAUFGABE 4 - LITERATURRECHERCHE
5 LITERATURVERZEICHNIS
6 TABELLENVERZEICHNIS
6.1 Tabellenverzeichnis
1 Teilaufgabe 1 - Diagnose
1.1 Allgemeine und biometrische Daten
Tab. 1: Allgemeine Daten (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Biometriselle Daten (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2 Leistungsdiagnostik/Ausdauertest
Das Testverfahren für einen optimalen Start in ein gezieltes Ausdauertraining wird mit dem IPN-Test und der Testdurchführung mit dem WHO-Prinzip erfolgen. Der submaximale Stufentest wird aufgrund der dreijährigen Pause des Kunden vom Training, welches Ausdauer,- Kraft- und Koordinationsschwerpunkte hatte, ausgewählt. Der Trainingsstatus ist somit untrainiert.
Eine weitere Indikation für die ausgewählte Testung ist der zu hohe Ruhepuls. Laut Dahm (2016) ist der Ruhepuls des Probanden mit drei Herzschlägen pro Minute zu hoch. Der Test wird auf dem Fahrradergometer durchgeführt, da so die die Belastung genau dosierbar ist und auch die Bewegung koordinativ leicht ist. Im Nachhinein ist ein ein Vergleich mit interindividuellen Normwerten möglich.
Testdurchführung :
Tab. 3: Voreinstufung für Testdurchführung (modifiziert nach IPN, 2004 & Trunz, 2001)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 4: Testdurchführung IPN (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach Trunz (2001) wird kein Pulsaufschlag bei der Voreinstufung stattfinden, da derzeit kein Ausdauertraining betrieben wird und auch seit drei Jahren kein Ausdauertraining getrieben wurde. Somit ist unsere Zielherzfrequenz bei dem IPN-Test nach WHO (2004) bei 155 Schlägen pro Minute. In Minute 12 geht der Puls aber bis auf 158 Schlägen pro Minute maximale Herzfrequenz bei 150 Watt.
Laut der Normwerttabelle nach IPN (2004) ist der Proband unter dem Durchschnitt der- Ausdauerleistungsfähigkeit, da er bei der maximalen Herzfrequenz pro Kilogramm 1,77 Watt von der Leistung schafft. Die relative Watt-Soll-Leistung liegt also im unterdurchschnittlichen Bereich bei einer Intensität von 0,56 (IPN, 2004).
Insgesamt kann man sagen, dass der IPN-Test nach WHO Richtlinien Unterdurchschnittlieh ist und erst einmal ein Training benötigt, was die Ausdauerleistungsfähigkeit aufbaut. Das Ziel ist eine Watt-Soll-Leistung von 2,0 Watt/kg zu erreichen.
1.3 Gesundheits- und Leistungsstatus der Person
Als Schlussfolgerung hat der Kunde insgesamt einen relativ guten Gesundheitszustand ohne ausgeprägte internistische oder orthopädische Beschwerden beziehungsweise EinSchränkungen. Auffällig ist, dass der Kunde eine zu hohe Herzfrequenz in Ruhe hat mit 83 S/min. Laut Dahm (2016) sollte die Herzfrequenz in Ruhe zwischen 70 und 80 s/min liegen.
Der Körperfettanteil sollte ebenfalls 2% reduziert werden durch das anstehende Ausdauertraining, da der Körperfettanteil bei Männern zwischen 8% und 20% liegt (Gallagher et al).
Der Trainingszustand der Person ist untrainiert. Dies wird einerseits gezeigt durch die geringe Aktivität, die sich allein auf Schulsport beschränkt und eine geringe Belastung aufweist. Andererseits treibt er auch in seiner Freizeit keinen Sport, vornehmlich keinen Ausdauersport. Vorerfahrungen hat er maximal durch das siebenjährige Fußballtraining, was Ausdauereinheiten beinhaltete. Doch auch Fußball treibt er seit drei Jahren nicht mehr. Der Beweis für die geringe Ausdauerleistungsfähigkeit ist das unterdurchschnittliche Ergebnis des Ausdauertests, wodurch ein genaues Ziel definiert werden kann, was erreicht werden sollte im interindividuellen Vergleich.
Da der Kunde ein Anfänger im Ausdauertrainings ist, beginnt er erst einmal mit einer geringen Intensität und auch die Trainingsdauer wird Stück für Stück gesteigert. Bei der Trainingsplanung müssen keine Kontraindikationen beachtet werden. Aus dem Grund können schnell Erfolge in Traini erb arkeit und Belastbarkeit erreicht werden.
2 Teilaufgabe 2 - Zielsetzung/Prognose
Tab. 5: Zielsetzung (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zunächst wird das Ziel der Senkung des Ruhepulses sein. Mit 20 Jahren schon einen zu hohen Puls in Ruhe zu haben, kann gefährliche Folgen haben. ״Nicht allein für die Allgemeinbevölkerung, auch bei bestehenden kardiovaskulären Erkrankungen wie arteriel- 1er Hypertonie, koronarer Herzerkrankung, Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz oder Schlaganfall wurde in epidemiologischen und klinischen Studien ein relevanter Zusammenhang zwischen der Herzfrequenz und der kardiovaskulären Sterblichkeit nachge- wiesen“ (Custodis et al, 2014, s. 1661). Die genannten Folgen einer erhöhten Ruheherzfrequenz sollten den Kunden motivieren mithilfe eines Ausdauertrainings seine Herzfrequenz in Ruhe zu senken. Auch Wenzer und Haber (2017) stellen eine ״Senkung der Ruhe- und Belastungsherzfrequenz“ fest bei einem Ausdauertraining, welches zwei bis drei mal in der Woche stattfinden soll. Man kann sich bei der Zielsetzung der Senkung der Ruheherzfrequenz an drei Schlägen pro Minute in 6 Wochen orientieren bei einem Ausdauertraining.
Das zweite Ziel des Kunden ist sein Trainingsmotiv ״Verbesserung der Fitness“ - wird hier inhaltlich ״Leistungssteigerung“ formuliert. Die Leistungssteigerung kann mit dem IPN-Test in einem Re-Test zum nachgewiesen werden. Der oben aufgezeigte Ausdauertest wird in 12 Wochen noch einmal wiederholt, um einen intraindividuellen Vergleich feststellen zu können. Bis dahin ist das Ziel eine Leistungssteigerung um 25% zu erreichen. Eine Steigerung kann man infolgedessen an der maximalen Herzfrequenz pro Kilogramm absehen. Momentan liegt der Kunde bei 1,77 Watt/kg. Ziel ist es der Rechnung nach 2,21 Watt/kg in dem Re-Test zu erreichen. Die Steigerung kann in der Normtabelle für submaximale Radergometertests - Relative Watt-Soll-Leistung (Watt pro kg) bei Männern (IPN, 2004) abgelesen werden. Mit 2,21 würde er sich vom unterdurchschnittlichen Bereich in den durchschnittlichen Bereich steigern.
Das letzte formulierte Ziel ist eine Körperfettreduktion um 2% in vier Monaten. Der Kunde selbst hat dieses Ziel als Trainingsmotiv als ״Abnehmen“ benannt. Umgewandelt wurde das Ziel letztendlich als Reduktion des Körperfettanteils, da dieser biometrische Parameter über dem Normwert lag, während der BMI gerade noch an der Grenze im Normalgewicht liegt. Da bei einem Ausdauertraining nicht unbedingt ein Muskelaufbau stattfindet, sondern eher eine Fettverbrennung, wird dieses Ziel in vier Monaten zu erreichen sein. Nachgewiesen wird dies mit der InBody 770, die den Körperfettanteil in Prozent messen bzw. errechnen kann. Zehnder und Bautellier (2002) beweisen, dass eine Fettoxidation bei einem Ausdauertraining stattfindet. Je trainierter der Mann ist, desto höher liegt auch die Fettoxidationsrate in g/min.
3 Teilaufgabe 3 - Trainingsplanung Mesozyklus
3.1 Grobplanung Mesozyklus
Tab. 6: Darstellung Grobplanung Mesozyklus (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Detailplanung Mesozyklus
Tab. 7: Darstellung Detailplanung Mesozyklus Woche 1 (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 8: Darstellung Detailplanung Mesozyklus Woche 2 (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 9: Darstellung Detailplanung Mesozyklus Woche 3 (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]