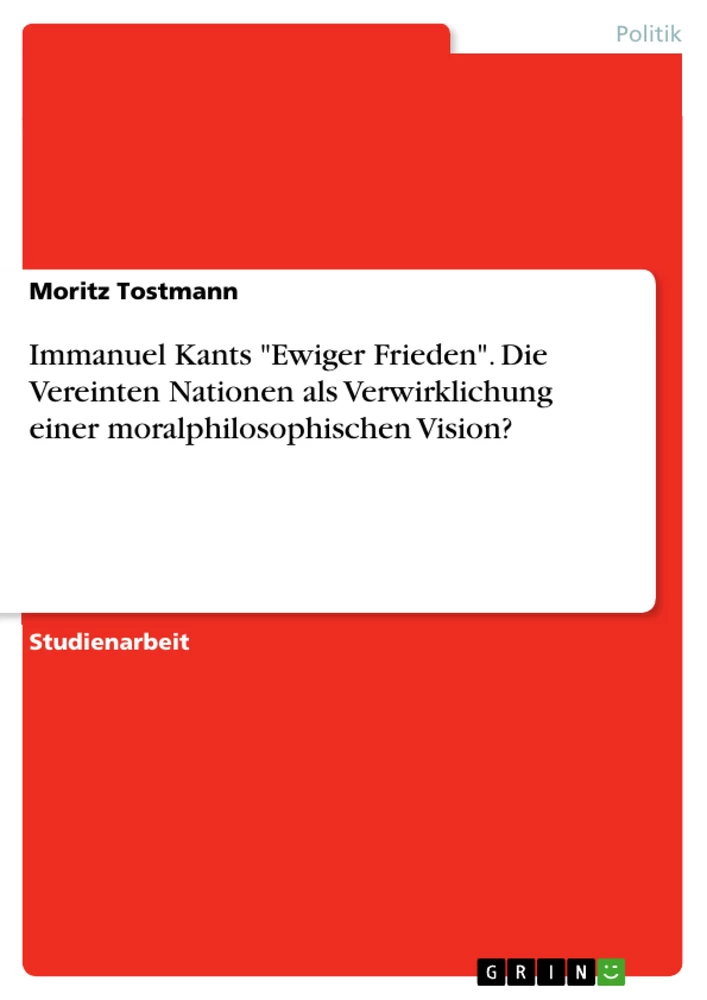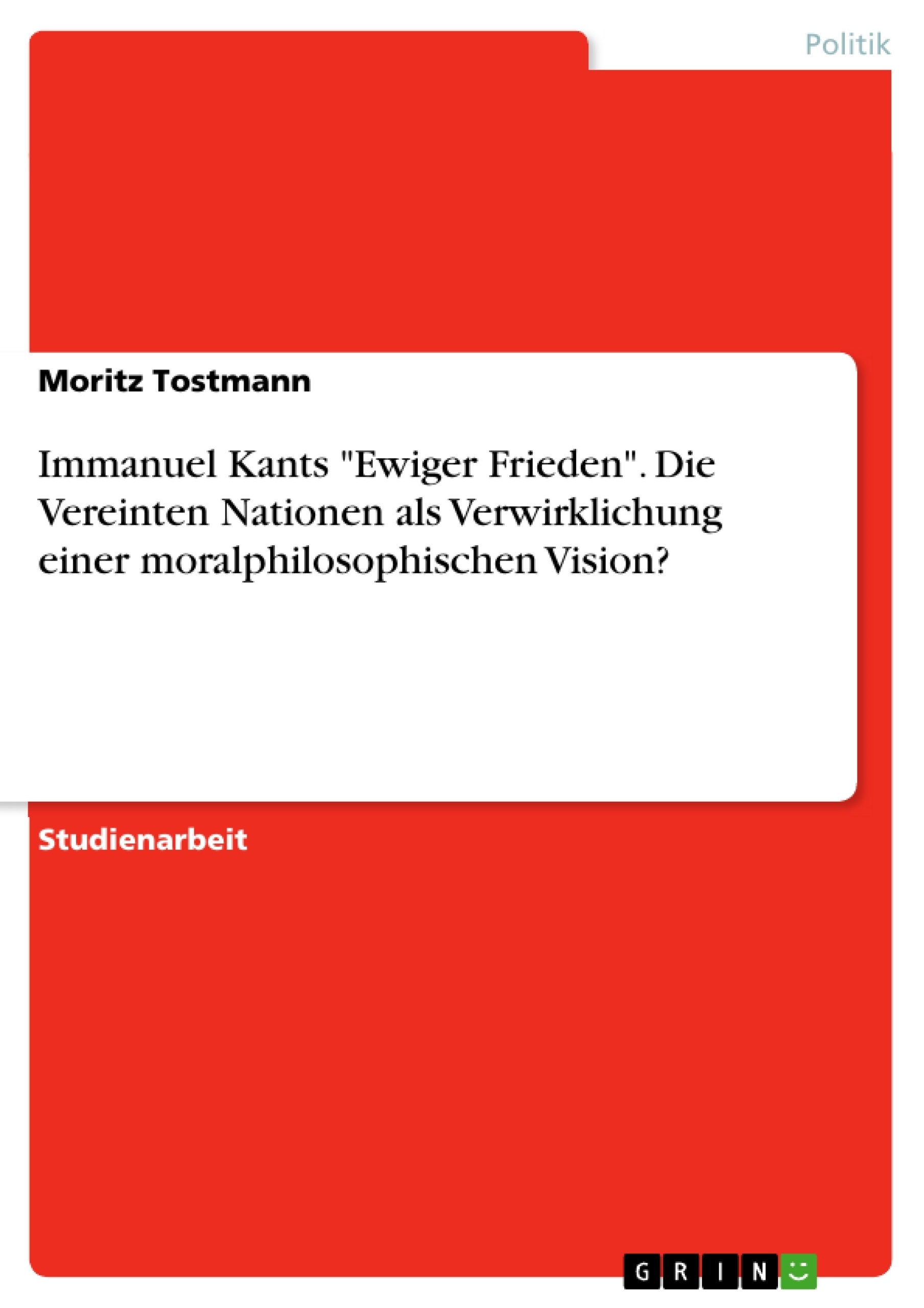Während vor über 200 Jahren noch Strukturen vorherrschten, in denen internationale Systeme, supranationale
Institutionen und völkerrechtliche Vereinbarungen kaum existent waren und Konflikte zwischen einzelnen Staaten und Allianzen im Vordergrund standen (und nicht Welt- und Bürgerkriege, Bombenterror und Partisanenkämpfe oder ideologisch motivierte Vernichtungs- und Verteidigungskriege), so haben sich seit Kants Vision vom ewigen
Frieden nicht nur vertraglichen Abhängigkeiten gebildet, sondern auch neue Konfliktlinien in der Weltpolitik abgezeichnet.
Immanuel Kant hatte schon vor über 200 Jahren die Idee eines umfassenden, rechtsstaatlichen Vertrages, der hypothetisch den „Ewigen Frieden“ stiften soll. „Die Idee einer mit dem natürlichen Rechte des Menschen zusammenstimmenden Konstitution: dass nämlich die dem Gesetz Gehorchenden auch zugleich, vereinigt, gesetzgebend sein sollen, liegt bei allen Staatsformen zugrunde, und das gemeine Wesen, welches ihr gemäß [...] ein platonisches Ideal heißt, ist nicht ein leeres Hirngespinst, sondern die ewige Norm für alle bürgerliche Verfassung überhaupt, und entfernet allen Krieg“ (Streit der Fakultäten, Werke VI, 3641).
Inhaltsverzeichnis
I. Einstieg
II. „Zum Ewigen Frieden“
A. Der Aufbau der Schrift
B. Kants Idee vom Naturzustand
C. Der Begriff „Friede“
D. Die sechs Praliminarartikel
E. Die drei Defintivartikel
III. Sicherung auf drei rechtlichen Ebenen
A. Staatsrechtliche Ebene
B. Volkerrechtliche Ebene
C. Weltburgerliche Ebene
IV. Die Vereinten Nationen
A. Volkerbund
B. Vereinte Nationen
C. Ein Vergleich - Die UNO im Lichte Kants
V. Schlussbetrachtung
VI. Literaturverzeichnis