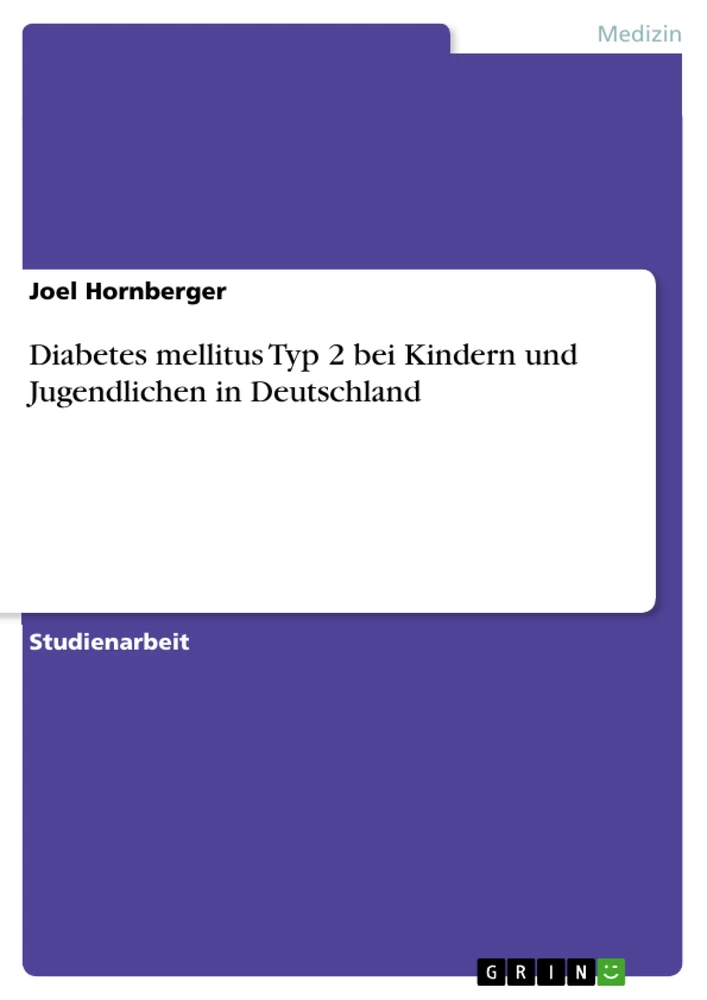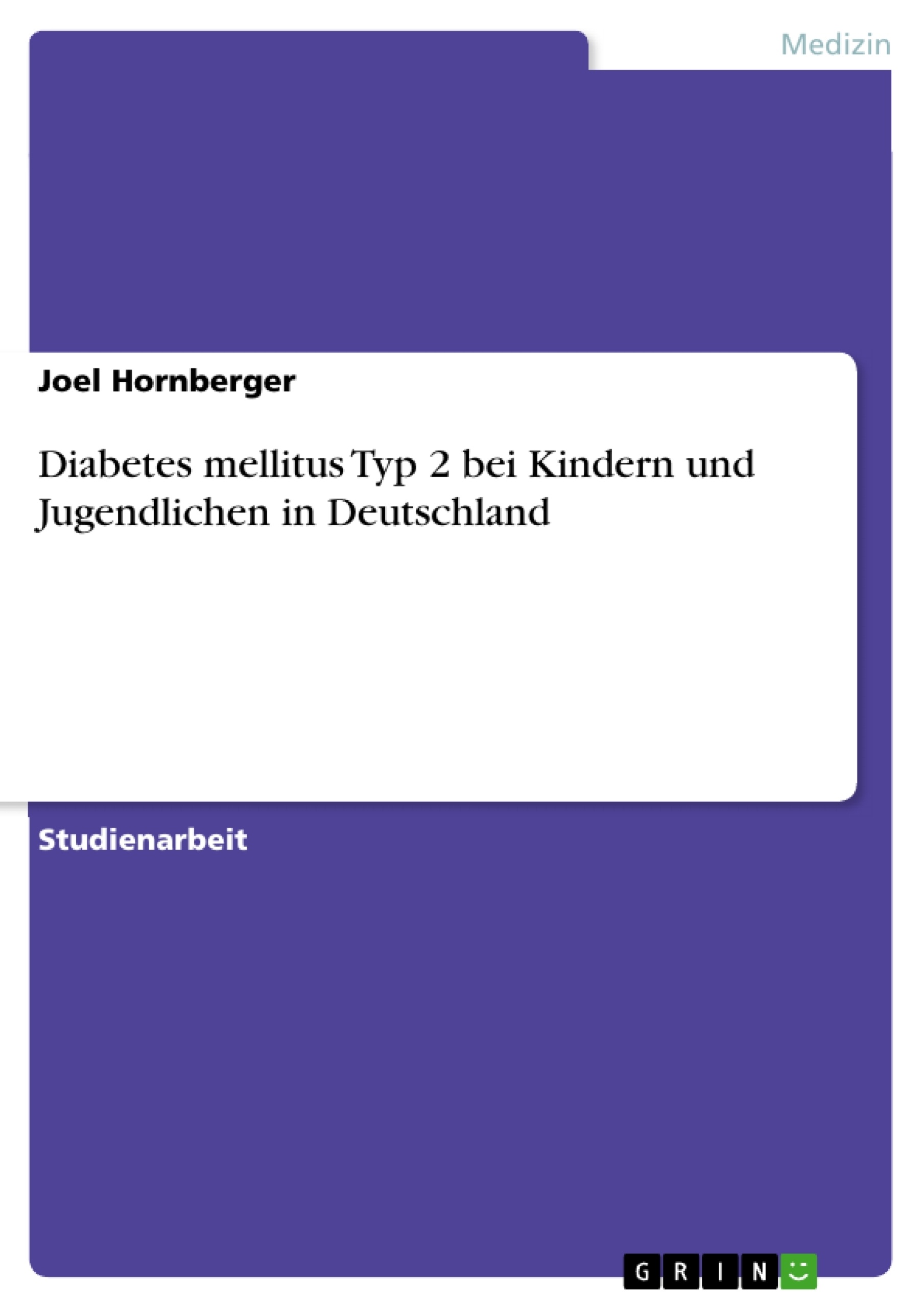Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage: Welche Entwicklung erwartet Deutschland für Diabetes mellitus Typ 2 erkrankte Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren in den kommenden Jahren? Dazu erfolgt eine ausführliche Ausarbeitung, mit Bezug zur Sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
1 Hinfuhrung zum Thema
2 Diabetes mellitus Typ 2
2.1 Krankheitsbild des Diabetes mellitus Typ 2
2.2 Prevention von Diabetes mellitus Typ 2
3 Forschungsstand und Einflussfaktoren
3.1 Die Entwicklung der Diabetes mellitus Typ 2 Pravalenz in Deutschland in den letzten Jahren
3.2 Verschiedene Faktoren mit direktem Einfluss auf eine Diabetes mellitus Typ 2 Erkrankung
4 Zukunftige Entwicklung in Deutschland
4.1 Einfluss der Sozialen Stellung
4.2 Fruherkennung von Diabetes mellitus Typ 2
4.3 Bestehende Prognosen
5 Diskussion
6 Fazit
Literaturverzeichnis