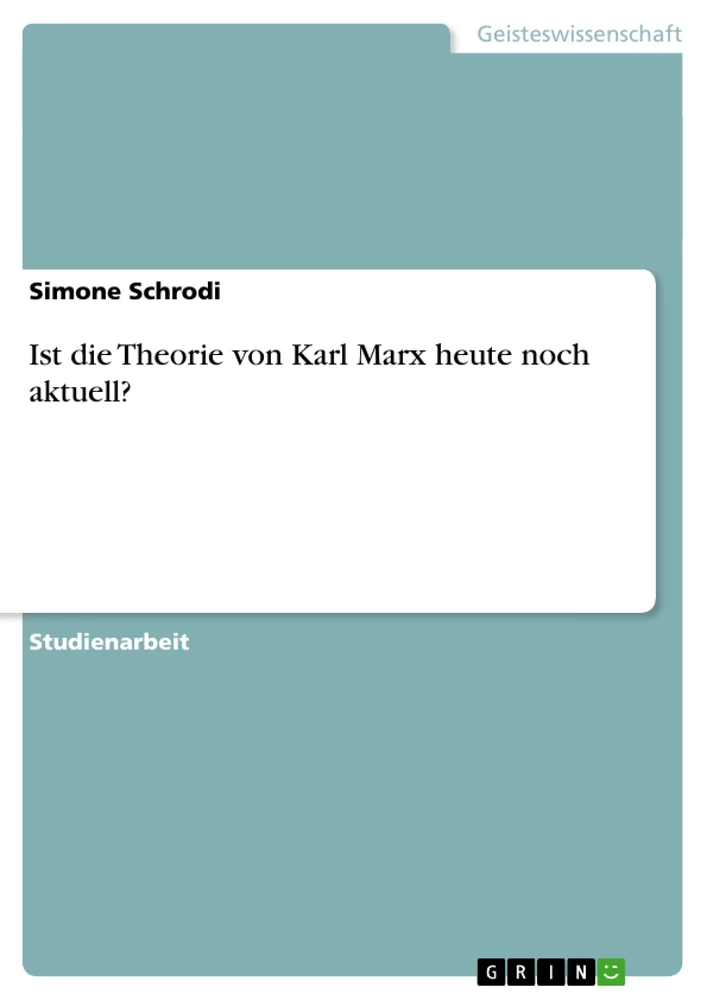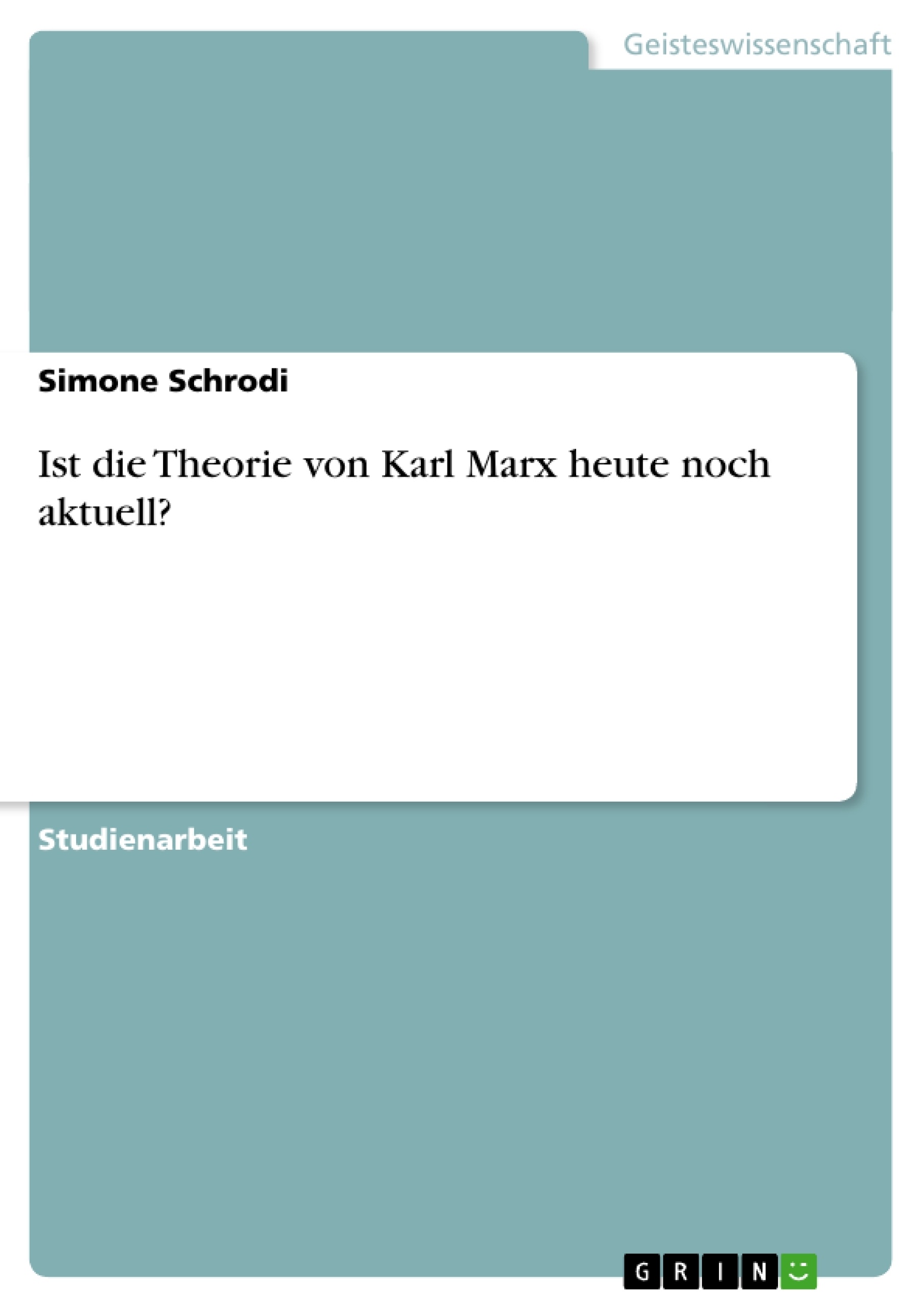Bereits vor fast 140 Jahren hat Karl Marx sein wohl wichtigstes Werk, „Das Kapital“, geschrieben. Seit dem wurde Marx vielfach kritisiert und in Frage gestellt, heutzutage werden seine Theorien immer seltener erwähnt. In dieser Arbeit soll nun erörtert werden, ob die Thesen von Marx in der heutigen Zeit überholt sind oder ob sie noch Realitätsbezug haben. Dafür sollen zunächst einmal Teile des Produktions- und Zirkulationsprozesses des Kapitals sowie des Gesamtprozesses der kapitalistischen Produktion skizziert werden, die Schwerpunkte liegen hier vor allem auf dem Akkumulationsprozess des Kapitals und den daraus resultierenden ökonomischen Krisen des Kapitalismus. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich anschließend mit der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Deutschlands von Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum der von Marx prophezeite Umsturz des kapitalistischen Systems durch das Proletariat noch nicht eingetreten ist.
Gliederung
1. Einleitung
2. Ist Marx noch aktuell?
2.1 Kritik der politischen Ökonomie
2.1.1 Mehrwert und Mehrwertrate
2.1.2 Akkumulation
2.1.3 Das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation
2.1.4 Industrielle Reserve
2.1.5 Krisen
2.1.6 Historische Tendenz der kapitalistischen Akkumulation
2.2 Kritische Betrachtung der Gesellschaft
2.2.1 Die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland
2.2.2 Heutige Lage
2.2.3. Klassenbewußtsein und Klassenkampf
3. Auswertung
1. Einleitung
Bereits vor fast 140 Jahren hat Karl Marx sein wohl wichtigstes Werk, „Das Kapital“, geschrieben. Seit dem wurde Marx vielfach kritisiert und in Frage gestellt, heutzutage werden seine Theorien immer seltener erwähnt. In dieser Arbeit soll nun erörtert werden, ob die Thesen von Marx in der heutigen Zeit überholt sind oder ob sie noch Realitätsbezug haben. Dafür sollen zunächst einmal Teile des Produktions- und Zirkulationsprozesses des Kapitals sowie des Gesamtprozesses der kapitalistischen Produktion skizziert werden, die Schwerpunkte liegen hier vor allem auf dem Akkumulationsprozess des Kapitals und den daraus resultierenden ökonomischen Krisen des Kapitalismus. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich anschließend mit der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Deutschlands von Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum der von Marx prophezeite Umsturz des kapitalistischen Systems durch das Proletariat noch nicht eingetreten ist.
2. Ist Marx noch aktuell?
2.1 Kritik der politischen Ökonomie
2.1.1. Mehrwert und Mehrwertrate
Um überleben zu können, sind die Lohnarbeiter gezwungen, ihre Arbeitskraft an den Kapitalisten zu verkaufen, da sie über keine eigenen Produktionsmittel verfügen. Dabei wird die Arbeitskraft zur Ware, ihr Wert bestimmt sich über den Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel.
Für den Produktionsprozess kauft der Kapitalist mit Geld zum einen Arbeitskräfte und zum anderen Produktionsmittel (Maschinen, Werkzeuge, Rohstoffe) ein. Das Besondere am kapitalistischen Produktionsprozess ist jedoch, dass die Arbeitskraft mehr an Wert produziert als zur Erarbeitung der eigenen Erhaltungskosten erforderlich ist. Diesen Wert bezeichnet Marx als Mehrwert (MEW 23 1969: 208f.) und wenn Geld auf diese Art und Weise eingesetzt wird, dann nennt man es Kapital (ebd.: 589).
Marx unterscheidet zwischen dem absoluten Mehrwert, der aus der Verlängerung der Arbeitszeit bei gleichem Lohn resultiert und dem relativen Mehrwert, der durch die Steigerung der Produktivkraft (durch schnellere und effizientere Maschinen, Rationalisierungen, Verbesserung der Arbeitsabläufe etc.) (ebd.: 532ff) entsteht. Da sich der Arbeitstag eines Arbeiters nicht beliebig verlängern läßt, wird der meiste Mehrwert durch die Steigerung der Produktivität hervorgebracht.
Die Mehrwertrate berechnet sich aus dem Quotienten von Mehrarbeit und notwendiger Arbeit (m/v, dabei v= variables Kapital) und stellt somit ein Maß für die Ausbeutung der Arbeitskraft dar (ebd.: 232). Ausbeutung meint hier die Tatsache, dass sich der Kapitalist den Mehrwert aneignet, den der Arbeiter produziert. Um die Mehrwertrate zu steigern, gibt es zwei Möglichkeiten: Die Erste ist eine Steigerung des absoluten Mehrwerts durch Arbeitszeitverlängerungen oder Pausenkürzungen. Diese Variante wird heutzutage wieder häufig angewandt. Unter Androhung von Entlassungen werden Arbeiter und Angestellte gezwungen, für den gleichen Lohn länger zu arbeiten.
Die zweite Möglichkeit ist, wie bereits oben beschrieben, die Erhöhung des relativen Mehrwerts durch eine Steigerung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit. Wer beispielsweise über effizientere Maschinen oder neue Produktionsverfahren verfügt, kann sich dadurch Konkurrenzvorteile und damit Extra-Mehrwert und somit Extra-Profit sichern. Allerdings ist dieser Vorteil meist nicht lange von Dauer, weil andere Unternehmen bestrebt sind, ihre Produktivität ebenfalls zu steigern, um gleichermaßen in den Genuß des Extra-Profits zu kommen.
2.1.2. Akkumulation
Typisch für den Kapitalismus ist, dass der Unternehmer selbst nur einen geringen Teil des Mehrwerts für seinen Privatkonsum einbehält, um so viel davon wie möglich wieder als Kapital einsetzen, und beim nächsten Produktionsprozess einen noch höheren Mehrwert erwirtschaften zu können. Diese Rückverwandlung von Mehrwert in Kapital bezeichnet Marx als „Akkumulation“ (ebd.: 589).
Die Höhe der Akkumulationsmasse hängt von mehreren Faktoren ab: Zum einen ist natürlich die Größe des vorgeschossenen Kapitals entscheidend, denn je mehr davon eingesetzt wird, desto größer wird der Profit ausfallen[1] und desto mehr kann dann anschließend wieder akkumuliert werden. Dieser Aspekt ist nicht ganz unwichtig, da das Bestreben des Unternehmers, so viel Kapital wie möglich wieder einzusetzen, zu einer Vergrößerung der Kapitalmasse führt, was zur Folge hat, dass sich das Kapital in der Hand dieses Kapitalisten konzentriert. Marx spricht in diesem Zusammenhang von einer „Konzentration“ des Kapitals (ebd.: 653). Je mehr Kapital akkumuliert werden kann, in desto größerem Umfang kann die Produktivkraft erhöht werden, was sich wiederum positiv auf den Gewinn auswirkt und so weiter.
Die zweite Möglichkeit, den Umfang des eingesetzten Kapitals zu vergrößern, besteht in der Aneignung der Kapitale anderer Unternehmen, was Marx als „Zentralisation“ des Kapitals bezeichnet (ebd.: 654). Dies kann entweder gewaltsam durch Geschäftsübernahmen geschehen oder auf freiwilliger Basis, beispielsweise durch die Bildung von Aktiengesellschaften. Hier wird das Geld mehrerer Kleinaktionäre als Kapital eingesetzt und gewinnbringend verwertet.
Analysiert man die heutige Wirtschaft, lassen sich sowohl Konzentration als auch Zentralisation des Kapitals nachweisen: viele Unternehmen können dem Konkurrenzdruck des Kapitalismus nicht standhalten und gehen entweder in Konkurs oder werden von größeren Firmen aufgekauft. Aktuelle Beispiele dafür sind die Übernahme des Mineralölkonzerns „DEA“ von „Shell“ oder der kürzliche Konkurs der Firma „Walter-Bau“. Unbestritten ist auch die Existenz riesiger Konzerne, die fast Monopolcharakter haben und inzwischen die Märkte der gesamten Welt beherrschen, als Beispiele dienen hierfür „Siemens“ oder „DaimlerChrysler“.
2.1.3. Das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation
Die stetigen Produktivitätssteigerungen bleiben allerdings nicht ohne Folgen. Wenn es mehr Maschinen gibt, die schneller und effektiver produzieren können, erhöht sich das Verhältnis vom Wert der Produktionsmittel zum Wert der Arbeitskraft deutlich, Marx bezeichnet dies als „organisches Kapital“ (ebd.: 665). Zum Beispiel verbraucht nach einer Produktivitätssteigerung die Hälfte der Arbeiter das doppelte an Produktionsmitteln, also wächst der Teil des Kapitals, der für Arbeitskräfte ausgegeben wird, langsamer, als der Teil, der für Produktionsmittel eingesetzt wird. „Gesamtgesellschaftlich gesehen: das Kapital zieht also relativ – das bedeutet: im Verhältnis zu seinem Gesamtumfang – eine immer geringere Anzahl zusätzlicher Arbeitskräfte an.“ (Eckert 1980: 162) Außerdem bedeutet jede Steigerung der Produktivität eine Verschärfung der Ausbeutung und damit eine Verschlechterung der Lage der Arbeiter im Verhältnis zum gesellschaftlichen Reichtum. Letzteres hat Marx „Das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation“ genannt und folgendermaßen formuliert: „Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft wird durch die selben Ursachen entwickelt wie die Expansivkraft des Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums. Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschicht der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus.“ (MEW 23 1969: 673f.) Als Beleg dafür dient eine Meldung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das für die gesamte Bundesrepublik einen Anstieg der Arbeitslosenquote von 10,5 % (1992) auf 13,0 % (2000)[2] verzeichnete.
[...]
[1] Deshalb ist auch entscheidend, wie groß der Teil des Mehrwerts ist, den der Kapitalist für seine Revenue einbehält, denn dementsprechend weniger kann wieder in Kapital verwandelt werden und so fällt folgerichtig auch weniger Profit ab.
[2] Als arm gilt hier, wer weniger als 50% des gesamtdeutschen Mittelwerts des jährlichen Äquivalenzeinkommens zur Verfügung hat