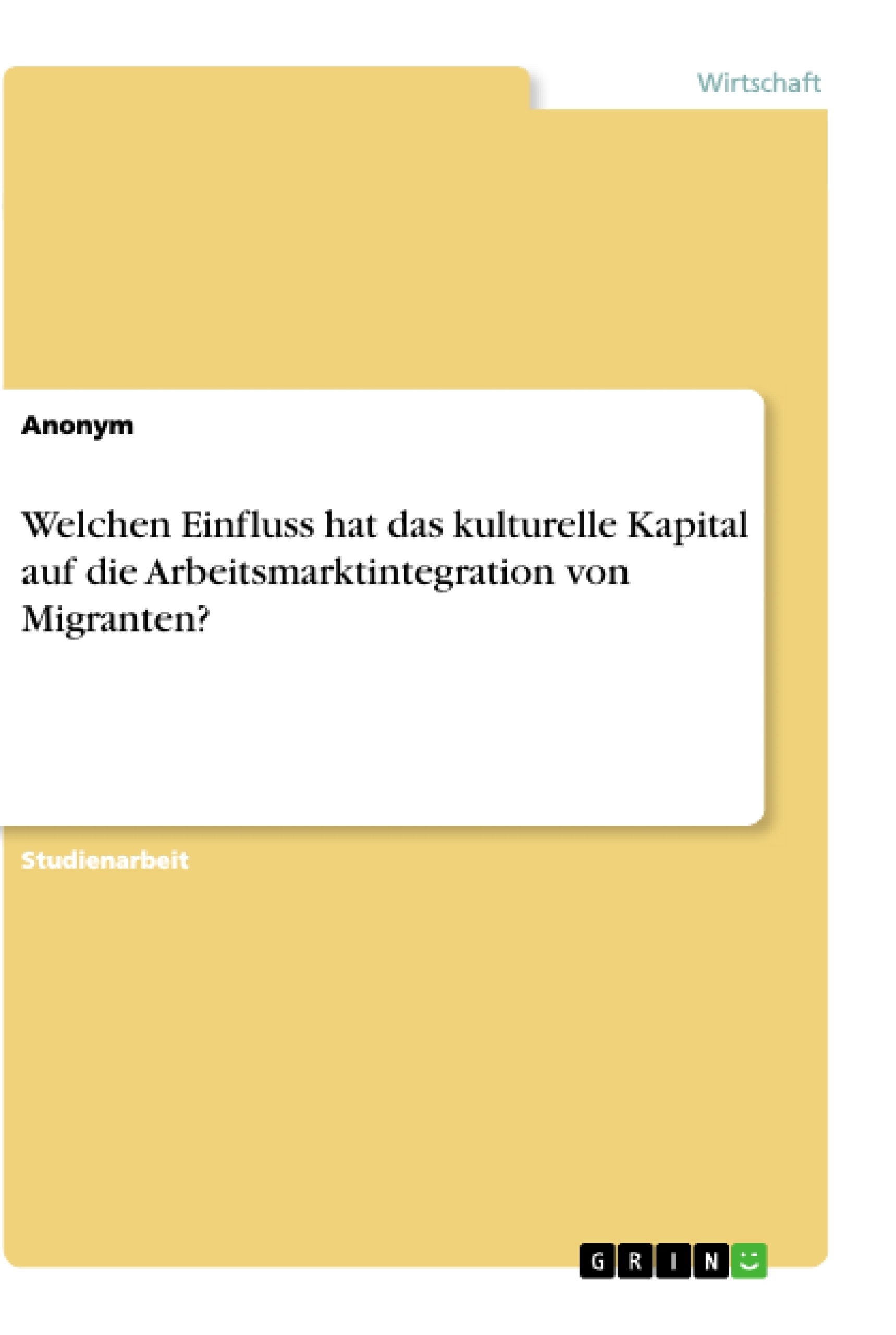Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, in welcher Beziehung das kulturelle Kapital von Migranten mit deren Integration am Arbeitsmarkt steht. Um dies zu beantworten wird zunächst der Begriff des kulturellen Kapitals definiert, dann wird vorgestellt wie ein Kind durch seinen sozialen Kontext, der anhand des kulturellen Kapital bestimmt wird, beeinflusst wird und anschließend werden Daten zur aktuellen Situation von Migranten am Arbeitsmarkt herangeführt. Im Fazit wird schließlich geklärt welchen Einfluss somit das kulturelle Kapital auf die Arbeitsmarktintegration von Migranten hat.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt im Jahre 2011 die Gesamtbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland bei 81,8 Millionen, wobei der Anteil der Migranten bei knappen 20 Prozent liegt. Mit diesem Begriff sind hier Personen gemeint, die seit 1950 in die Bundesrepublik zugewandert sind und deren Nachkommen. Die Zahl der Erwerbspersonen beträgt ca. 42 Millionen, darunter befinden sich 34 Millionen Personen ohne und acht Millionen Personen mit Migrationshintergrund.
Der Anteil der Erwerbslosen ohne Migrationshintergrund liegt bei ungefähr fünf Prozent, der der Migranten dagegen ist er fast doppelt so hoch. Daraus lässt sich schließen, dass die Integration von Migranten am Arbeitsplatz also noch nicht im ausreichendem Maße gelungen ist und das, obwohl sie politisch beabsichtigt ist.
Welchen Einfluss hat das kulturelle Kapital auf die Arbeitsmarktintegration von Migranten?
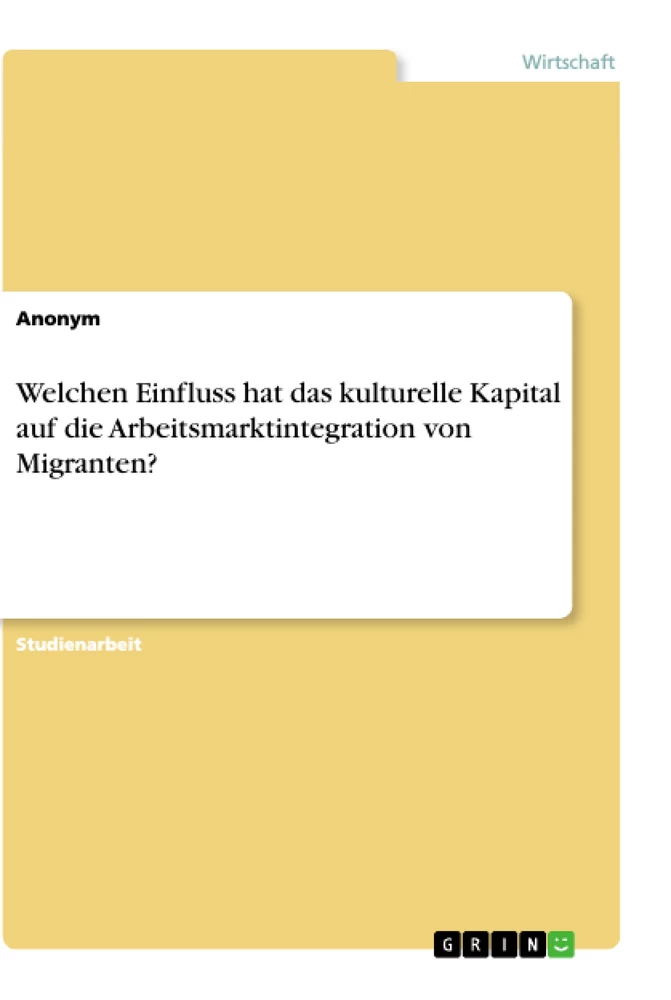
Hausarbeit , 2014 , 9 Seiten , Note: 2,0
Leseprobe & Details Blick ins Buch