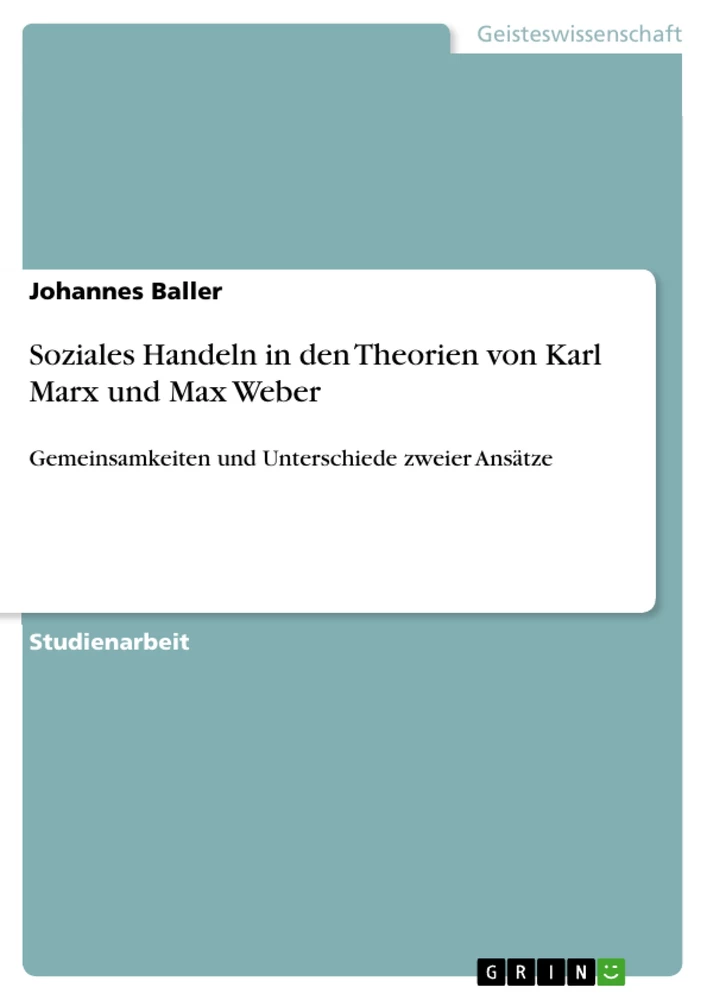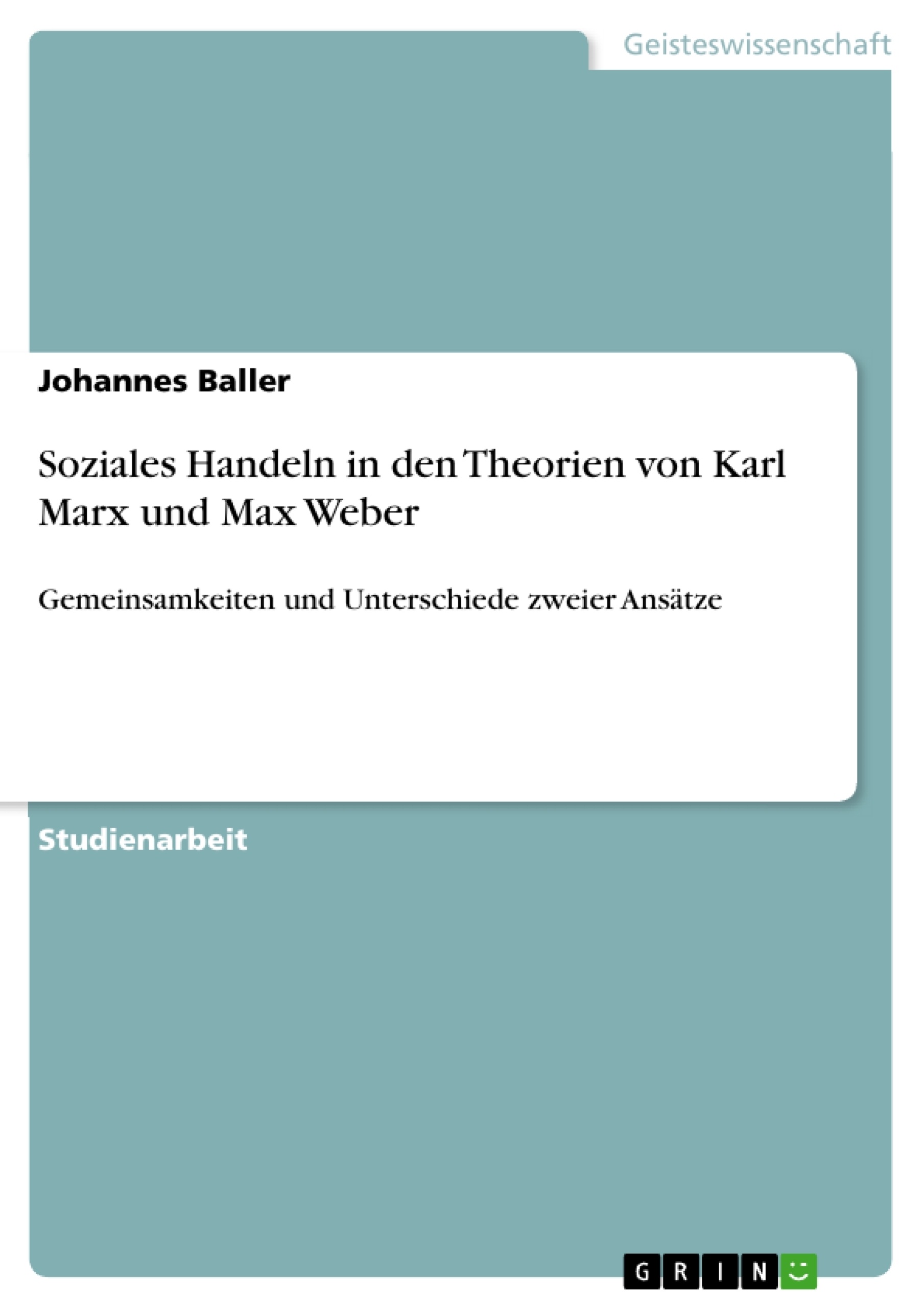In der vorliegenden Hausarbeit werden die wissenschaftlich Ansätze der bedeutenden Vertreter der Soziologie Max Weber und Karl Marx zum sozialen Handeln verglichen. Als Grundlage dafür werden die Texte „Wirtschaft und Gesellschaft“, 1922 von Max Weber (1864-1920) sowie „Die Deutsche Ideologie“, 1846 und „Das Kommunistische Manifest“ 1848 von Karl Marx (1818-1883) unterstützt von Friedrich Engels (1820-1895) dienen.
Karl Marx sieht die Gesellschaft als ein Ergebnis der Wechselwirkung der Individuen mit der Natur. Er vertrat das Basis/ Überbaumodell. Gesellschaftliche Institutionen wie der Staat oder die Justiz sind nur der Überbau einer tiefer liegenden Basis von Klassen- und Herrschaftsverhältnissen. Die Methode bei Karl Marx ist eine Dialektische auf historisch materialistischer Grundlage. Die Geschichte der Menschheit ist ein langer Klassenkampf, der durch die Entwicklung der Produktivkräfte und der damit zusammenhängenden zunehmenden Ausbeutung der Nichteigentümer immer neu entfacht wird.
Max Weber stellt das Individuum als kulturell vernünftig handelnden Willensmenschen in Anlehnung an den Neukantianismus dar und schließt somit an die Vernunftphilosophie eines Subjekts von Immanuel Kant an, das in seiner vernünftigen Urteilskraft nur sich selbst unterworfen ist. Zur Analyse und zum Verstehen sozialer Phänomene, die Weber auf das individuelle Verhalten einzelner Individuen zurückführte, entwickelte Max Weber als Methode den Idealtypischen Ansatz der trennscharfen Begriffsdefinitionen von sozialem Handeln.
Um beide Ansätze zu vergleichen, soll mit einem kurzen Abriss der Biografie von Karl Marx seine Theorie zum sozialen Handeln skizziert werden. Anschließend wird ein kurzer Einblick in die Lebensgeschichte von Max Weber gegeben, um hinterher seine Theorie zum sozialen Handeln darzulegen. Abschließend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Theorien aufgezeigt.
Gliederung
1. Einleitung
2. Biographisches zu Karl Marx
3. Die Theorie des sozialen Handelns von Karl Marx
4. Biographisches zu Max Weber
5. Die Theorie des sozialen Handelns von Max Weber
6. Fazit
07. Abstract