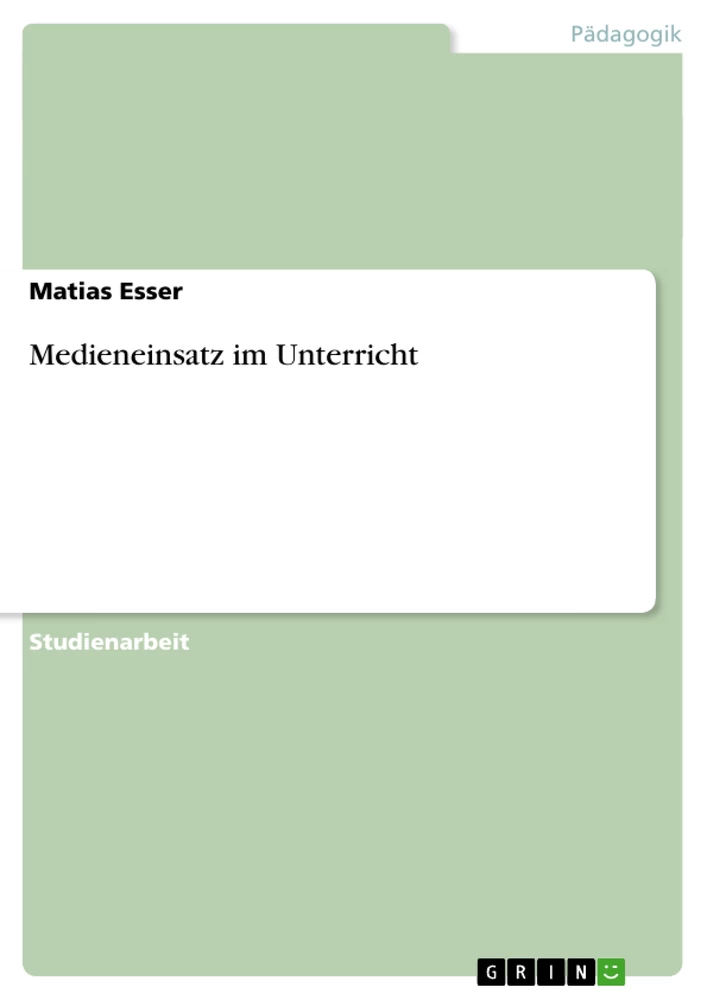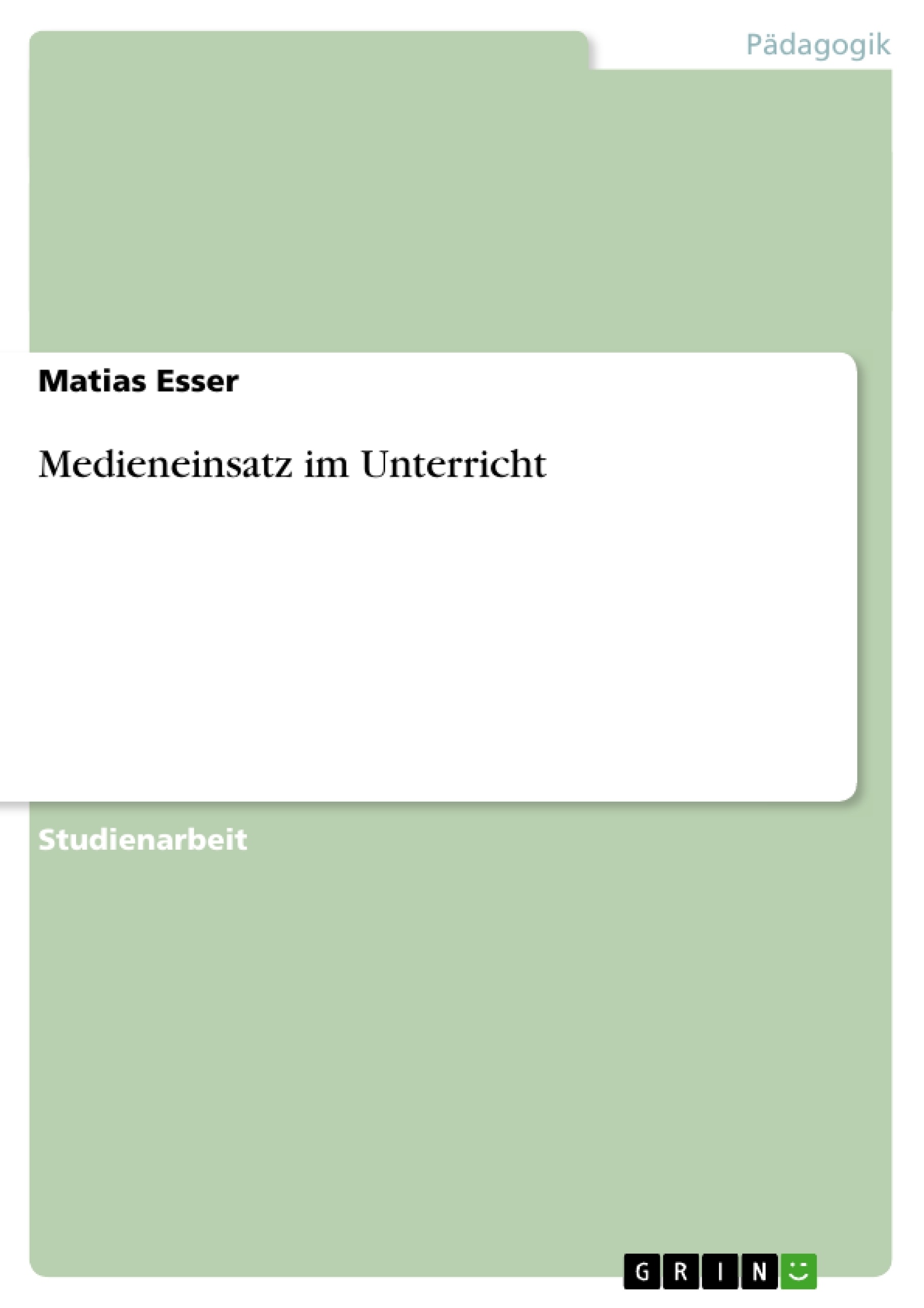„Medien sind imstande unsere didaktische Konzeption von Grund auf zu verändern [...].
Das ist der Anfang vom Ende einer alten Didaktik.“
(HEIMANN 1962/1976,S. 133)
Diese Ausarbeitung setzt sich mit dem komplexen Thema "Medieneinsatz im Unterricht" auseinander. In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich die Struktur der Medienwelt grundlegend verändert und unterliegt mittlerweile einem stetigen Innovationsprozess, dessen Ende und Entwicklung nur schwer absehbar sind. Dies hat Auswirkung auch auf die Unterrichtsgestaltung in der Schule. Bedingt ist das vor allem durch die sogenannten Neuen (computerbasierten) Medien. Traditionelle Medien wie Folien, Tafel, Kreide werden zunehmend von technischen Medien rund um den Computer verdrängt. Daher sollen diese "konservativen" Medien in dieser Arbeit nicht ausführlicher, als für Vergleiche notwendig, vorgestellt werden. Im Gegensatz dazu werden vornehmlich die Neuen Medien und deren Verwendung im Unterricht behandelt. Aus diesem Dualismus ergibt sich, dass nicht lediglich die Klassifikation, sondern auch die Verwendung von Neuen Medien an sich unter neuen Gesichtspunkten analysiert werden muss.
Dies lässt folgende Fragestellungen in den Vordergrund treten:
Nach welchen Kriterien unterscheidet man Arten von Medien und was sind überhaupt "neue" oder "alte" Medien?
Wie stellt sich das Angebot von bestimmten Arten der Neuen Medien dar und wie werden diese untereinander klassifiziert?
Welche Vor- und Nachteile bieten die computerbasierten Medien im Vergleich zu herkömmlichen Medien für den Schulunterricht?
Wie kann der Einsatz solcher Medien in der Praxis aussehen?
Hier findet sich der Schwerpunkt dieser Arbeit, diese Fragen werden nach einer Begriffsbestimmung unter pädagogischen Gesichtspunkten beantwortet, zum Ende der Ausführungen wird ein praxisbezogener Unterrichtsentwurf beispielhaft und grob skizziert.
Einleitung
Diese Ausarbeitung setzt sich mit dem komplexen Thema „Medieneinsatz im Unterricht“ auseinander. In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich die Struktur der Medienwelt grundlegend verändert und unterliegt mittlerweile einem stetigen Innovationsprozess, dessen Ende und Entwicklung nur schwer absehbar sind. Dies hat Auswirkung auch auf die Unterrichtsgestaltung in der Schule. Bedingt ist dies vor allem durch die sogenannten Neuen (computerbasierten) Medien. Traditionelle Medien wie Folien, Tafel, Kreide werden zunehmend von technischen Medien rund um den Computer verdrängt. Daher sollen diese „konservativen“ Medien in dieser Arbeit nicht ausführlicher, als für Vergleiche notwendig, vorgestellt werden. Im Gegensatz dazu sollen vornehmlich die Neuen Medien und deren Verwendung im Unterricht behandelt werden. Daraus ergibt sich, dass nicht lediglich die Klassifikation, auch die Verwendung von Neuen Medien an sich unter neuen Gesichtspunkten analysiert werden muss.
Dies lässt folgende Fragestellungen in den Vordergrund treten:
Nach welchen Kriterien unterscheidet man Arten von Medien?
Welche sind „alte“ oder „neue“ Medien?
Wie stellt sich das Angebot von bestimmten Arten der Neuen Medien dar und wie werden
diese untereinander klassifiziert?
Welche Vor- und Nachteile bieten die computerbasierten Medien im Vergleich zu herkömmlichen Medien für den Schulunterricht?
Wie kann der Einsatz solcher Medien in der Praxis aussehen?
Daher soll sich hier der Schwerpunkt dieser Arbeit wiederfinden, und diese Fragen werden nach einer Begriffsbestimmung unter pädagogischen Gesichtspunkten beantwortet, zum Ende der Ausführungen wird ein praxis-bezogener Unterrichtsentwurf beispielhaft und grob skizziert.
1. Der Medienbegriff
Auf den ersten Blick erscheint jedem der Begriff Medien verständlich, nahezu jeder weiß, sich etwas darunter vorzustellen.
Ganz so einfach ist es, unter pädagogischen Gesichtspunkten, jedoch nicht. In der Pädagogik ist der Begriff Medien erst seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts zu finden. Es gibt in der geschichtlichen Entwicklung des Medienbegriffs zwei bedeutende Wandlungen. Die erste hat in den 1960er/1970er Jahren stattgefunden. Durch Verfeinerungen der Technik standen binnen kurzer Zeit viele Medien wie Tonträger, Videos, Filme und Schulfernsehen für den Unterricht zur Verfügung. Die zweite Trendwende vollzieht sich derzeit. Durch die Mikrotechnologie stehen mittlerweile Computer und somit das Internet, verschiedene Lernsoftware für den schulischen Gebrauch zur Verfügung. Und diese Technologie befindet sich immer noch in einer stetigen Weiterentwicklung. Nach Tulodziecki kann ein Medium als „ein funktionales Element in der Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt“[1] beschrieben werden. Dies ist allerdings ein sehr weitreichender Begriff, welcher im Unterricht selbst die Schultafel und Kreide als Medien erscheinen lässt. Für den Betrachter scheint es offensichtlich, dass hier genauere Begriffsbestimmungen nötig sind, um eine einheitliche Verständigung möglich zu machen. Daher stellt Tulodziecki in seinen weiteren Ausführungen einen technisierteren Medienbegriff vor: „Man spricht nur dann von Medien, wenn Informationen mit Hilfe technischer Geräte gespeichert oder übertragen und in bildhafter oder symbolischer Darstellung wiedergegeben werden“[2]. Diese Formulierung entspricht schon eher dem heute allgemein verwandten Bild von Medien.
Es gibt verschiedene Arten von Medien, wie das Fernsehen (audio-visuelle Medien), die Presse (Printmedien) oder das Internet mit Text-, Bild- und Ton-Angeboten (computerbasierte Medien), um nur einige zu nennen. Diese Unterteilungen begründen sich in der Art und Weise des jeweiligen Mediums, Informationen zu übermitteln, zu speichern, etc. Um der pädagogischen Betrachtungsweise gerecht zu werden, empfiehlt sich jedoch eine andere Grundlage der Begriffsbestimmung von Medien.
Wolfgang Maier[3] unterteilt hier in drei Gruppen:
- Massenmedien wie Zeitung, Radio, Fernsehen, aber auch Bücher und CDs
- Individualmedien wie Telefon, Fax, Briefe, E-Mail sowie Fotografie und Videokamera
- Unterrichtsmedien wie Lehrfilme, Lernprogramme, Folien, für Lernzwecke gedachte Fotografien oder Tonträger
In der Auflistung Wolfgang Maiers erscheint nicht das Internet. Vielleicht sind 1998 noch nicht die Ausmaße absehbar gewesen, in denen sich das Internet ausbreiten würde und es immer noch tut. Dieses Medium ist in der heutigen Zeit auf dem besten Wege, das Medium schlechthin zu werden.
Diese Entwicklung lässt sich daran messen, dass es mittlerweile möglich ist, mit entsprechender Ausrüstung, über einen Internetanschluss zu telefonieren, und fern zu sehen. Es bieten bereits heute eine große Anzahl Internet-Radios ihr internationales Programm an. Über dies hinaus hat das Internet gegenüber den vorher genannten Medien den Vorteil des Wireless LAN (zu deutsch: kabelloses Netzwerk, Anm.d.Verf.). Das heißt, mit einem tragbaren PC (Notebook) und einem passenden Anschluss, einer Wireless LAN-Karte, ist es möglich, in naher Zukunft praktisch überall eine Verbindung zum Internet herzustellen. Heute schon gibt es in vielen Großstädten sogenannte Wireless LAN Hot-Spots. Dies sind Gebiete, meist in der Innenstadt oder auf dem Campus einer Hochschule, in denen dieser Service bereits zu Verfügung steht. Im Internet kann man ein ständig aktualisiertes Verzeichnis dieser Gebiete abrufen.[4]
1.1 Medienpädagogik
Ferner ist der Begriff Medienpädagogik näher zu erläutern. Auch diesen Begriff findet man erst seit den 60er Jahren in der pädagogischen Fachliteratur. Er wird herkömmlich als Oberbegriff für Analyse, Planung, Ausführung von Aktionen mit den Zielen Entwicklung, Gestaltung, Kritik und Anwendung im pädagogischen Bereich genutzt. Um eine Relation von praxis-orientierten Fragestellungen zur Theorie herzustellen, dient eine genauere Begriffsbestimmung, die auch im alltäglichen Gebrauch verständlich und hilfreich sein sollte.
Dieser Begriff kann in fünf Hauptfelder unterteilt werden:
- 1.1.2 Die Medienkunde. Sie befasst sich im Wesentlichen mit Wissen über Medien, theoretisch wie pragmatisch gesehen, mit technischen Aspekten.
- 1.1.3 In der Medienerziehung ist die pädagogische Zielvorstellung auf Medien selbst ausgerichtet, z.B. die Befähigung zu einem kritischen Umgang mit selbigen. Durch die Verbreitung des Internets wird der Strom an Informationen an den Endverbraucher immer stärker forciert. Daher ist ein gewissenhafter, kritischer Umgang mit Medien und deren Informationsflut heutzutage zu einer sogenannten Schlüsselqualifikation geworden. Um diese zu erfüllen, darf aber ein weiteres Element nicht zu kurz kommen:
- 1.1.4 Die Medienkompetenz. Dieser Begriff ist noch relativ jung, wird aber, wie angedeutet, in unserer „Medien- und Informationsgesellschaft“ immer wichtiger. Nach Pöttinger[5] unterteilt sich dieser Begriff wiederum in drei Felder: die Wahrnehmungskompetenz (Strukturierungs-, Interpretationsfähigkeit) Realität von Fiktionalität unterscheiden zu können, die Nutzungskompetenz (Rezeptionssteuerungsfähigkeit) und die Handlungskompetenz (Produktions-, Gestaltungs-, und Veröffentlichungsfähigkeit).
- 1.1.5Mediendidaktik In der Mediendidaktik werden Medien, die in Interaktionen zwischen Lehrendem und Schüler instruierend eingesetzt werden sollen, analysiert („ob-wie-warum-welche Medien im Unterricht eingesetzt werden“)[6]. Welche Medien welchen pädagogischen Zielen nach Eigenschaften, bei einer Zugrundelegung von didaktischen Komponenten, zugeordnet werden können, ist in der Mediendidaktik die Leitfrage.
- 1.1.6 Mediendidaktische Kompetenz (nach W.Maier)[7]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Technische Kompetenzen sind unerlässlich, soll der Unterrichtsverlauf doch möglichst ungestört ablaufen. Pannen führen hingegen zu Unruhe in der Klasse, die Konzentration lässt nach, und die Phase der Motivation kann problematisch werden. Ferner ist eine semantische Kompetenz dringend notwendig, um objektiv ein Medium auswählen und für geeignet befinden zu können. Auch für die Gestaltung eines Mediums ist diese Kompetenz Voraussetzung.
Und letztlich hilft eine pragmatische Kompetenz sowohl bei der Produktion von Unterrichtsmedien als auch bei der Integration der Medien in den Unterricht. Es können abwechslungsreichere, individuelle Abwandlungen von vorgegebenen Medien geschaffen werden, auch können, je nach Situation und beabsichtigtem Einsatz konventionelle Medien zur Nutzung heran gezogen werden.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist auf ein ausgewogenes Zusammenwirken dieser Kompetenzen zu achten. Es erschließt sich von selbst, dass das Fehlen beziehungsweise die Unvollkommenheit auch nur einer der Komponenten zu einem unerwünschten Ergebnis führen und die gesamte Unterrichtsplanung aus dem Konzept bringen kann.
[...]
[1] Tulodziecki, „Medienerziehung im Unterricht“, Bad Heilbrunn, Klinkhardt 2. Aufl. 1992, S. 12
[2] Tulodziecki, „Medienerziehung im Unterricht“, Bad Heilbrunn, Klinkhardt 2. Aufl.1992, S. 14
[3] W. Maier, „Grundkurs Medienpädagogik Mediendidaktik“, Beltz, BELTZ-Medienpädagogik, 1998, S. 17
[4] http://mobileaccess.de/wlan/
[5] Pöttinger, „Lernziel Medienkompetenz“, 1.Auflage , KOPÄD, München, 1997, S.78
[6] Kiper, Meyer, Topsch, „Einführung in die Schulpädagogik“, 2.Aufl., Cornelsen Scriptor, Berlin, 2004, S.125
[7] W. Maier, „Grundkurs Medienpädagogik Mediendidaktik“, BELTZ-Medienpädagogik, Beltz, 1998, S. 28