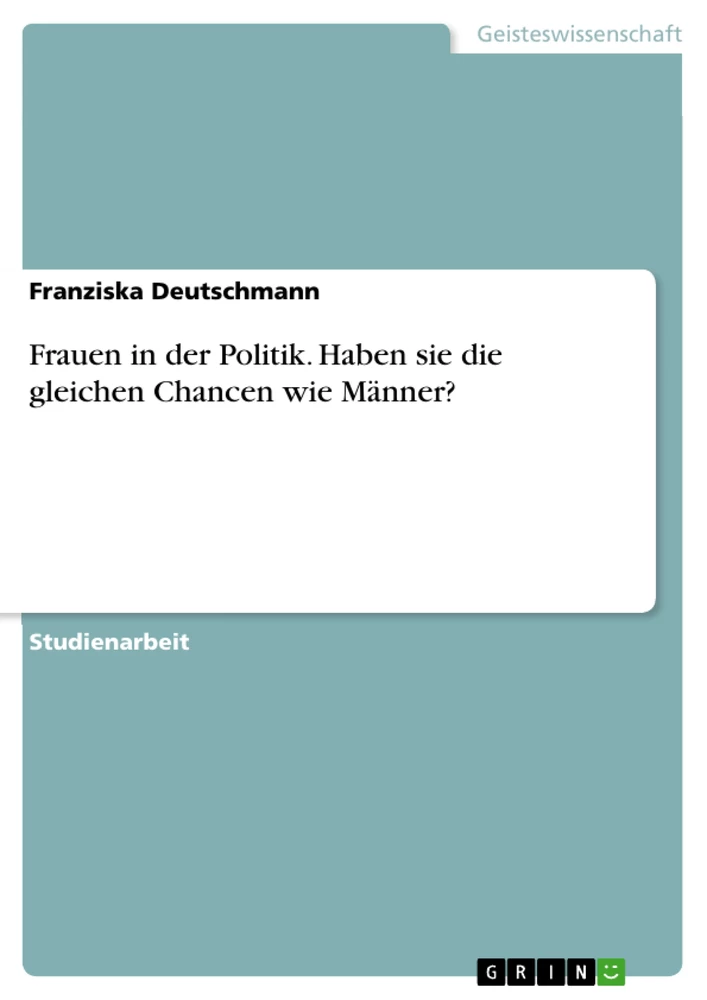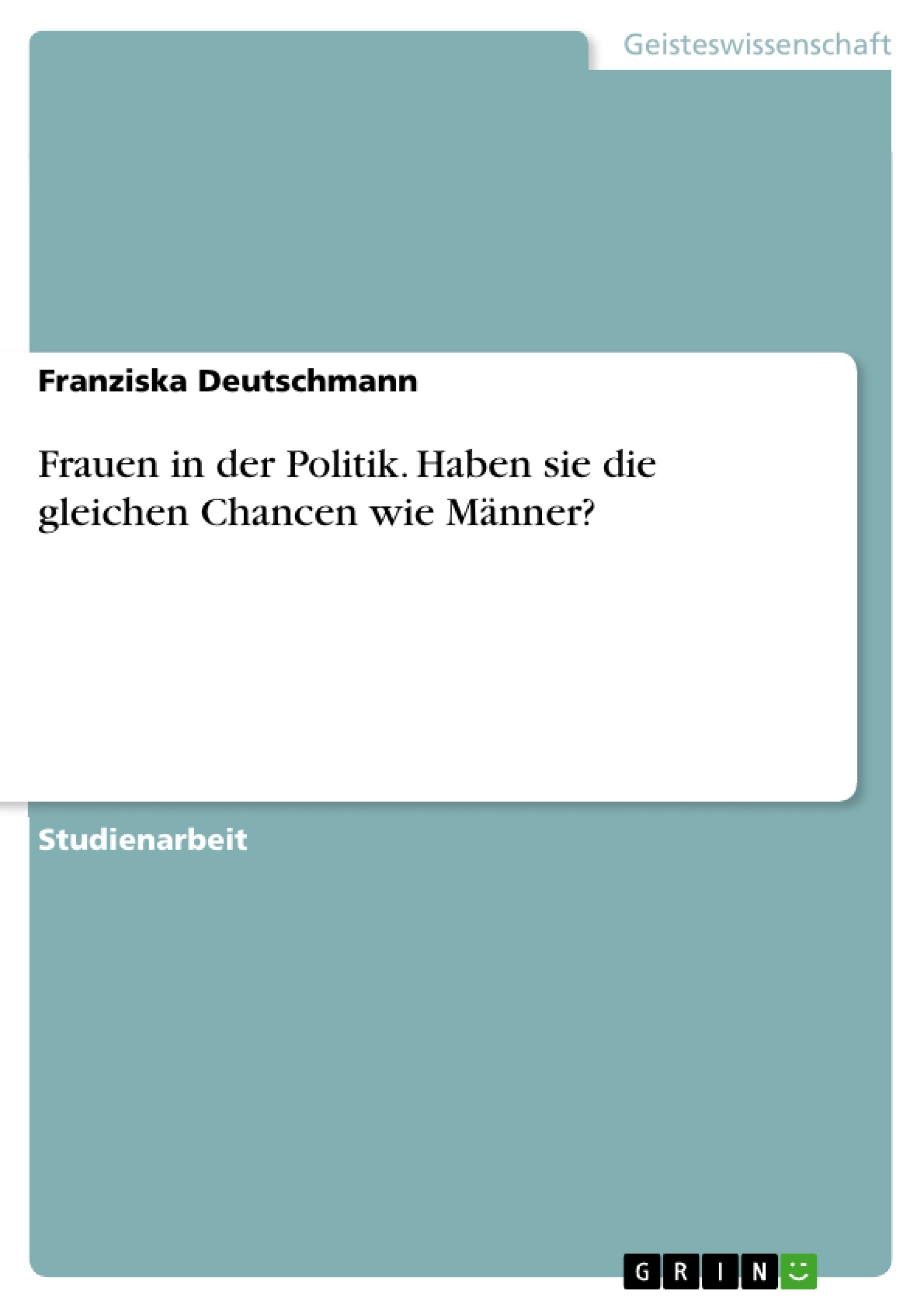Die Partizipation der Frauen in der Politik beginnt mit dem aktiven Wahlrecht. Im Januar 1919 durften Frauen in Deutschland das erste Mal wählen und beteiligten sich wider Erwarten mit 82,3%. Die Wahlbeteiligung der Frauen hat sich seitdem immer mehr an die der Männer angenähert und betrug 2005 und 2009 nur noch 0,4% beziehungsweise 0,8% weniger (Looman 2011). Dass Frauen in fast gleichem Maße von ihrem aktiven Wahlrecht gebrauch machen wie Männer, zeigt dass sie sich politisch interessieren und einbringen wollen. Dazu gehört auch die Nutzung des passiven Wahlrechts (Looman 2011). Als die ersten Frauen in die Politik gehen, treffen sie dort lange gewachsene männliche Strukturen und Netzwerke. Dort wirken sie wie Fremdkörper, die sich in den männlichen Institutionen zurechtfinden müssen.
Dass es heutzutage immer noch weniger Frauen als Männer in der Politik gibt, ist unangezweifelt. Warum die Hürde in die Politik für Frauen auch jetzt noch höher ist als für Männer , ob sie ihre Interessen nicht durchsetzen können, wollen oder gar daran gehindert werden, soll in dieser Arbeit untersucht werden. Im ersten Abschnitt wird die Darstellung von Politikerinnen in den Medien und der zwischenmenschliche Umgang im Arbeitsfeld erforscht. Dabei wird deutlich, dass Politikerinnen überdurchschnittlich oft über ihr Äußeres definiert werden. Dies ist gerade im Berufsfeld der Politik, in dem Autorität und Ansehen unabkömmlich sind, eine große Belastung. Im nächsten Abschnitt dieser Arbeit werden die einzelnen Kriterien durchleuchtet, die für Erfolg oder Misserfolg von Politikerinnen entscheidend sind. Dazu zählt zunächst die Entscheidung, für welche Partei man als Frau eintreten möchte. Warum gibt es große Unterschiede zwischen linkem und bürgerlichem Spektrum in der Parteilandschaft? Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Erfolg von Frauen ist die Politikebene. Je nach Größe und Einfluss des Parlaments variiert der Frauenanteil. Warum dies so ist, wird im Abschnitt 3.2 durchleuchtet. Auch das Wahlsystem spielt bei einem gleichen Anteil von Frauen und Männern in Parlamenten eine entscheidende Rolle. All diese Faktoren sind maßgeblich daran beteiligt, ob eine Politikerin gewählt wird, oder nicht. Dabei ist die Frage, ob sie eine gute Politik macht nicht unbedingt vorrangig.
Im Fazit wird schließlich erläutert, warum Frauen für die Politik wichtig sind und wie eine Gleichberechtigung erreicht werden könnte.
Inhalt
1. Einleitung
2. Umgang mit und Darstellung von Frauen in der Politik
3. Kriterien für die Erfolge von Frauen in der Politik
3.1 Parteien
3.2 Politikebene
3.3 Wahlsysteme
4. Fazit