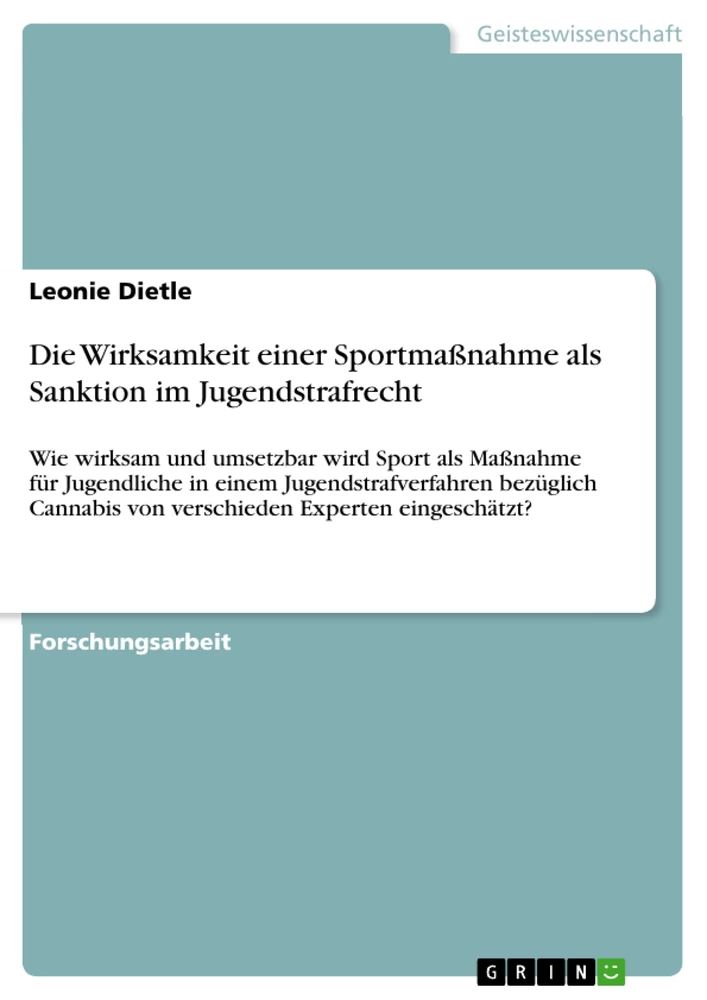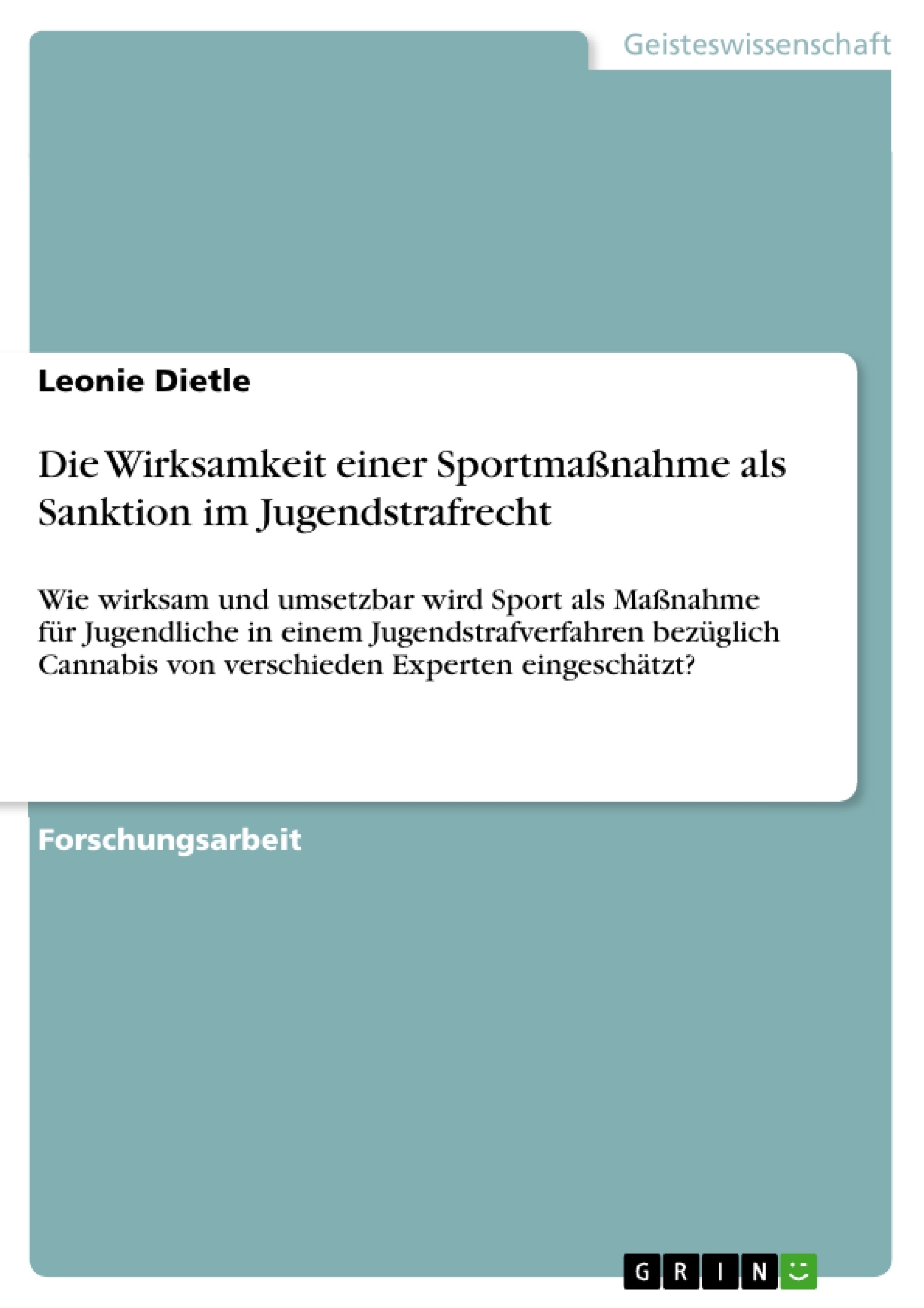Viele Klienten der Jugendgerichtshilfe, welche Berührungspunkte mit Cannabis haben, haben ihre Freizeitbeschäftigung – besonders regelmäßige, sportliche Freizeitangebote – aufgegeben bzw. haben keine und besitzen häufig eine kaum strukturierte Freizeit. Des Öfteren zeigen diese auch eine besondere Lethargie und Gleichgültigkeit. Dies sind unter Anderem erste negative Auswirkungen von Cannabiskonsum im Jugendalter, die in Kapitel 2.1. ausführlicher dargestellt sind. In Suchtkliniken ist Bewegung und Sport wichtiger Bestandteil der Therapie. Der Sport soll neben vielen weiteren Effekten den Aktivitätenaufbau fördern. Dadurch entwickelte die Verfasserin die Hypothese, dass durch die körperliche Aktivierung – in Form von Sport – den negativen Auswirkungen des Cannabiskonsums und dadurch der Entwicklung einer Sucht präventiv entgegengewirkt werden können. Des Weiteren kann durch eine verbindliche Maßnahme im Jugendstrafverfahren das Vollziehen der konstituierten Freizeitgestaltung bis hin zur eigenmotivierten Aufnahme einer strukturierten Freizeitaktivität als nachhaltiges Ziel besser verfolgt werden. Diese Hypothese soll nun in der vorliegenden Forschungsarbeit mit dem Thema „Wie wirksam wird Sport als Maßnahme in einem Jugendstrafverfahren bezüglich Cannabis von verschiedenen Experten eingeschätzt?“ theoretisch erörtert werden. Dazu hat die Verfasserin auf Basis des qualitativen Forschungsdesigns Interviews mit verschiedenen am Thema beteiligten Experten geführt und ausgewertet. Zu Beginn der Arbeit werden relevante Grundkenntnisse zum Thema und im anschließenden Gliederungsabschnitt das Forschungsdesign mit dem methodischen Vorgehen dargestellt. Unter viertens werden die Ergebnisse der Datenauswertung vorgestellt, die Forschungsfrage beantwortet, ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.
Diese Forschungsarbeit stützt sich nicht ausschließlich auf Literaturrecherchen, sondern auch auf eigenen Erfahrungen aus der praktischen Arbeit als Jugendgerichtshilfe, sowie den geführten Interviews, welche sich mit Interviewleitfäden und Transkripten im Anhang befinden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen der Thematik
2.1 Erziehung statt Strafe
2.2 Grundlagen von Cannabis und die strafrechtliche Handhabung
2.3 Die Rolle des Sportes in Suchtbehandlung und -prävention
3. Forschungsdesign
3.1 Datenerhebung
3.2 Datenaufbereitung
3.3 Datenauswertung
4. Ergebnisse
5. Beantwortung der Forschungsfrage
6. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang