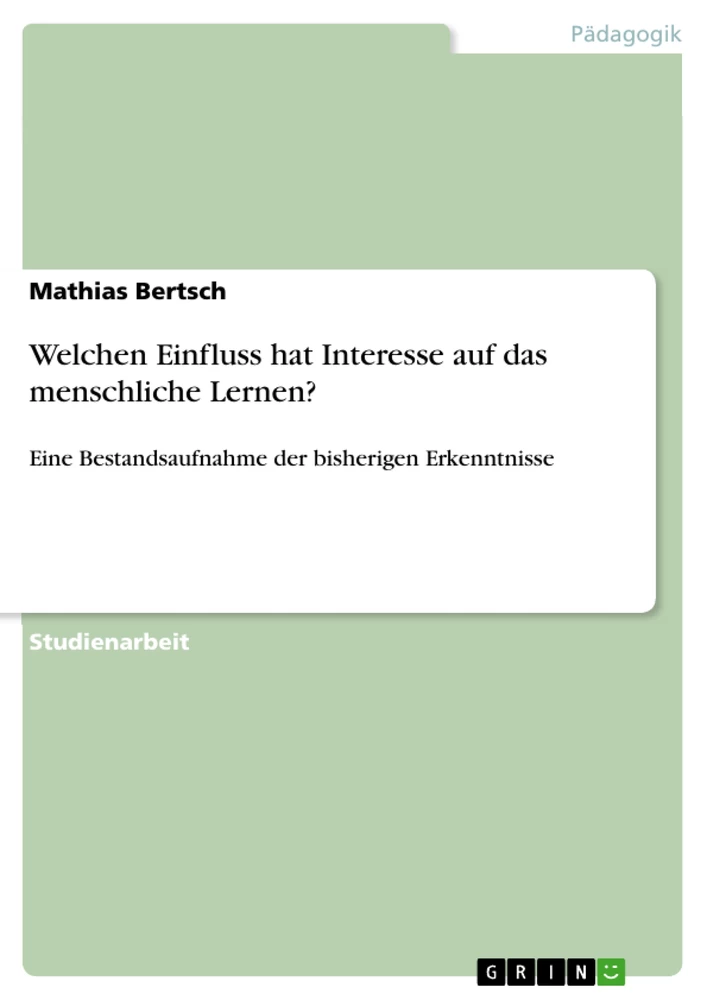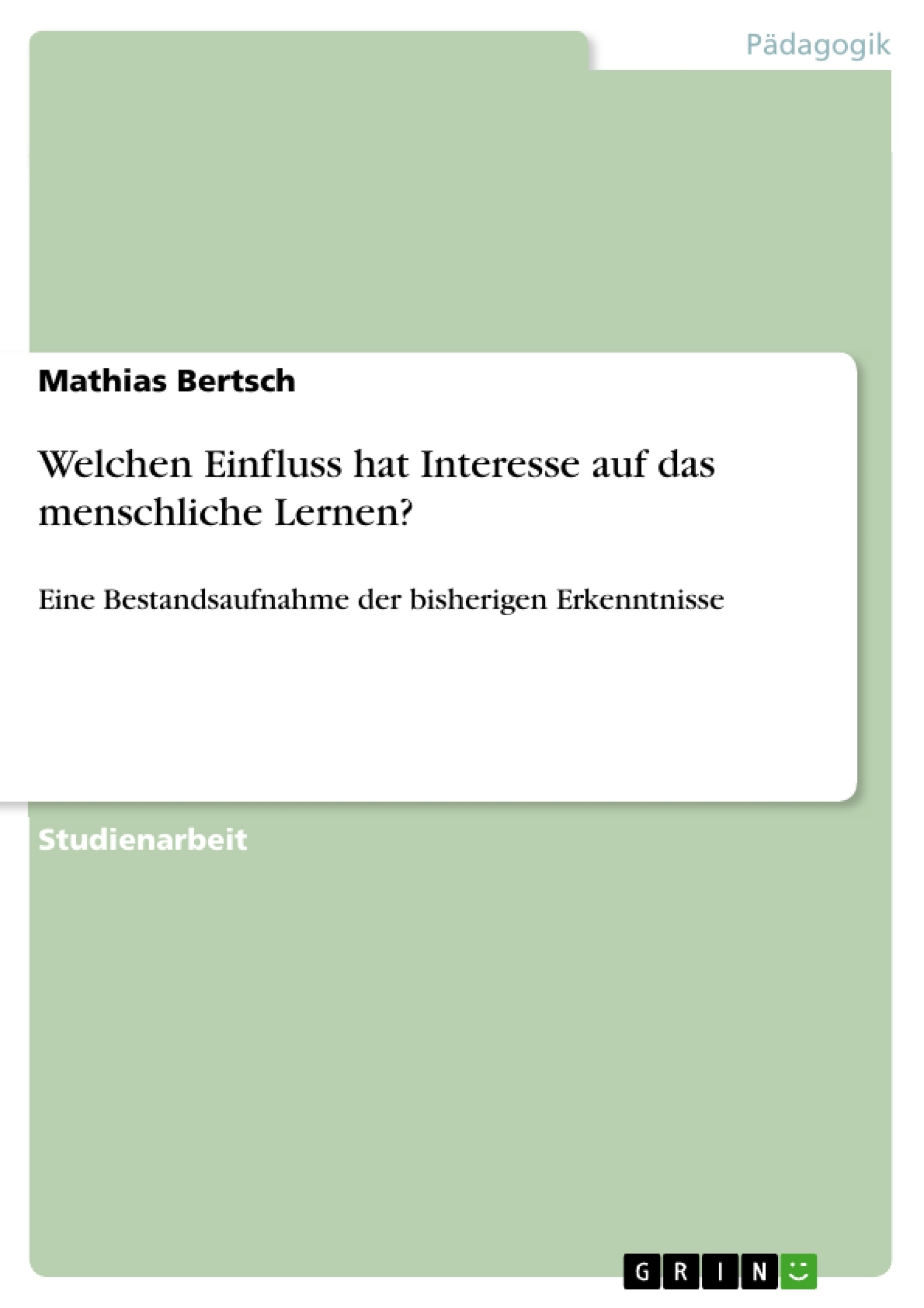In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie bisher existierende Theorien das Zustandekommen von Interesse erklären und was für einen Einfluss das Interesse auf das menschliche Lernen hat. Dabei soll auch auf die Konsequenzen für den praktischen Unterricht bzw. das praktische Lernen eingegangen werden.
Die Bedeutung von Interessen für das schulische Lernen ist ein altes Thema der pädagogischen Psychologie. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte sich eine empirisch-pädagogische Forschung, die sich mit dem Thema Interesse, Lernen und Leistung auseinander setzte. Jedoch gelang es der frühen Interessenforschung nicht, den vielfältigen alltagssprachlichen Interessenbegriff durch wissenschaftliche Kategorien zu ersetzen.
Deshalb verzichtete man in der Psychologie des Lehrens und Lernens immer häufiger auf den Interessenbegriff und verwendete statt dessen andere, nämlich motivationale bzw. emotionale Konzepte, um einzelne Aspekte des Lerngeschehens präziser erfassen zu können. Erst seit Mitte der achtziger Jahre ist ein Aufschwung der pädagogisch-psychologischen Interessenforschung zu verzeichnen, da auch die motivationalen Konzepte nicht alle Aspekte des Lernens ausreichend erklären konnten.
Es besteht weitgehend Konsens darüber, dass Interessen eine zentrale motivationale Komponente im schulischen Lehr-/Lerngeschehen darstellen. Auch wird konstatiert, dass fachliche Interessen für die Vorhersage und Erklärung von Leistungsunterschieden in Schule und Studium einen signifikanten Beitrag liefern. Außerdem werden Interessen im Zusammenhang mit der Schule deshalb positiv eingeschätzt, weil sie einen leistungsfördernden Einfluss haben. In dieser Arbeit geht es deshalb um die positive Auswirkung von Interesse auf das Lernen und um das wünschenswerte Resultat Interesse durch das Lernen.
Gliederung
1. Problemstellung
1.1 Interessenbegriff
1.2 Fragestellung
2. Person-Gegenstands-Theorien
2.1 Ein Rahmenkonzept intrinsischer Motivation
2.2 Modell der Wirkungsweise von Interesse
3. Äußere Einflussfaktoren der Interessengenese
3.1 Situationales Interesse
3.2 Mögliche Formen der Entstehung situationalen Interesses
4. Einfluss des Interesses auf Lernen und Leistung
4.1 Zusammenhang zwischen individuellen Interessen und bewerteter Leistung
4.2 Zusammenhang von individuellem Interesse und Wissensstruktur
4.3 Einfluss situationaler Interessen auf die schulische Leistung
4.4 Einfluss situationaler Interessen auf die Wissensstruktur
5. Folgerungen für das praktische Lernen
6. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis