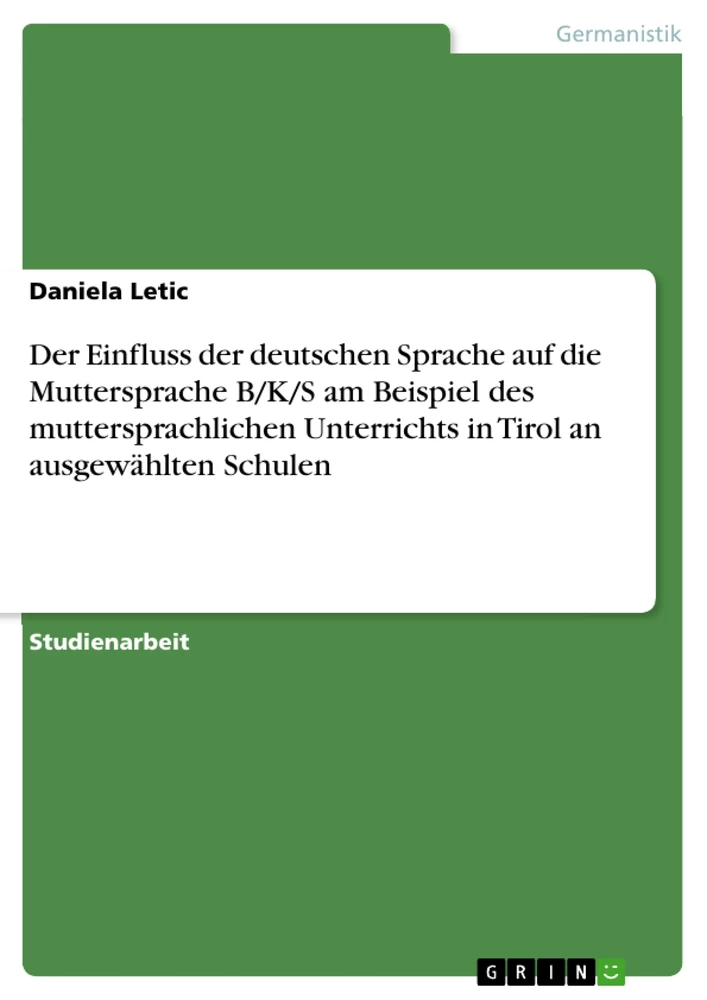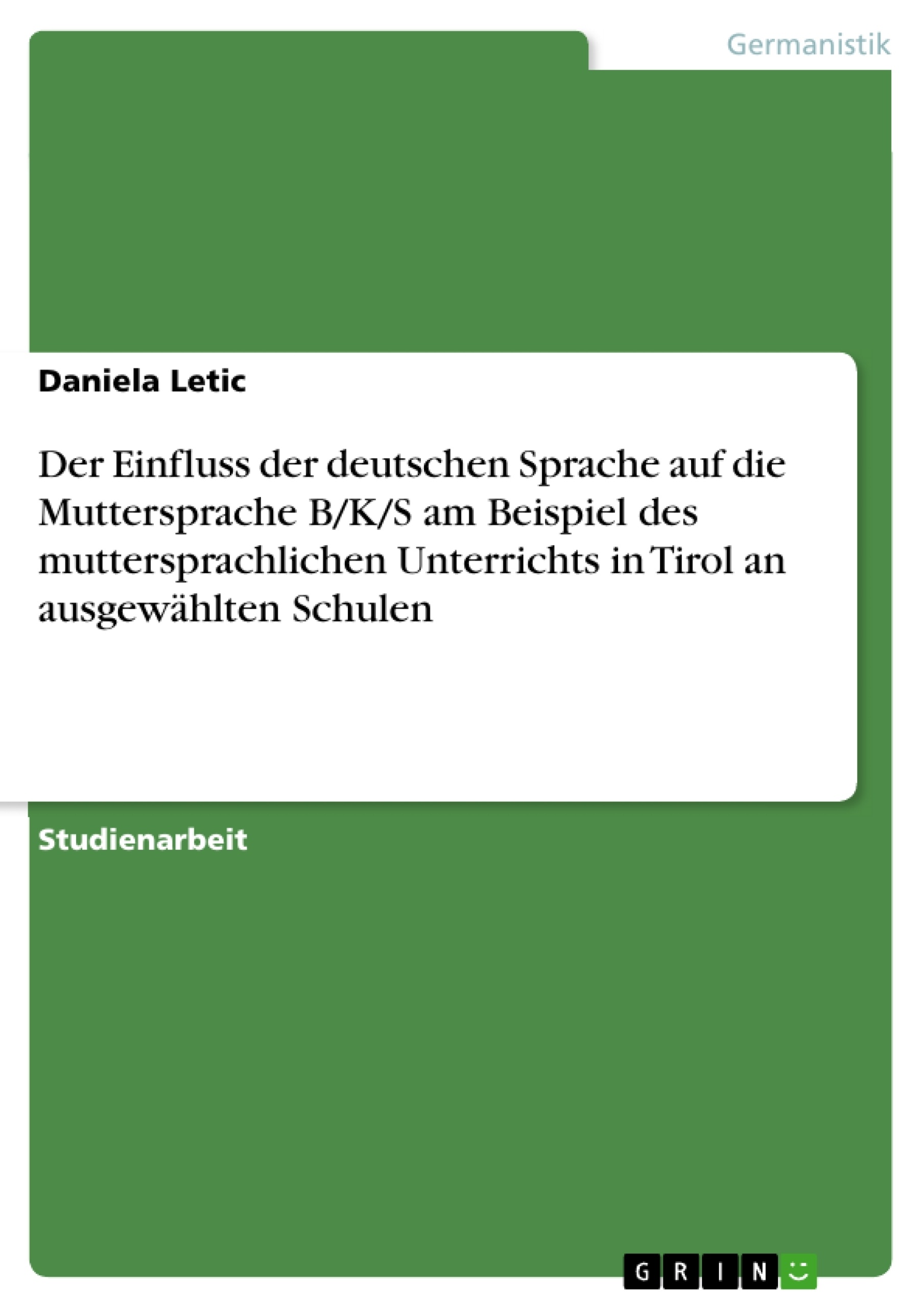Im Rahmen dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden ob und wie sich der Einfluss der deutschen Sprache bei Kindern, die den muttersprachlichen Unterricht an aus-gewählten Schulen in Tirol, zeigt. Anfänglich soll der Begriff der Bilingualität und seinen Hürden geklärt werden.
In weiterer Folge soll ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand des Einflusses der deutschen Sprache diskutiert werden. Im letzten Teil der Arbeit, dem empirischen Teil, werden 26 ausgewertete Diktate vorgestellt, dabei werden Interferenzen und Defizite zur Rate gezogen, die mit Hilfe des Experteninterviews mit Jovica Letic, Lehrer für muttersprachlichen Unterricht in Tirol, entstanden sind. Diese Problematik soll dann in der Auswertung der Diktate überprüft und bestenfalls bewiesen wer-den.
Die eigene Muttersprache zu beherrschen scheint für viele Menschen selbstverständlich zu sein, sie ist schließlich die erste Sprache mit der ein Mensch konfrontiert wird. Im deutschsprachigen Raum allerdings ist es für Kinder aus Bosnien, Kroatien oder Serbien nicht leicht, die eigene Muttersprache bis zur Perfektion zu pflegen. Sie haben bis zu diesem Endstadium einen sehr weiten Weg vor sich, der möglicherweise ohne Hilfe nie erreicht werden kann. Das größte Problem in diesem Diskurs scheint der Einfluss der deutschen Sprache zu sein. Deutsch ist die Sprache mit welcher die Kinder in ihrem Heranwachsen vorwiegend konfrontiert werden und dabei gerät die eigene Muttersprache in eine ungünstige Position. Kinder, die im deutschsprachigen Raum den muttersprachlichen Unterricht besuchen, zeigen dann besondere Defizite auf, die bei Gleichaltrigen im eigenen Herkunftsland in dieser Form nicht bekannt sind, da dort kein Einfluss einer anderen Sprache herrscht.
Inhalt
1. Einleitung
2. Bilingualität
2.1. Definition
2.2. Erwerb der Bilingualität
3. Der Einfluss des Deutschen auf die Muttersprache B/K/S
3.1. Forschungsstand
3.2. Überprüfung des Forschungstandes ergänzend mit Experteninterview
3.3. Weitere Problematiken unter dem Einfluss des Deutschen
3.3.1. Die Verwendung des Graphems „S“ statt „Z“
3.3.2. Die Verwendung des Graphems „Z, TZ oder TS “ statt „S“
3.3.3. Die Verwendung des Trigraphen „Sch“ statt „Š“
3.3.4. Die Verwendung des Graphems „Š“ statt des „Ž“
3.3.5. Auslassung des Graphems „J“
3.3.6. Die Verwendung des Diphthongs „ai“ oder „ei“ statt „aj“
3.3.7. Die Verwendung des Graphes „W“ statt „V“ und Verwendung des Graphems „F“ anstatt „V“
3.3.8. Die Verwendung des Digraphen „ch“ anstatt „H“ und Einfluss des Dehnungs-H
3.3.9. Unterscheidung „B/P“ und „D/T“ und „G/K“
3.3.10. Die Verwendung eines Doppelkonsonanten
3.3.11. Interferenz in der Groß- und Kleinschreibung
3.3.12 Weitere Interferenzen
4. Zusammenfassung
5. Literaturverzeichnis
6. Anhänge